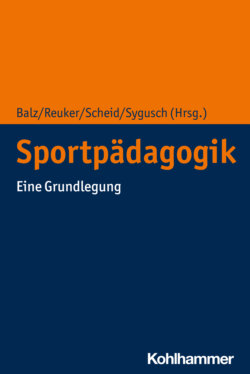Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Die Reform der Turnpädagogik durch Gymnastik, Leibeserziehung, Spiel und Sport
ОглавлениеUm die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zogen alternative Modelle der Leibesübungen, insbesondere Spiel und Sport, in die Schul- und Vereinsturnhallen ein. Die historische Niederlage des Turnens gegenüber Spiel und Sport bahnte sich bereits mit den ersten Olympischen Spielen 1896 in Athen an, wo der englische Sport das präferierte Mittel olympischer Erziehung darstellte, aber nicht die systematischen Körperübungen des deutschen Turnens oder der schwedischen Gymnastik.
Der aus England stammende Sport wurde zunächst keineswegs als Erziehungsmittel verstanden und genutzt. Als Sport wurden die auf mittelalterliche, regionale Spiele und Feste zurückgehenden Vergnügungen, Wettkämpfe, Spiele und Übungen der englischen Gentleman-Klasse bezeichnet, von Ball-Games oder frühen Formen des Crickets bis hin zu verschiedenen Box-, Ring- und Prügelspielen, Wettläufen und Wettkämpfen oder auch Tierspielen und Tierjagden wie der bis heute veranstalteten Fuchsjagd. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden einige Sports and Games Eingang in die Erziehung an den Public Schools. Von diesen aus verbreitete sich der Sport in alle Kreise und Schichten der Bevölkerung Großbritanniens und des ganzen Commonwealth. Sport wurde zu einem Bestandteil des britischen Lebensstils und gehörte zu einem selbstverständlichen, unentbehrlichen Element der Erziehung. Kritiker des Sports sprachen sogar von einem cult of athleticism, der an den englischen Schulen, besonders den Public Schools, betrieben worden sei. Die national orientierten und argumentierenden englischen Pädagogen und Politiker behaupteten dagegen, dass im Sport die Tugenden gelernt würden, die nötig seien, um ein Weltreich zu regieren (Holt, 1993).
Der Aufstieg Englands zur Weltmacht ließ den Sport schließlich zu einem universellen Modell von Leibesübungen werden. Er bildet den Kern der Wettkämpfe und Disziplinen bei Olympischen Spielen. Umgekehrt bekam aber auch der englische Sport erst durch die Olympischen Spiele und den Olympismus eine pädagogische Legitimation. Der internationale Sport wurde mit einer universellen pädagogischen Idee verknüpft.
Der von Pierre de Coubertin (1863–1937) begründete Olympismus war in erster Linie eine pädagogische Idee oder Philosophie (Grupe, 1997). Mit Hilfe des Sports, Coubertin sagte allerdings Athletik und meinte damit einen fair und ritterlich betriebenen Sport, sollte ein Beitrag zum Frieden und zur Solidarität unter den Menschen geleistet werden. Die Olympischen Spiele stellen bis heute das Symbol, aber auch das Bemühen um die Verwirklichung dieser pädagogischen Idee des Sports dar. Die Olympische Charta betont in ihrer Präambel ausdrücklich die pädagogischen Ziele des Olympismus.
In Deutschland erfuhr die Ablösung des turnerischen und gymnastischen Modells der Körpererziehung durch das sportliche und spielerische Modell, durch Sport und olympische Erziehung, eine Ergänzung. Die sog. Jugendbewegung sowie reformpädagogische Ideen und Bestrebungen seit der Jahrhundertwende und besonders in den 1920er Jahren erweiterten das Spektrum der Leibeserziehung (Wedemeyer-Kolwe, 2017). Spielerische Formen von Leibesübungen an der frischen Luft, Turn-, Sport- und Sommerspiele, erfahrungs- und erlebnisorientierte Initiativen und Ansätze in der Pädagogik wie die Arbeitsschul-, Kunsterziehungs- und Landschulbewegung veränderten Inhalte, Formen, Ziele und Konzepte des traditionellen systematischen Turnens. Dafür steht insbesondere der Begriff des natürlichen Turnens, der von den Österreichern Karl Gaulhofer und Margarete Streicher entwickelt, begründet und inhaltlich gefüllt wurde. Der Name war insofern Programm, als die Reform des alten Turnens freiere und natürlichere Formen und Inhalte der körperlichen Erziehung vorsah, die dem Wesen oder der Natur des Kindes eher entsprächen wie das steife Turnen.
In den 1920er Jahren setzte sich im deutschen Sprachraum zunehmend der Begriff Leibeserziehung als Bezeichnung für eine am Körper ansetzende ganzheitliche Erziehung durch. Leibesübungen und Leibeserziehung stellten auf pädagogischem Gebiet sowohl im Ausdruck als auch in ihrer Bedeutung den historischen Kompromiss zwischen Turnen und Sport in den deutschsprachigen Ländern dar. Als Leibeserziehung wurde insbesondere die körperliche und gesundheitliche Erziehung an den Schulen bezeichnet. Sie grenzte sich gegenüber außerschulischen Formen und Inhalten des Turnens und des Sports in Vereinen und in anderen Organisationen ab.
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass in den Vereinen und Verbänden schon immer, beginnend in der Deutschen Turnerschaft, aber auch im Arbeiter-Turn- und Sportbund und schließlich auch in den Sportverbänden, die Nachwuchsarbeit systematisch und in ihrer Intensität zunehmend betrieben wurde. Dafür wurde die Ausbildung für Vorturner, Übungsleiter und Trainer nach und nach ausgebaut und verbessert. Mit diesen in den Vereinen und Verbänden seit dem 19. Jahrhundert entwickelten spezifischen Lehr- und Ausbildungskonzepten wurden pädagogische Ziele und Ansprüche verfolgt, wenn auch nicht wissenschaftlicher Art. Heute stellt das Trainings- und Ausbildungswesen der Verbände die zweite große Säule der modernen, angewandten Sportpädagogik, neben der an den Universitäten verankerten, wissenschaftlichen Sportpädagogik und Sportwissenschaft dar, die aus der Theorie der Leibeserziehung hervorging.
Eine explizite Theorie der Leibeserziehung wurde, aufbauend auf den reformpädagogischen Arbeiten der 1920er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren entworfen und auf breiter Grundlage diskutiert. Name und Inhalte dieser Debatte um Aufgaben, Ziele, Inhalte, Methoden und nicht zuletzt um den kulturellen Stellenwert der Leibeserziehung verbreiteten sich seitdem in aller Welt. Die 1956 in der Bundesrepublik von Sportverbänden, Bund, Ländern und Gemeinden verabschiedeten »Empfehlungen zur Förderung der Leibeserziehung an den Schulen« stehen für den in den ersten Nachkriegsjahrzehnten wieder erreichten gesellschaftlichen Konsens über Leibesübungen und Leibeserziehung an den Schulen. Leibeserziehung sollte mehr sein als ein Unterrichtsfach, sondern ein Prinzip der Erziehung im Ganzen darstellen.