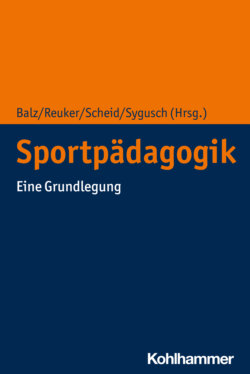Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 Körperliche Erziehung im Nationalsozialismus und in der DDR
ОглавлениеEin Grund für den Paradigmenwechsel in den späten 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland sowie – mit Abstrichen – ebenso in der Schweiz und in Österreich von der Leibeserziehung zur Sportpädagogik und zum Sportunterricht lag auch darin, dass der Begriff Leibeserziehung durch seine politische Instrumentalisierung im Dritten Reich kaum noch tragbar war. Da eine grundlegende öffentliche und schließlich auch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik erst seit den 1960er Jahren einsetzte, erfolgte erst vergleichsweise spät, um das Jahr 1970, eine Distanzierung von dem nun in Deutschland als historisch belastet empfundenen Begriff Leibeserziehung. Grundlegend für diese Aufarbeitung der Geschichte des Sports und der körperlichen Erziehung im Nationalsozialismus wurde die 1966 von Hajo Bernett zusammengestellte und kommentierte Dokumentation der Nationalsozialistischen Leibeserziehung (Bernett, 1966; Neuauflage 2008). Von diesem Buch ausgehend entwickelte sich eine intensive Diskussion über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Turnen und Sport.
Die Nationalsozialisten übernahmen jedoch nicht nur den Begriff Leibeserziehung, sondern ergänzten ihn durch das Konzept der politischen Leibeserziehung. Mit dieser auf Alfred Baeumler und Heinz Wetzel zurückgehenden Formulierung wurde einerseits an die reformpädagogischen Impulse der Zwanzigerjahre angeknüpft, aber andererseits wurde zum Ausdruck gebracht, dass Erziehung insgesamt und besonders die körperliche Erziehung im Sinne und gemäß den Vorstellungen der nationalsozialistischen Weltanschauung erfolgen sollte. Dazu gehörte zunächst eine Aufwertung der körperlichen gegenüber der geistigen Erziehung, darüber hinaus eine Orientierung an nationalsozialistischen und rassischen, insbesondere antisemitischen Zielen sowie an der militärischen Erziehung. Dies traf für Jungen und Mädchen prinzipiell auf gleiche Weise zu, wurde aber entsprechend dem nationalsozialistischen Frauenbild differenziert und fand seinen Ausdruck in unterschiedlichen Lehrplänen für die Leibeserziehung für Jungen und Mädchen.
Die Bedeutung, die im Dritten Reich der körperlichen Erziehung und Ertüchtigung, dem Heranzüchten kerngesunder Körper, wie sich Hitler ausgedrückt hatte, beigemessen wurde, zeigt sich zum einen darin, dass die Zahl der verpflichtenden Unterrichtsstunden für Sport an den Schulen zunächst auf drei und dann auf fünf erhöht sowie an den Universitäten Pflichtsport eingeführt wurde. Zum anderen wurde eigens ein Amt K – für körperliche Erziehung – unter Leitung des Leichtathleten und SA-Funktionärs Karl Krümmel geschaffen, in dem alle Angelegenheiten in Sachen körperlicher Erziehung zentralistisch gebündelt und verordnet werden sollten.
Nach dem Ende des Dritten Reichs wurden in Ost- und Westdeutschland unterschiedliche Wege eingeschlagen. Sie wurden von der Politik der alliierten Besatzungsmächte in Deutschland vorgezeichnet. Im Jahr 1949 wurde in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die DDR gegründet und in den Westzonen die Bundesrepublik Deutschland.
Die Sportentwicklung in der DDR nahm einen ganz anderen Verlauf als in der Bundesrepublik. In der DDR wurde bewusst nicht auf bürgerliche Begriffe wie Leibeserziehung und Leibesübungen zurückgegriffen. Stattdessen verwendete man unter Bezug auf die – kommunistische – Arbeitersportbewegung sowie die Körperziehung in der Sowjetunion die Begriffe Körperkultur und Körpererziehung, als deren Ziel und Aufgabe es angesehen wurde, sozialistische Persönlichkeiten heranzubilden. Aber auch der Begriff des Turnens wurde weiterhin verwendet, insbesondere in den Schulen. Die schulische Körpererziehung war nur ein Teil eines komplexen, von Staat und Partei bestimmten und kontrollierten Systems der Körpererziehung und des Sports. Im Mittelpunkt standen der Leistungssport und die Förderung internationaler sportlicher Erfolge von DDR-Athleten, um einen Beitrag zur Anerkennung und Aufwertung der DDR als zweiter deutscher Staat zu leisten.
Grundlegend für den Aufbau und die Entwicklung der Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet von Körperkultur und Sport in der und für die DDR war die Errichtung der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leipzig im Jahr 1950; drei Jahre, nachdem auf westdeutscher Seite in Köln die Deutsche Sporthochschule gegründet worden war. Letztere wurde von Carl Diem geleitet. Sowohl die DSHS Köln als auch die DHfK Leipzig standen in der Tradition der 1920 gegründeten Berliner Hochschule für Leibesübungen.
Von der DHfK in Leipzig aus wurde eine systematische, staatlich gelenkte wissenschaftliche Forschung in praktisch allen Zweigen des Sports, insbesondere des Leistungs- und Hochschulsports, betrieben. Tausende von Trainern und Lehrern wurden dort ausgebildet, auch aus dem Ausland bzw. aus befreundeten sozialistischen Ländern. Die DHfK und das Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport (FKS) waren mit ein Schlüssel zum Geheimnis des Sportwunders DDR, wie seit den 1970er Jahren gesagt wurde, als die DDR mit knapp 17 Millionen Einwohnern zu einem der erfolgreichsten Sportländer der Erde aufstieg, zumindest gemessen am Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen. Außer an der DHfK erfolgte auch an den Sportinstituten der Hochschulen und Universitäten in der DDR eine Lehrer*innenausbildung im Fach Turnen, körperliche Erziehung und Sport (Spitzer, 1998).
Die Schattenseiten dieses am äußerlichen Erfolg gemessenen vorbildlichen Sport- und Sporterziehungssystems in der DDR, das auch von vielen Ländern auf der Welt nachzuahmen versucht wurde, zeigten sich jedoch erst nach dem Zusammenbruch des Sozialismus und der DDR, als bewiesen werden konnte, was viele schon früher vermutet hatten. Im DDR-Leistungssport wurde mit Hilfe von Sportwissenschaft und Medizin flächendeckend und systematisch gedopt (Berendonk, 1991).