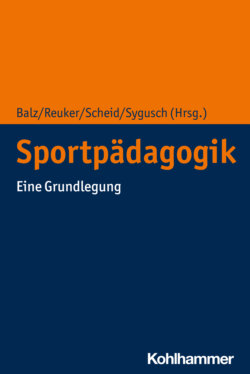Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Zur Systematik der Betrachtungs- und Zugangsweisen
ОглавлениеWie lassen sich wissenschaftliche Betrachtungs- und Zugangsweisen in der Sportpädagogik ordnen? Welche grundlegenden Forschungsansätze können in der Sportpädagogik ausgemacht werden? Beim Blick auf vorliegende Systematisierungen zu Forschungszugängen und Betrachtungsweisen innerhalb der Sportpädagogik, fällt auf, dass es keine nach einheitlichen Systematisierungskriterien geordnete Vorstellung darüber gibt, sondern eher pragmatische Aufzählungen wissenschaftlich-disziplinorientierter Herangehensweisen im Vordergrund stehen (Meinberg 1996, S. 45). Während z. B. Meinberg (1996) zwischen einer »Histeriographie der Sportpädagogik«, »pädagogischen Theorien« des schulischen und außerschulischen Sports inklusive des Spiels und der »vergleichenden Sportpädagogik« unterscheidet (ebd., S. 45–47), greifen Grupe und Krüger (2007) auf eine Systematisierung von Schmitz (1979, S. 65) zurück, in der die Sportpädagogik nach »anwendungsorientierten« Zugängen wie Schulsport, Vereinssport, Seniorensport, Gesundheitssport usf. und »disziplinorientierten« Ausrichtungen wie historisch, systematisch, anthropologisch usf. gegliedert wird. Demgegenüber wird in neueren Überblicksbeiträgen zwischen grundlegenden wissenschaftlichen Betrachtungsweisen und Subdisziplinen der Sportpädagogik differenziert (König, 2020, S. 55–58).
So geht Prohl (2010) von drei wissenschaftlichen Zugangsweisen in der Sportpädagogik aus, die er als problemgeschichtlich, bildungstheoretisch und erziehungswissenschaftlich bezeichnet (ebd., S. 344). In der problemgeschichtlichen Betrachtungsweise der Sportpädagogik geht es darum, Ideen und Konzepte der Leibeserziehung und des Sports in der historischen Entwicklung von Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport nachzuzeichnen, indem insbesondere die Bedeutung von Leiblichkeit und Bewegung zwischen individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen in der Erziehung diskutiert werden (ebd.; Neuber et al., 2013, S. 407–416; ausführlich Krüger, 2019). Die bildungswissenschaftliche Perspektive der Sportpädagogik beschäftigt sich mit Fragen von Bildung und Erziehung in der Bewegungs- und Sportkultur. Sie steht in enger Verbindung mit der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Pädagogik und entwickelt auf einer normativen Basis Sollensvorstellungen für sportpädagogisches Handeln in verschiedenen Settings der Lebensspanne, die idealtypisch auch für Beratungsleistungen genutzt werden (Prohl, 2010, S. 18; z. B. Ruin & Stibbe, 2020). Die erziehungswissenschaftliche Sichtweise setzt sich schließlich mit empirischen Tatsachen »über die Mittel, Wege und Hindernisse« zur Realisierung von Bildungszielen in der Erziehungswirklichkeit der Bewegungs- und Sportkultur auseinander (Prohl, 2010, S. 18; Hervorhebungen i. Orig.). Diese erfahrungswissenschaftliche Forschung steht allerdings immer in einem bildungstheoretischen Kontext. Damit erweist sich die Sportpädagogik als ein sportwissenschaftliches Teilgebiet zwischen Sollen und Sein (ebd.), das sich einerseits als bildungstheoretisch-normative bzw. theoretisch-systematische Sportpädagogik und andererseits als empirisch-analytische Sportpädagogik versteht (Balz, 2009; Neuber et al., 2013, S. 428; Krüger, 2019, S. 31–33).
Die besondere Verbindung von normativen und empirisch-analytischen Zugangsweisen, die in den Horizont bildungstheoretischer Fragen nach dem Wozu und Warum eingebettet sind, kann gewiss als wesentliches Merkmal der Sportpädagogik im Vergleich zu anderen sportwissenschaftlichen Disziplinen angesehen werden. Sie zeichnet sich durch ein pädagogisch-humanes Interesse oder eine pädagogische Orientierung aus (Kurz, 2017). In diesem Zusammenhang ist es eine wichtige Aufgabe der Sportpädagogik, Erkenntnisse und praktische Implikationen kritisch im Blick auf das pädagogische Interesse zu prüfen (ebd., S. 213). Dies bedeutet, dass das Aufspüren und die Reflexion des zugrunde gelegten, meist impliziten Menschenbildes von besonderer Bedeutung ist, weil die »beiden für die Erziehungspraxis […] zentralen Kategorien der Bildungsziele und der Erziehungsmaßnahmen […] unweigerlich davon beeinflusst [werden]« (Prohl, 2010, S. 14; ähnlich Prohl, 2013, S. 13–14). So gilt es, eine »reflexive Verknüpfung« von Normativem und Empirischem zu leisten, weil sich aus empirischen Fakten keine »wünschenswerte[n] Normen« ableiten wie sich auch umgekehrt aus normativen Orientierungen keine empirischen Tatsachen folgern lassen (Balz, 2009, S. 7).
Jenseits dieser grundlegenden Forschungsparadigmen lassen sich in Anlehnung an König (2020, S. 56–58) folgende Subdisziplinen bzw. disziplinorientierte Zugangsweisen der Sportpädagogik erkennen (u. a. auch Scherler, 1992):
• Die Historische Sportpädagogik beschäftigt sich mit der Geschichte von Leibesübungen und Sport, die im Wesentlichen mit der oben dargestellten problemgeschichtlichen Perspektive der Sportpädagogik korreliert, d. h., sie unterscheidet sich von der Sportgeschichte durch ihre spezifische pädagogische Sichtweise (z. B. Krüger, 2019).
• Im Unterschied dazu geht es in der Systematischen Sportpädagogik um einen gegenwartsbezogenen Erkenntnisgewinn. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Fragen zur wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Ausrichtung sowie zur methodologischen Orientierung der Sportpädagogik (Scherler, 1992, S. 164).
• Ziel der Vergleichenden Sportpädagogik ist es, den Stellenwert der Bewegungs- und Sportkultur in der Erziehung über Deutschland hinaus in international vergleichender Absicht zu betrachten (z. B. Haag, 2010).
• In der Anthropologischen Sportpädagogik werden anthropologische Grundannahmen und Themen wie Körper, Bewegung, Gesundheit, Spiel und Leistung im Zusammenhang mit Bewegung, Spiel und Sport behandelt (Grupe, 1984). Hierbei geht es primär um den Menschen in seinen Bezügen zu und Entwicklungsmöglichkeiten durch Bewegung, Spiel und Sport, die immer auch gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten und Wandlungen unterliegen (König, 2020, S. 57).
• Die Schulsport-Pädagogik befasst sich mit Bildungs- und Erziehungsfragen von Bewegung, Spiel und Sport in der Schule. Sie weist damit eine besondere Nähe zur Schulpädagogik und Sportdidaktik auf (ebd.). Während es für Lange (2014, S. 6–7) im Blick auf den Schulsport keinen Unterschied zwischen Sportpädagogik (oder Schulsport-Pädagogik) und Sportdidaktik gibt, sehen Prohl und Scheid (2017, S. 11) Sportdidaktik als »angewandte Sportpädagogik«, in der vornehmlich die Was- und Wie-Fragen, d. h. Inhalts- und Vermittlungsfragen, diskutiert werden. Demgegenüber werden Warum- und Wozu-Fragen, also Sinn- und Begründungsfragen, in analytischer Trennung primär von der Sportpädagogik geklärt (ebd.). Ungeachtet der jeweiligen Standortbestimmung stehen Sportpädagogik und Sportdidaktik in enger Beziehung zueinander, weil Ziel-, Inhalts- und Methodenfragen in einem Interdependenzzusammenhang stehen und nicht unabhängig voneinander diskutiert werden können. In diesem Sinne bezeichnen Balz und Kuhlmann (2003, S. 26) Sportdidaktik auch als »schulbezogene Sportpädagogik«. Insbesondere im Blick auf die Sportlehrer*innenbildung in Lehramtsstudiengängen wird die Sportdidaktik traditionell als zentrales Teilgebiet der Sportpädagogik bestimmt (u. a. Größing, 2003, S. 509; Prohl & Scheid, 2017, S. 11).
• Bereits die Bezeichnung Außerschulische Sportpädagogik weist darauf hin, dass die wissenschaftliche Betrachtung von Bildung und Erziehung im Handlungsfeld der Bewegungs- und Sportkultur an Orten außerhalb der Schule erfolgt. Wenngleich »die pädagogische Dimension nicht die Hauptursache des außerschulischen Sports ausmacht, öffnet sich trotz alledem dieses Handlungsfeld pädagogischen Interpretationen und Untersuchungen […]« (Meinberg, 1996, S. 47). Im Sinne eines »Sports für alle« gewinnt sie angesichts gesellschaftlicher Differenzierungen zunehmend an Bedeutung, wie z. B. Überlegungen und Studien zum Kinder- und Jugend-, Behinderten- oder Alterssport zeigen (dazu König, 2020, S. 57–58; Thiele, 2018, S. 4–6).