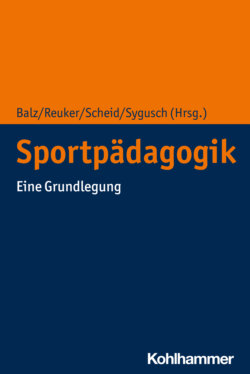Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Zur Systematik der Arbeitsgebiete
ОглавлениеWomit beschäftigt sich die Sportpädagogik? Wie lassen sich die Arbeitsgebiete der Sportpädagogik kennzeichnen? Mit solchen Fragen wird angedeutet, dass sich die Sportpädagogik auch als eine Teildisziplin innerhalb der Sportwissenschaft mit einem Anwendungsbezug versteht. Forschungsinteressen in humaner Absicht verfolgen das Ziel, neue Erkenntnisse über das jeweilige Sportengagement von Menschen und über Prozesse im Sport bereitzustellen, um damit die oben ausgewiesenen Aufgaben noch besser erfüllen zu können. Versuche, solche Aufgabengebiete nicht nur einigermaßen übersichtlich, sondern auch noch möglichst stringent und flächendeckend zu beschreiben, sind in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach vorgelegt worden – zuletzt und vermutlich auf den größten gemeinsamen Nenner gebracht wurden sie von Prohl (2013) und hier sogar mit ausdrücklichem Verweis auf die sich neu formierende Sportwissenschaft, die Ende der 1960er- bis Anfang der 1970er-Jahre die bis dahin bestehende Theorie der Leibeserziehung als zeithistorische Vorläuferin der Sportpädagogik abgelöst hat: »Die neu-etablierte Sportwissenschaft sollte sich einerseits gegenüber gesellschaftlichen und politischen Aspekten des Sports in Schule, Freizeit und im Leistungsbereich öffnen und dabei andererseits ein Theorie-Praxis-Verhältnis auf empirischer Grundlage entwickeln, das sich an den forschungsmethodischen Standards des kritisch-rationalistischen Wissenschaftsmodell zu orientieren hatte« (Prohl, 2013, S. 10).
Schule, Freizeit und Leistungsbereich werden hier als die drei zentralen Arbeitsgebiete ausgewiesen. Abgesehen davon, dass in diesem Begriffstrio dem Wortlaut nach von Sport nicht die Rede ist, fehlt es den Termini an semantischer Stringenz. Dennoch lassen sie sich als geeignete Basis verwenden, die Arbeitsgebiete der bzw. für die Sportpädagogik systematisch abzuleiten. Schule ist jene Institution, in der Sport als reguläres Schulfach von professionell ausgebildeten Sportlehrkräften durchgängig während der Schullaufbahn unterrichtet wird bzw. unterrichtet werden soll. Dem Schulsport verdankt die Sportwissenschaft bzw. die Sportpädagogik so gesehen wesentlich ihre akademische Legitimierung als Studienfach, und im Zuge der sich neu-etablierenden Sportwissenschaft erlangte die Sportpädagogik vor allem dadurch ihre Berechtigung. Dabei ist wesentlich in Anschlag zu bringen, dass sie »ihren Gegenstand als angewandte Wissenschaft im Spannungsfeld zwischen Werten und Tatsachen findet, also zwischen Sollens- und Seins-Aussagen vermittelt und ihre Forschungsergebnisse didaktisch anschlussfähig sind, sie also über ein reflektiertes Theorie-Praxis-Verhältnis verfügt« (Prohl 2013, S. 12). In dieser Hinsicht lassen sich nach bzw. neben dem Schulsport die beiden weiteren Bereiche Freizeit und Leistungsbereich hier ganz gut anschließen, zumal mit Freizeit all das gemeint sein kann, was im nicht-institutionellen Raum an Sport stattfindet, während im Leistungsbereich all das zur Aufführung gelangt, was mit dem Moment des Messens, Vergleichens, Wettkämpfens etc. verbunden ist.
Diese systematische Dreiteilung mit den Domänen Schule, Freizeit und Leistungsbereich lässt jedoch mit Blick auf das Phänomen Sport eine notwendige Trennschärfe vermissen. Insofern stellt sich die weitere Frage, inwieweit kleinformatige Systematiken weiterhelfen und eine Annäherung an den Sport herstellen können. Dieses Ansinnen wiederum unterliegt der Gefahr, am Ende einer systematisch konzipierten Aufzählung einen Teilbereich entweder gar nicht berücksichtigt oder wiederum Überschneidungen zugelassen zu haben. In dieser Hinsicht kann die Frage nach dem völligen Verzicht auf eine systematische Darstellung von Arbeitsgebieten in den Raum gestellt werden – anders: Das (einzig) systematische Arbeitsgebiet der Sportpädagogik bestünde dann darin, sich dem (noch nicht) bewegenden und sporttreibenden Menschen in seiner Lebensspanne (zwischen beginnendem Leben und drohendem Tod) zu widmen.
Schaut man sich (neuere) vorliegende Systematiken mit möglichen Arbeitsgebieten der Sportpädagogik unterhalb der Prohlschen Trias an, dann gehen diese in aller Regel selbst systemisch vor, in dem sie Domänen benennen, die als mögliche Arbeitsgebiete (synonym Handlungsfelder) der Sportpädagogik gelten können. Um der Gefahr der Verletzung der Vollständigkeit an Arbeitsgebieten in systematischer Absicht zu begegnen, bedient man sich oftmals insofern einer Hilfskonstruktion, als selbst in grafischen Darstellungen mit Hinweisen wie »etc.« oder »…« grundsätzlich Ergänzungen von (fehlenden und/oder zukünftig neuen) Arbeitsfeldern vorgenommen werden können (z. B. Balz & Kuhlmann, 2003, S. 27). Während z. B. Haag und Hummel (2001, S. 366–460) in ihrem Handbuch zur Sportpädagogik noch eine personalisierte Systematik nach Zielgruppen im Lebenslauf bevorzugen, identifiziert z. B. König (2013, S. 66–68) Schulsport, Breitensport und Spitzensport als wesentliche Themenfelder und Forschungsschwerpunkte. Diese drei Arbeitsgebiete bilden demnach semantisch das sportbezogene Äquivalent zu dem sport-neutralen Begriffstrio von Prohl oben.
Eine ganz andere (systematische) Betrachtungsweise ergibt sich, wenn man nicht den Sport als Ausgangspunkt nimmt, um daraus systematisch Arbeitsgebiete zu erfassen, sondern selbstreferenziell in Anschlag bringt, was denn den Arbeitsbereich Sportpädagogik ausmacht, wie er sich als etablierte universitäre Arbeitseinheit systematisch beschreiben lässt. Welches besondere Profil kann die Sportpädagogik innerhalb der Fakultäten und Institute für Sportwissenschaft an den Hochschulen für sich in Anspruch nehmen? Wo liegen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu anderen Arbeitsbereichen bzw. Teildisziplinen der Sportwissenschaft? Der Frage nach dem »Kern« des Arbeitsbereichs Sportpädagogik widmet sich z. B. der neuere Band von Balz (2019), bezogen auf den speziellen Arbeitsbereich in Wuppertal, den er (gemäß Gliederung des Inhaltsverzeichnisses) mit vier (typischen?) Arbeitsgebieten profiliert: in (1.) Normative Sportpädagogik (im Sinne von Planungsdidaktik), in (2.) Empirische Sportpädagogik (im Sinne von Bildungsforschung), in (3.) (Kommunal-) Politische Sportpädagogik (im Sinne von Sportentwicklung) und in (4.) Vermittelnde Sportpädagogik (z. B. im Sinne von Lehrerbildung).
Diese Systematik korrespondiert einerseits mit den Aufgaben von Forschen und Lehren, macht aber andererseits deutlich, dass die Sportpädagogik im Gegensatz zu anderen Teildisziplinen der Sportwissenschaft zu einer »gesellschaftlich engagierten Sportpädagogik« (ebd., S. 7) reifen kann, sobald sie (eben: sportpädagogisch imprägniert) die Aufgabe wahrnimmt, »sich an konkreten Projekten zur Sportentwicklung kooperativ zu beteiligen bzw. solche selbst (vor Ort) zu initiieren« (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 91). Das können Vorhaben »etwa zur innovativen Vereinsentwicklung, zu informellen Sportszenen, zur Dopingbekämpfung im Spitzensport oder zur inklusiven Schulsportentwicklung« (ebd., S. 91) sein (vgl. dazu auch die »Projekte aus deutschen Quartieren« von Balz & Kuhlmann, 2015). Die Beispiele aus den Arbeitsgebieten der Sportpädagogik erweisen sich als anschlussfähig sowohl für die Dreigliederung von Prohl (2013) mit Schule, Freizeit und Leistungsbereich als auch von König (2013) mit Schulsport, Breitensport und Spitzensport.