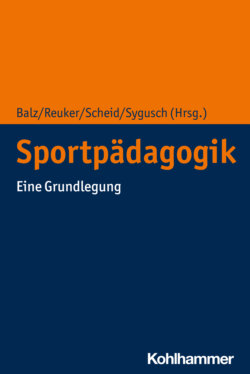Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.8 Resümee
ОглавлениеDie Genese der Sportpädagogik zeigt zunächst, dass die sportlich-körperliche Erziehung immer, wenn auch jeweils in unterschiedlicher Weise, im Zusammenhang mit der geistigen und moralischen Bildung und Erziehung des Menschen stand. Darüber hinaus waren Leibesübungen und Sport stets in ihren konkreten Zielen, Formen und Inhalten von den jeweiligen politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen mitgeprägt.
Den Sport an sich gibt es nicht, sondern ihn gibt es immer nur in Form »kultureller Objektivationen« (Bernett, 1975) oder sozialer Konstruktionen von Leibesübungen. Dasselbe gilt für Bildung und Erziehung im und durch Bewegung, Spiel und Sport. Was Sport ist und was Sporterziehung bedeutet, ist Ergebnis sozialer Prozesse und Kommunikation. Es hat sowohl Zeiten gegeben wie die frühe Turnbewegung, in denen Leibesübungen, Gymnastik und Spiele offener und weniger formalisiert erschienen, als auch Phasen wie das Wilhelminische Kaiserreich, den Nationalsozialismus und die DDR, in denen definierte Systeme von Turnen und körperlicher Erziehung die Theorie und Praxis der Leibesübungen beherrschten. Allzu starre Formen riefen jedoch in der sportpädagogischen Praxis und Theorie auch Gegenbewegungen hervor, wie dies in den 1920er Jahren der Fall war, als neue Themen, Inhalte und Formen von Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport entstanden.
Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport stehen in spezifischen kulturellen Kontexten und waren stets von dem beeinflusst, was Politik und Gesellschaft von ihnen forderten. Als entscheidend hat sich dabei nicht die Tatsache ihrer pädagogischen Funktionalisierung und Instrumentalisierung erwiesen, sondern deren Ausmaß und Richtung. Hinter diesem Problem der Instrumentalisierung steht die theoretische Frage, ob es eine Eigenständigkeit des Sports, also einen eigenen Sinn des Sports geben könne (Güldenpfennig, 1996), der nicht notwendigerweise ein pädagogischer Sinn ist oder sein muss.
Die Geschichte des Sports und der Leibeserziehung im Nationalsozialismus und in der DDR hat sich in Bezug auf dieses Problem der Instrumentalisierung als besonders aufschlussreich erwiesen. Leibeserziehung und Sport standen Im Dienst von Diktaturen. Ihr Sinn und ihre konkreten Formen und Inhalte entsprachen den politischen und ideologischen Zwecken der politischen Machthaber. Der NS-Staat und das totalitäre Regime in der DDR haben sich jedoch auf unterschiedliche Weise des Sports für ihre Zwecke bedient: Die Nationalsozialisten wollten mit Hilfe des Sports und der Leibeserziehung einen neuen Menschentyp, eine neue Rasse heranzüchten, mittels derer sich die Welt beherrschen lassen sollte. In der DDR wurden Körperkultur und Sport gezielt eingesetzt, um sozialistische Persönlichkeiten zu formen. Schließlich sollten internationale Erfolge im Leistungssport dazu dienen, der DDR als Staat Ansehen und Legitimität zu verleihen. Beides hat auch dazu geführt, dass der Sport weniger zum Wohl und zur Bereicherung des Lebens der Menschen dienen konnte, sondern letztlich zum Gegenteil. Dies kann im Übrigen auch in einem extrem kommerzialisierten und professionalisierten Sport der Fall sein, wenn Sport zur Last und zum Zwang wird, und nicht freiwillig und aus Freude betrieben wird.
Die bürgerliche Tradition der Leibesübungen und Leibeserziehung seit der europäischen Aufklärung und den Philanthropen in Deutschland beruht dagegen auf der Idee, durch geeignete Leibesübungen (Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport) einen Beitrag zur Bildung und Erziehung der Menschen zu leisten. Sportpädagogik als eine Form der »Leibesemanzipation«, wie dies Hermann Lübbe (2008) nannte, reicht jedoch über die Grenzen der eigenen Leiblichkeit hinaus und zielt auf einen besseren Sport in einer besseren Welt.