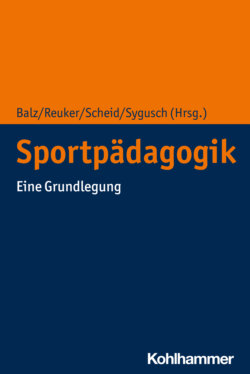Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.6 Sportpädagogik und Sportwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland
ОглавлениеEntscheidende Veränderungen in der Geschichte der Sportpädagogik und Sportwissenschaft in Westdeutschland erfolgten in der Bundesrepublik Deutschland nach 1950 und schließlich in den späten 1960er Jahren. In dieser Zeit begann in den alten Bundesländern die akademische Institutionalisierung sportpädagogischer Aktivitäten auf breiterer Basis. Die Leibeserziehung und ihre Theorie wurden zur Sportpädagogik und Sportwissenschaft. Sie war der Ursprung der Sportwissenschaft und entwickelte sich zu einem Teil der Sportwissenschaft neben anderen wissenschaftlichen Teildisziplinen.
Die nach 1945 eher skeptische Einstellung der Universitäten gegenüber der Einrichtung eigener wissenschaftlicher Fächer des Gegenstandsbereichs Leibesübungen und Sport änderte sich zu der Zeit, als sich in einigen akademischen Fachdisziplinen die Einsicht verbreitete, dass es angebracht und nützlich sein könnte, einem wachsenden gesellschaftlichen und alltagskulturellen Phänomen wie dem Sport mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es handelte sich dabei meistens um die erziehungswissenschaftlichen, pädagogischen oder auch philosophischen Fakultäten, wie bspw. in Tübingen, wo 1969 in der Philosophischen Fakultät und auf Initiative des Faches Pädagogik einer der ersten Lehrstühle für die Theorie der Leibeserziehung eingerichtet wurde. Umgekehrt setzte sich auf Seiten des Sports die Auffassung durch, dass wissenschaftliche Disziplinen bei der Lösung mancher Probleme des Sports hilfreich sein können. Dazu gehörten auch Fragen des systematisch angeleiteten Trainings von Athlet*innen.
Man kann die daraus resultierenden Änderungen als Verwissenschaftlichung des Sports bezeichnen, der sich mittlerweile zu einem Massenphänomen und zu einem unübersehbaren Teil kulturellen und gesellschaftlichen Lebens und damit der Alltagspraxis vieler Menschen entwickelte. Zudem standen zu der Zeit die Olympischen Spiele 1972 in München vor der Tür. Die politische Instrumentalisierung des Sports in Verbindung mit den Ost-West-Auseinandersetzungen führte dazu, dass dabei auch die Ressourcen der Sportwissenschaft genutzt werden sollten. Neben dem Leistungssport gewann der Breitensport an Bedeutung, wobei vor allem die gesundheitlichen Möglichkeiten des Sports umgesetzt werden sollten. Der Sport, seine Akteure und seine Settings wurden zunehmend als Untersuchungsgegenstand auch von zuvor eher zurückhaltenden Wissenschaften akzeptiert.
Die Vertreter*innen von Turnen und Sport in den Vereinen und Verbänden forderten den Ratschlag und die Ergebnisse der Wissenschaft oder Wissenschaften an. Sie hatten verstanden, dass eine Organisation von der Größe des Deutschen Sportbundes, in dessen Mitgliedsorganisationen rund ein Drittel der Bevölkerung organisiert sind, bei der Lösung seiner Aufgaben und Probleme der wissenschaftlichen Beratung und Unterstützung bedürfe. Sie erkannten, dass die Entwicklung im Bereich des Hochleistungssports zunehmend von der Umsetzung trainingspädagogischer und trainingswissenschaftlicher Erkenntnisse bestimmt wurde und dass wissenschaftliche Einsichten für den Breitensport und für die Prophylaxe und Rehabilitation im Gesundheitsbereich ebenso wichtig seien wie für Leibeserziehung und Sport in der Schule.
Hinzu kamen zwei Gesichtspunkte, die mit dem Sport auf den ersten Blick nichts zu tun hatten: Erstens die Veränderung der Rolle der Wissenschaft in einer verwissenschaftlichten Welt, in der Gewicht und Rolle von Alltagserfahrungen abnehmen, weil viele der zu lösenden Probleme mit ihnen nicht mehr zu bewältigen sind. Wir leben in einer Welt, so eine verbreitete Einschätzung, die mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden planbar, oft auch voraussagbar, erklärbar und berechenbar zu sein scheint. Diese Welle der Verwissenschaftlichung erfasste auch den Sport.
Zweitens erfolgte seit den 1960er Jahren in allen Bereichen, die mit Lehre, Unterricht, Ausbildung oder Training zu tun hatten, ein Prozess der Qualifizierung und Professionalisierung. Das heißt, Erziehung und Bildung, Lehre und Unterricht auf dem Gebiet des Sports sollten möglichst von eigens dafür ausgebildeten Fachleuten getragen und mit Hilfe von Expertenwissen gestützt werden. Eine solche Professionalisierung bedeutete zugleich Verwissenschaftlichung. Das galt nicht nur für die traditionellen Ausbildungsgänge der Turn- und Sportlehrer*innen, sondern auch für die Ausbildung von Trainer*innen sowie neben- und ehrenamtlich tätige Übungsleiter*innen in den Vereinen und Verbänden des Sports.
Der 1950 gegründete Deutsche Sportbund verstand sich als Förderer von Wissenschaft, Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der Leibesübungen und des Sports. Er forderte nicht nur die Einrichtung von Sportprofessuren an den Universitäten, sondern leitete auch eigene Initiativen zur Förderung der Sportwissenschaft ein, so bspw. den Carl-Diem-Wettbewerb 1952 zur Förderung des sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Nachwuchses, die Gründung des Zentralkomitees für Forschung auf dem Gebiete des Sports 1955 und seiner Kuratorien für die sportmedizinische und sportpädagogische Forschung, die Gründung einer sportwissenschaftlichen Schriftenreihe und einer eigenen sportwissenschaftlichen Zeitschrift mit dem Namen Sportwissenschaft – zusammen mit dem Ausschuss Deutscher Leibeserzieher (ADL).
Die Etablierung von Sportwissenschaft und Sportpädagogik an Universitäten in Deutschland war ein Zeichen dafür, dass die wissenschaftliche Behandlung des Sports ein gesellschaftliches Interesse und eine öffentliche Nachfrage insgesamt widerspiegelte. Nur dies rechtfertigte es letztendlich und lieferte die Gründe, dass mit erheblichem finanziellem und personellem Aufwand der Aufbau und die Entwicklung der Sportwissenschaft zu einem öffentlichen Anliegen gemacht wurden. Inzwischen war es mehr oder weniger selbstverständlich geworden, dass ein solches gesellschaftliches, politisches und kulturelles Ereignis wie der Sport – nun nicht mehr nur als Schulsport – in seinen verschiedenen Formen als Breiten- und Freizeitsport, Wettkampf- und Spitzensport, als Gesundheitssport und als besonderes Mittel der Prävention und Rehabilitation der wissenschaftlichen Bearbeitung bedarf. Mit der Bereitstellung von Mitteln für Sportförderung waren nun die sachlichen Voraussetzungen für die Entwicklung der Sportwissenschaft an den Universitäten und Hochschulen in Deutschland gegeben.