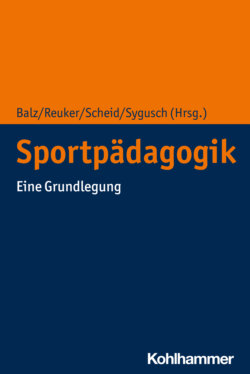Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Zur Systematik des Aufgabenspektrums
ОглавлениеWozu gibt es die Sportpädagogik? Welche Aufgaben verfolgt die Sportpädagogik? Wodurch verdient sie ihre Originalität gegenüber den anderen Teildisziplinen innerhalb der Sportwissenschaft, aber auch mit Blick auf die Erziehungswissenschaft? Solche Fragen lassen erkennen, dass es hierbei auch um die Darstellung von wissenschaftlichen Leistungen geht, mit denen sich die Sportpädagogik in das Ensemble der Teildisziplinen der Sportwissenschaft einbringt und ihr besonderes Profil schärft. Eine tragfähige Arbeitsbasis für die Darstellung des Spektrums der Sportpädagogik bildet z. B. das Aufgabengerüst aus dem Lehrbuch zur Sportpädagogik von Balz und Kuhlmann (2003, S. 24). Solche Aufgaben beziehen sich prinzipiell auf die Zusammenhänge von Sport und Erziehung, und zwar in (mindestens) vierfacher Hinsicht:
• Deskription: Diese Aufgabe der Sportpädagogik soll verdeutlichen, das jeweilige Sportengagement von Menschen sowie Entwicklungen im Sport differenziert in Art und Ausmaß zu beobachten und zu beschreiben. So gesehen umfasst Deskription die Grundlage für Aufklärung in pädagogischer Perspektive.
• Reflexion: Diese Aufgabe der Sportpädagogik soll verdeutlichen, das jeweilige Sportengagement von Menschen und Entwicklungen im Sport differenzierter zu hinterfragen und zu ergründen. So gesehen können sich aus einer Reflexion neue Deutungs- und Handlungsmöglichkeiten in pädagogischer Perspektive ergeben.
• Legitimation: Diese Aufgabe der Sportpädagogik soll verdeutlichen, das jeweilige Sportengagement von Menschen und Entwicklungen im Sport differenzierter auf ihren Wert zu betrachten und zu begründen. So gesehen kann Legitimation belastbare Argumente für Initiierung, Erhalt, Pflege und Ausbau von Sportengagement und Sportförderung in pädagogischer Perspektive bieten.
• Orientierung: Diese Aufgabe der Sportpädagogik soll verdeutlichen, das jeweilige Sportengagement von Menschen und Entwicklungen im Sport differenzierter dahingehend auszulegen, in welcher Richtung und mit welchem Ansinnen Beratungs- und Unterstützungsleistungen in pädagogischer Perspektive zu empfehlen sind.
Dieses vierteilige Aufgabenspektrum ließe sich mit weiteren Überlegungen (z. B. von Grupe und Krüger, 2007; zuletzt Krüger, 2019) erweitern, wonach die Aufgabe der Sportpädagogik generell darin besteht, »Analyse und Reflexion des Sports unter pädagogischen Gesichtspunkten« (S. 76) zu betreiben.1 Solchen analytischen Zuschreibungen unterliegt ferner das Interesse, den Sport besser zu gestalten. Diese Aufgabe der Sportpädagogik lässt sich prinzipiell daran festmachen, wie mit den Mitteln des Sports die Entwicklung insbesondere junger Menschen (weiter) gefördert und wie mit Sport das Leben der Menschen insgesamt bereichert werden kann. Damit wird nicht zuletzt das humane Interesse am Sport in pädagogischer Absicht untermauert, zumal sich das humane Interesse vom technischen insofern abgrenzen lässt, als dieses primär nach den (technischen) Möglichkeiten fragt, Leistungen im Sport zu steigern.
Diese Absicht darf aber nicht darüber hinwegsehen, dass dem Sport prinzipiell die Ambivalenz-Hypothese innewohnt – am Beispiel: Regelmäßiges Sporttreiben kann die Gesundheit fördern; der Sport kann aber auch auf ganz unterschiedliche Weise (z. B. durch Dopingmissbrauch) der Gesundheit schaden. Mit Hilfe dieser Ambivalenz-Hypothese lässt sich aber das pädagogische Anliegen klarer herausstellen: Es muss im Sinne der vier o. a. Kriterien Aufgabe der Sportpädagogik sein, die förderlichen Absichten zu stärken und die hinderlichen zu schwächen.
Die Sportwissenschaft und insbesondere die Sportpädagogik darf die Erfüllung ihrer Aufgaben aber auch nicht überschätzen. Darauf hat u. a. Ommo Grupe (zuletzt 2000, S. 287–294) aufmerksam gemacht. Die (systematische) Aufgabe besteht lediglich darin, »Wissen sozusagen als Angebot zur Erklärung, zum besseren Verständnis und zur Bearbeitung von praktischen Fragen und Problemen« (ebd., S. 293) bereitzustellen. Daraus folgt auf der anderen Seite, dass es nicht darum gehen kann, explizite »Handlungsanweisungen für den Sport, also z. B. für Trainer und Sportlehrer« (ebd.) zu formulieren. Die Erkenntnisse aus der Sportpädagogik sind lediglich Angebote: »Wieweit diese dann aber wirklich umgesetzt werden, liegt außerhalb ihrer Reichweite« (ebd.). Insofern bleibt die Erfüllung der Aufgaben der Sportpädagogik immer fragil.
Bisher war in diesem Abschnitt nur von den Aufgaben der Sportpädagogik die Rede. Dabei muss immer mitgedacht werden, dass diese Aufgaben von Menschen, also in diesem Fall von Sportpädagog*innen an den Hochschulen und Universitäten wahrgenommen werden. Würde man sie danach fragen, was denn ihre beruflichen Aufgaben sind und inwiefern sie diese systematisch verfolgen, dann käme als eine Antwortmöglichkeit sicher in Frage, das alltägliche Aufgabenprofil der Profession mit dem Lehren, Forschen, Verwalten oder ähnlich grundlegend zu beschreiben. Ist das auch eine Systematik der Sportpädagogik, respektive ihrer dort handelnden Personen? Ja, weil damit die wesentlichen Tätigkeiten umfassend beschrieben sind, und nein, weil sich das Tätigkeitsspektrum auf dieser dreiteiligen Basis sicher noch viel differenzierter beschreiben ließe.
Zum Lehren gehört z. B. auch das Prüfen, zum Verwalten gehört das (Selbst-) Management. In dieser Hinsicht haben Balz und Kuhlmann (2019) vermutlich erstmals innerhalb unseres Faches versucht, die hervorstechenden beruflichen Tätigkeiten in einer feingliedrigen Systematik als Siebenkampf darzustellen. Demnach gehören dazu diese sieben Bereiche: (1.) das Lehren (z. B. Medieneinsatz in Lehrveranstaltungen), (2.) das Prüfen (z. B. Betreuung von Abschlussarbeiten), (3.) das Forschen (z. B. Formate der Antragsstellung), (4.) das Publizieren (z. B. Grundsätze guten wissenschaftlichen Arbeitens), (5.) das Beraten (z. B. Mitwirkung in außeruniversitären Gremien), (6.) das Selbstverwalten (z. B. Wahrnehmung von Leitungsfunktionen) und (7.) das Selbstmanagen (z. B. Zeitbudgetierung). Man könnte an dieser Stelle einwenden, dass solche Tätigkeiten z. B. von Sportsoziolog*innen, aber auch von Wirtschaftswissenschaftler*innen genauso wahrgenommen werden müssen, also eine systematische Äquivalenz innerhalb (und vielleicht sogar außerhalb) der Sportwissenschaft besteht. Aber es kommt hinzu: Wir als Sportpädagog*innen müssen uns dabei fragen bzw. reflektieren, wie wir in unserem beruflichen Handeln mit Sport von anderen wahrgenommen werden (wollen).