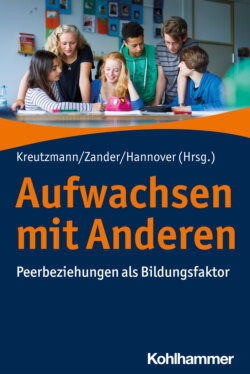Читать книгу Aufwachsen mit Anderen - Группа авторов - Страница 34
3.2 Peers als Bildungsinstanz
ОглавлениеFür eine genauere Betrachtung von Peereinflüssen auf den einzelnen Schüler bzw. die einzelne Schülerin ist es zunächst wichtig, mögliche Konstellationen klasseninterner Peerkontakte zu spezifizieren. Diese können z. B. nach der Anzahl der Interaktionspartnerinnen und -partner unterschieden werden, wobei sich der Komplexitätsgrad mit zunehmender Anzahl an Interaktionspartnerinnen und -partner erhöht (Hinde, 1976; Zander, Kreutzmann & Hannover, 2017). Die drei zentralen Ebenen sind hierbei die Dyade (z. B. Freundschaft, Lerntandem), die Gruppe (z. B. Clique, Lerngruppe) und der Klassenverband ( Abb. 3.1). Ein Spezifikum der Dyade ist, dass sich der Kontakt immer zwischen zwei Personen abspielt. Dabei lassen sich dyadische Peerkontakte nochmals in situational bedingte Interaktionen und längerfristige Beziehungen unterscheiden. Der Unterschied ergibt sich aus den Vorerfahrungen, die mit der Person gemacht wurden, und welche Erwartungen sich daraus für das Verhalten des Gegenübers ergeben. Haben Schülerinnen und Schüler wenig Vorerfahrungen bzw. keine speziellen Erwartungen an das Verhalten ihres Gegenübers und ist der Kontakt zudem zeitlich begrenzt, so werden Peerkontakte als situational bedingte Interaktionen bezeichnet. Ein Beispiel hierfür könnte sein, dass Schülerinnen und Schüler ausschließlich Lernmaterialien untereinander austauschen. Interaktionen können wiederum eingebettet sein in Beziehungen. Beziehungen sind durch regelmäßige Interaktionen über einen längeren Zeitraum gekennzeichnet, bei denen Schülerinnen und Schüler auf Basis von Vorerfahrungen bestimmte Erwartungen an die Verhaltensweisen des Gegenübers haben und eine gewisse Verpflichtung zwischen den beiden Personen besteht. So könnte im Fall einer Beziehung zwischen zwei Personen an den Austausch von Lernmaterialien die Erwartung geknüpft sein, dass die andere Person sowohl die Lernmaterialien mit ziemlicher Sicherheit auch bereitstellt als auch bei Bedarf eine Unterstützung bei der Erarbeitung der Lerninhalte anbietet. Beziehungen zwischen zwei Personen können wiederum Teil einer bzw. mehrerer klasseninterner Gruppen sein, die ein Geflecht an mehreren dyadischen Peerkontakten (Beziehungen, Interaktionen) zwischen Schülerinnen und Schülern darstellen. Ein Spezifikum der Gruppe ist, dass z. B. betrachtet werden kann, wie gut Schülerinnen und Schüler in einer Klasse vernetzt sind oder/und welche geteilten Wertevorstellungen innerhalb einer Gruppe vorherrschen. Dyaden als auch Gruppen sind wiederum gebündelt in einem fest strukturierten Klassenverband. Ein Spezifikum des Klassenverbandes ist, dass dieser im Gegensatz zu Dyaden und Gruppen nicht freiwillig gewählt werden kann.
Des Weiteren können Peerkontakte durch zwei Formen der Unterstützung gekennzeichnet sein: erstens affektiv und zweitens kognitiv-instrumentell (Zander et al., 2017). Affektive Unterstützung bezieht sich darauf, dass Schülerinnen und Schüler in schulischen, aber auch außerschulischen Belangen durch ihre Peers emotional unterstützt werden, z. B. bei Ärger über eine schlechte Note oder Streit mit den Eltern Zuspruch bekommen. Eine kognitiv-instrumentelle Unterstützung bezieht sich hingegen primär auf eine Unterstützung bei der Erarbeitung von Lerninhalten. Diese kann sich von einem reinen Austausch an Lernmaterialien bis hin zum Erarbeiten von gemeinsamen schulischen Projekten erstrecken. Auf Dyadenebene ist eine zentrale Beziehungsform, die sowohl affektive als auch kognitiv-instrumentelle Unterstützung leisten kann, die Freundschaft. Eine Freundschaft wird als freiwillige Beziehung zwischen zwei Personen definiert, die auf Wechselseitigkeit beruht (Hartup, 1989). Freundschaften können wiederum eingebettet sein in Gruppenbeziehungen innerhalb der Klasse, wie Cliquen. Cliquen bestehen aus Beziehungen zwischen typischerweise ca. drei bis zehn Personen (nicht notwendigerweise Freundschaften), innerhalb derer die Jugendlichen in regelmäßigen Abständen interagieren (Brown, 1990; Ennett & Bauman, 1994; Kindermann, 2007; Ryan, 2001). Peerkontakte, die sich primär auf eine kognitiv-instrumentelle Unterstützung beziehen, sind auf Dyadenebene Lerntandems und auf Gruppenebene Lerngruppen. Oftmals sind hierbei die Peerkontakte von außen durch die Lehrkraft vorstrukturiert und werden – im Gegensatz zu einer Freundschaft oder Clique – nicht zwingend freiwillig gewählt.
Abb. 3.1: Zentrale Peerkontakte, Mechanismen des Einflusses und Outcomes, eigene Darstellung
Im Folgenden werden die in Abb. 3.1 dargestellten Mechanismen, über die Peers im Jugendalter aufeinander Einfluss nehmen, im Einzelnen dargestellt.