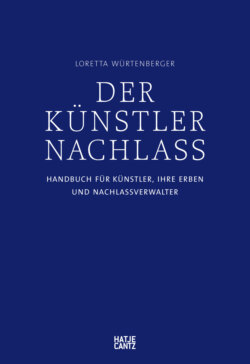Читать книгу Der Künstlernachlass - Группа авторов - Страница 12
1. Der Künstlernachlass im rechtlichen Sinne
ОглавлениеDie Frage, was ein Künstlernachlass ist, beantwortet zunächst einmal das Gesetz. Generell wird der Künstlernachlass der allgemeinen Definition eines Nachlasses zugewiesen, unter dem man das vom Erblasser – ob nun Künstler oder nicht – hinterlassene Vermögen samt Schulden versteht. Das heißt, es handelt sich um die Summe aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer natürlichen Person, die durch deren Tod nicht erlöschen, sondern auf die Erben oder Vermächtnisnehmer übertragen werden können. Im Verhältnis zum Erben bezeichnet man den Nachlass als Erbschaft.3 Damit gehören rechtlich gesehen alle Hinterlassenschaften des Künstlers dazu: das Auto in der Garage und die Pfannen in der Küche genauso wie die Leinwand im Atelier. Der Gesetzgeber unterscheidet bei der Vermögensnachfolge nicht zwischen Kunst und anderen Sachwerten eines Nachlasses und ebenso wenig zwischen dem Nachlass eines Künstlers und einer sonstigen Person. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Für ihn ist nur die durch den Tod eines Menschen erforderlich gewordene Neuordnung von Vermögenswerten samt zugehöriger Rechte und Pflichten relevant.
In Bezug auf die rechtliche Bestimmung des Begriffs Künstlernachlass ist es zudem wichtig, zwischen den angelsächsischen und den kontinentaleuropäischen Rechtsräumen zu unterscheiden. In der westlichen Welt dominieren diese zwei Rechtssysteme, die die Zuordnung des Vermögens im Todesfall bestimmen und entsprechend auch das zumindest teilweise unterschiedliche Verständnis des Begriffs Nachlass erklären. Zu unterscheiden sind das im angelsächsischen Raum verankerte, selbstständige Nachlassvermögen (Estate) (z. B. Großbritannien und USA) und das in Kontinentaleuropa vorherrschende System der Gesamtrechtsnachfolge (z. B. Deutschland und Frankreich). Je nach Rechtskreis des Erblassers erfolgt die Übertragung des Vermögens auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Im angloamerikanischen Common Law steht der Nachlass als solcher im Zentrum der Erbschaft und nicht der Erbe oder die Erbengemeinschaft. Erben haften demgemäß niemals selbst für die Verbindlichkeiten oder Steuerschulden, sondern nur der Nachlass im engeren Sinne, im Englischen Estate genannt. Juristen im angelsächsischen Raum sprechen im Zusammenhang mit den Begünstigten eines Nachlasses daher auch nicht von Heirs (Erben), sondern von Beneficiaries. Der Estate muss im angelsächsischen Rechtsraum zunächst von einer dafür eingesetzten Person (Personal Representative oder Executor), die gleichzeitig auch Begünstigter sein kann, abgewickelt werden.4 Erst am Ende dieser Abwicklung steht die Eigentumsübertragung an den Beneficiary, der eine natürliche Person oder, im Fall von Künstlernachlässen oft entweder ausschließlich oder zusätzlich, eine Stiftung sein kann.5 Die Hinterbliebenen sind in dieser Interimszeit der Abwicklung des Estates, der sogenannten Period of Administration, in ihren Verfügungsmöglichkeiten stark eingeschränkt, wenn auch Interimsdistributionen und Legate denkbar sind.
Bei der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge des kontinentaleuropäischen Rechtsraums (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien etc.) geht hingegen bereits mit dem Tod das Vermögen als Ganzes auf einen oder mehrere Erben über, wobei mehrere Erben als Erbengemeinschaft an die Stelle des Erblassers treten beziehungsweise der einzige Erbe als Alleinerbe. Die Nachfolge betrifft das Aktivvermögen und die Schulden. Ein einzelner Gegenstand kann durch ein Vermächtnis einem Erben zugewiesen werden, jedoch rechtstechnisch nicht vererbt werden. Alleineigentum an einzelnen Nachlassgegenständen erlangt der Miterbe nur durch einen gesonderten Auseinandersetzungsvertrag. War die künstlerische Tätigkeit in einer unternehmerischen Form organisiert, so besteht in einigen Ländern auch die Möglichkeit zur steuerschonenden Betriebsfortführung, auf die später noch eingegangen wird.
Praktisch bedeuteten die rechtlichen Unterschiede des Nachlasses in den beiden Rechtskreisen beispielsweise für die Erben Sigmar Polkes ein sofortiges gemeinsames Verfügungsrecht über dessen hinterlassene Werke, verbunden mit den personen- und erbteilsbezogenen (Steuer-)Pflichten, wohingegen in der Folge des Todes von Willem de Kooning die bestellten Executors (Rechtsanwalt John Eastman und Tochter Lisa de Kooning) zunächst die steuerlichen Fragen im Namen des Nachlasses mit der amerikanischen Steuerbehörde IRS klären mussten und auch der Estate als solcher die Steuern beglich, bevor Lisa de Kooning und die Willem de Kooning Foundation Eigentum an den ihnen jeweils zugedachten Werken erlangten. Im Falle von Donald Judd dauerte es vier Jahre, bis die Nachlassangelegenheiten geklärt waren und Vermögensgegenstände in das Eigentum der nach seinem Willen gegründeten Judd Foundation übergehen konnten.
Nach der rechtlichen Systematik beider Rechtsräume ist der Begriff Nachlass zudem einer zeitlichen Befristung unterworfen. Der Estate im engeren Sinne des angelsächsischen Common Law hört regelmäßig auf zu existieren, wenn die Vermögenswerte auf die Begünstigten übertragen worden sind. Nach der Abwicklung des Nachlasses sind die Begünstigten nur noch historisch begünstigt, da sie mit Übertragung die die Begünstigung ersetzende, stärkere Rechtsposition des Eigentums erlangt haben. Daher sind zum Beispiel die Robert Rauschenberg Foundation oder die Judd Foundation rechtlich gesehen auch keine Künstlernachlässe. Man spricht hier vielmehr von einer Artist-endowed Foundation. Im kontinentaleuropäischen System erfolgt die Übertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in der juristischen Sekunde des Todes des Erblassers. Damit wird hier spätestens mit Verstreichen der Frist zur Ausschlagung der Erbschaft die Bezeichnung Nachlass rechtlich obsolet. Dem folgend ist also streng genommen auch jeder, der eine künstlerische Hinterlassenschaft sein Eigen nennt, nicht mehr Verwalter eines Nachlasses, sondern vielmehr seiner eigenen, durch einen Nachlass ererbten Rechtsverhältnisse. Doch welches Künstlerkind möchte von sich schon sagen, es verwalte die von seiner Mutter »geerbten Sachwerte« – auch wenn dies im Kern die zutreffende Aussage wäre?