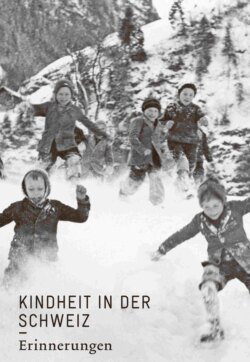Читать книгу Kindheit in der Schweiz. Erinnerungen - Группа авторов - Страница 18
1910er-Jahre, Val d’Anniviers VS Adeline Favre, *1908
Оглавление—
Während der ersten Lebensjahre hatte ich das sogenannte «grosse Weh», die Fallsucht, wobei es sich sehr wahrscheinlich um Epilepsie handelte. Zu jener Zeit hiess die Krankheit bei uns groumal. Im Herbst ging man von Saint-Luc aus zur Kapelle des Thel in Guttet-Bratsch, oberhalb Leuk, wo man die heilige Jungfrau gegen dieses grand mal anrief. Ich erinnere mich, dass mich im Alter von fünf Jahren die ganze Familie begleitete: Papa, Mama, Grossmama … Sie trugen mich abwechselnd. Man wollte mich durch Gebete heilen und nicht zu einem Arzt schicken. Bei uns war jedermann gläubig, und man hatte ein absolutes Vertrauen ins Gebet. Ich weiss nicht, bis zu welchem Alter ich unter dieser Krankheit gelitten habe. Ich spürte es jeweils, wenn ein Anfall kam, und sagte in unserem Dialekt: Yo tito, yo tito … je balance, je balance: «Ich schwanke, ich schwanke.» Und wenn mich niemand hielt, fiel ich zu Boden. Ich habe noch heute einige Narben davon.
Mein Leben als Kind war wie das aller Menschen im Val d’Anniviers: ein Leben unterwegs. Das Jahr unterteilte sich nach dem Verlauf der Feldarbeiten. Weil die Anniviards sowohl Reben in Sierre als auch Kühe auf den Alpen oben hatten, wechselten sie ständig von Ort zu Ort. Gewöhnlich wohnten wir in Saint-Luc. Unser Haus dort war recht geräumig und bequem. Das war sozusagen unser Hauptwohnort. Wenn man in den Reben arbeitete, wohnten wir in Muraz bei Sierre. Mehrmals im Jahr fand der grosse Umzug statt, der jeweils nahezu eine Woche dauerte. Das war ein grosses Durcheinander! Es zog nämlich das ganze Dorf gleichzeitig um: alle Familien, der Pfarrer, der Lehrer, das Vieh und die Kinder. Auf den Wagen packte man die Lebensmittel, die Haustiere, einen Teil der Kleider, und bei der Rückkehr nach Saint-Luc lud man auch noch die Kiste mit dem Schwein, das man am Katharinen-Markt in Sierre gekauft hatte, den Kaffee, den Zucker und das Mehl mit auf. Geschirr, Küchenutensilien und Bettwäsche besass man in doppelter Ausführung, sowohl im Haus in Saint-Luc wie in Muraz.
Die Schule in Sierre begann an Allerheiligen, Anfang November. Die Zeit von da an bis zum Katharinentag (25. November) waren die einzigen Tage im Jahr, wo sich wirklich alle zusammen im Tal unten trafen. Nach dem Katharinen-Markt fuhr man wieder nach Saint-Luc hinauf und blieb dort bis zum Februar. An der Fastnacht zog das ganze Dorf mitsamt der Schule wieder hinunter nach Sierre, wo die Rebarbeiten begannen. Man blieb während der Fastenzeit und bis nach Ostern unten. Im April musste man wegen des Korns, der Kartoffeln und der anderen Feldarbeiten wieder nach Saint-Luc hinauf, wo man den Sommer über bis zur Weinlese blieb. Zwischendurch stieg Papa hie und da für ein bis zwei Tage hinunter, um die Reben zu spritzen oder andere kleine Arbeiten zu verrichten. Wenn er zurückkam, fragten wir ihn oft: Papa quouè v’aï porta? – Plhèing lo chac dè lagné … Papa, qu’est-ce que vous avez apporté de Sierre? – Plein un sac de fatigue: Papa, was haben Sie aus Sierre mitgebracht? – Einen Sack voll Müdigkeit.
Die Schule begann also in Sierre an Allerheiligen und hörte in Saint-Luc im Mai auf. Man ging sechs Monate im Jahr zur Schule. Ich besuchte sie, bis ich vierzehn war. Weil mich Mama im Haushalt brauchte, liess sie sich vom Arzt ein Zeugnis ausstellen, damit ich die Schule verlassen konnte. Ich war übrigens damals schon so gross und körperlich schon so weit entwickelt, dass Mama fand, ich passe nicht mehr in meine Klasse. Zu Hause war ich überall zu gebrauchen, auf dem Feld, im Stall und beim Führen des Maulesels. Damals buk man zweimal im Jahr Brot, im Dezember und im Frühsommer, kurz vor dem Alpaufzug, denn das Brot war auch für die Sennen bestimmt. Der Dorfbackofen wurde während eines ganzen Monats nie kalt. Jede Familie musste ihr Holzkontingent abliefern. Man machte der Reihe nach Hunderte und Aberhunderte von Broten, die man das Jahr über im Speicher aufbewahrte.
Anfang Dezember wurde in Saint-Luc geschlachtet, und zwar Schweine und Kühe. Am Katharinen-Markt kaufte man jeweils kleine Ferkel, die man catsonèt nannte. Sie wurden nicht zusammen mit den älteren Schweinen des Vorjahres gehalten, sondern für sich allein in einem kleinen Holzverschlag, cramoite genannt. Manchmal hielten zwei Haushalte zusammen eine Kuh, und man gab ihr das beste Futter, damit sie am Schlachttag recht schwer war.
Man schlachtete im Ziegenpferch. Jedermann nahm daran teil, aber es waren immer die gleichen Männer, welche die Tiere töteten. Sie spalteten mit einer Axt den Schädel der Kuh zwischen den Hörnern. Die Fleischseiten hängten sie mit einem Flaschenzug an einem Galgen auf. Man hatte Wasser gekocht, um die Kutteln und die Därme zu reinigen, und man stellte Schweinsblutwürste her. Ich träume noch heute davon … Man fügte Reis, Rahm, Lauch und Zwiebeln bei.
Wenn wir, meine Brüder, meine Schwestern und ich, am Sonntag von der Messe kamen, war Papa in der Küche daran, Blutwürste und Fleischsuppe zu kochen. Jedes bekam davon. Das waren Leckerbissen.
Das Fleisch legte man in Saint-Luc in Salz. Dann trocknete man es im Speicher und ass noch im August davon. Man musste es allerdings lange kauen, weil es so hart war … Hie und da hatte das Fleisch auch zèchè, Fleischmilben, die man dann in den Fettaugen der Suppe entdeckte. Jedermann kannte das. Das Einsalzen dauerte übrigens acht Tage.
In meiner Kindheit haben wie nie Fleisch gekauft. Es ist uns nie ausgegangen, obschon wir täglich, ausser Freitag, davon assen.
Das Brot hielten wir sehr in Ehren. Man segnete es, bevor man es anschnitt. Brot durfte man nie mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen.
Unsere Familie besass eine oder zwei Kühe, deren Milch wir an die Hotels verkauften. Wir mussten die èhöèintsè, wie man sie nannte, oft hüten. Das war allerdings vor allem die Aufgabe von Hubert, der auf der Alp den Käse herstellte. Ich wurde dazu bestimmt, mit Papa auf dem Feld zu arbeiten. Ich war robust und arbeitete in den Reben, mähte die Wiesen, führte das Maultier – Papa war stolz auf mich.
Mit dem Grösserwerden übernahm ich mehr und mehr schwere Arbeiten, Männerarbeiten. Von klein auf mussten wir in den Äckern die Erde hinauftragen. Im Val d’Anniviers sind die bebauten Landstücke so steil, dass man regelmässig die Erde vom unteren Ende des Ackers an den oberen Rand hinauftragen musste. Die Kinder trugen so viel sie konnten, eine, zwei, drei Schaufeln voll. Wir waren immer stolz, wenn wir möglichst viel tragen konnten, auch wenn uns oben vor Anstrengung die Zunge heraushing. Papa war sehr lieb, er jagte oder drängte uns nie. Wie man im Dialekt sagt: Fé gotta, gotta, fé la motta … goutte à goutte on fait la tomme: – Steter Tropfen höhlt den Stein.