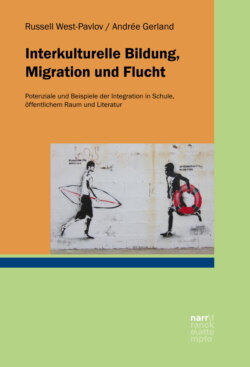Читать книгу Interkulturelle Bildung, Migration und Flucht - Группа авторов - Страница 24
Der öffentliche Raum
ОглавлениеAuf den ersten Blick ist der öffentliche Raum eine simple Sache: es gehören alle Verkehrs- und Grünflächen dazu, in der Regel auch die Gewässer im Besitz einer Gemeinde oder Körperschaft des öffentlichen Rechts, die von dieser bewirtschaftet werden und für alle Menschen frei zugänglich sind. An dieser Stelle hört die simple Sache auf, denn ein „öffentlicher Raum, als jederzeit für jedermann, ohne jede Einschränkung zugänglicher Raum, hat niemals in irgendeiner Stadt existiert“ (Siebel 2016: 77). In der Tat ist die Liste der Orte lang, die auf dem ersten Blick als frei zugänglich erscheinen, es letztlich aber nicht sind. Genannt seien beispielsweise Bahnhöfe oder Einkaufszentren, die vollständig in privater Hand sind, auch wenn sie sich als öffentlicher Raum inszenieren (Kuhn 2016: 220). Dazu kommen diverse Gated Communities, abgeschirmte Hofquartiere (ebd.: 221) und nicht zuletzt die „Angsträume“; z. B. sind „Parkanlagen, in denen Frauen fürchten müssen, vergewaltigt zu werden … keine öffentlichen Räume“ (Siebel 2016: 79). Schließlich und endlich existiert der öffentliche Raum in allen Kulturen der Welt und unterliegt gleichzeitig Regeln, wobei diese je nach Epoche, Kulturraum oder Regime unterschiedlich ausfallen können. Der amerikanische Kulturanthropologe Edward T. Hall (1966) beschreibt sie anekdoten- und detailreich in umfangreichen vergleichenden Studien zu diversen Kulturen. Unterschiedliche Elemente wie die Gestaltung des öffentlichen Raums, die Kommunikations- und Bewegungsformen in ihm, die Grenzen der Intimität, die sinnliche Wahrnehmung der Umwelt durch die Akteure, das Verhältnis der Geschlechter, der Generationen und Klassen zueinander u. v. m. spielen dabei wichtige Rollen. Die genannten Studien mögen in Zeiten der Globalisierung zum Teil obsolet erscheinen, nichtsdestotrotz kann jeder Tourist noch heute ohne große Anstrengungen und ohne wissenschaftlichen Blick die bedeutenden Differenzen zwischen einem Markt in Nordafrika und einem in Deutschland wahrnehmen und damit die Ergebnisse der vergleichenden Studien von Hall aus der subjektiven Erfahrung heraus bestätigen. Das ist eine wichtige Feststellung angesichts der zunehmenden kulturellen Vielfalt im öffentlichen Raum im Zuge von größeren Migrationsbewegungen und daraus entstehenden Unsicherheiten. Jeder Mensch bewegt und benimmt sich im öffentlichen Raum zunächst entsprechend seiner Sozialisation. Hierbei existieren zwischen unterschiedlichen Kulturen reale Differenzen. Wenn nun unterschiedliche Kulturen im öffentlichen Raum aufeinandertreffen, treffen zwangsläufig auch diese Differenzen aufeinander. Viele dieser Differenzen mögen Konstruktionen sein, sie werden trotzdem gelebt, „zweifellos spielt Ethnizität heutzutage eine Rolle – Menschen identifizieren sich als Russen, Polen oder Türken und werden als solche gesehen; sie glauben, ihre ethnischen Zugehörigkeiten transportieren bestimmte Eigenschaften, oder sie bekommen diese Eigenschaften von außen zugeschrieben“ (Terkessidis 2010: 118 f.).
Zum öffentlichen Raum in Deutschland gibt es eine umfangreiche Literatur. Hier wird deutlich, dass der Umgang mit dem öffentlichen Raum, seine Gestaltung und Nutzung weder einheitlich noch zufällig oder neutral sind (vgl. Bernhard 2016). Alles was im öffentlichen Raum wahrgenommen wird oder im Verborgenen wirkt, ist Ergebnis „lange(r) Auseinandersetzungen, die auch mit den Mitteln des architektonischen Designs, also mit Symbolen geführt werden. Dabei geht es um sehr viel. Wer das Bild eines Raumes und die Regeln, die darin gelten, bestimmt, der entscheidet auch darüber, wer zu diesem Raum zugelassen wird.“ (Siebel 2016: 72) Weil aber der öffentliche Raum per se permanent und für alle zugänglich bleiben sollte, werden Segregationskriterien entwickelt, die die Homogenität indirekt gewährleisten sollen. So gilt die Grundregel, dass niemand belästigt werden darf und es „sollen Ekel oder anstoßerregende Merkmale und Verhaltensweisen aus dem öffentlichen Raum herausgehalten werden. Es handelt sich um ein Prinzip mit hohem Diskriminierungspotential, denn Menschen können auf zwei Weisen gegen es verstoßen: erstens wenn sie unter bestimmten Stigmata leiden … wie körperliche Behinderung und Hautfarbe, oder als Träger sozialer Merkmale, auf die sie keinen Einfluss haben“ (ebd.: 73 f.). Damit wird Exklusivität geschaffen und das Wesensmerkmal des öffentlichen Raums, nämlich die freie Zugänglichkeit, teilweise aufgehoben. Gleichzeitig wäre in globalisierten Zeiten die totale Kontrolle des öffentlichen Raums in einer liberalen und marktorientierten Gesellschaft kontraproduktiv für eben diese, und so kommt es dort trotz symbolischer oder konkreter Inklusionssperren doch zur kulturellen Vielfalt mit den zwangläufig dazu gehörenden Nutzungskonflikten (vgl. Kuhn et al. 2012: 203).