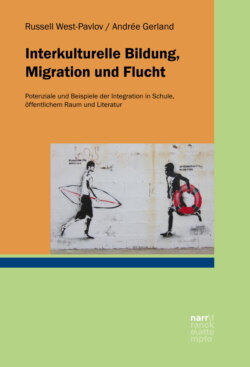Читать книгу Interkulturelle Bildung, Migration und Flucht - Группа авторов - Страница 27
Dimensionen kultureller Begegnungen im öffentlichen Raum
ОглавлениеAlles was im öffentlichen Raum stattfindet, geschieht in einem gesellschaftlichen Kontext, der für alle Akteure gleich ist. Das bedeutet nicht, dass auch die soziale Wirklichkeit der Akteure gleich ist. Dennoch stehen alle unter dem Einfluss der Funktionssysteme, die für die Integration der Gesellschaft sorgen. So steht das politische System für kollektiv bindende Entscheidungen, das Rechtssystem für die rechtsförmige Bearbeitung von Konflikten, das Wirtschaftssystem für die Minderung von Knappheit usw. (vgl. Krause 2001: 132).
Die Funktionssysteme produzieren die Bedingungen, unter denen der öffentliche Raum organisiert und verwaltet wird. Die Zuständigkeit für Gestaltung, Regeln, Kontrolle und Atmosphäre des öffentlichen Raums wird an die Gemeinden bzw. die Körperschaften des öffentlichen Rechts delegiert. Aber „der städtischer Raum ist keine vorgegebene Wirklichkeit, sondern ein gelebter Ort, der für die Menschen in dem Maße bedeutsam wird, als sie mit dem Raum und einzelnen seiner Elemente bestimmte Bedeutungen verbinden. Je unterschiedlicher die Lebensweisen, desto unterschiedlichere Bedeutungen kann ein und derselbe Raum der Stadt annehmen“ (Siebel 2016: 22), und „die Straßen und Plätze der Städte [haben] eine eminent politische Funktion als Räume, in denen symbolische Kämpfe um soziale Anerkennung und um politische Macht ausgetragen werden“ (ebd.: 88).
Im öffentlichen Raum selbst treffen sich aus unterschiedlichen Gründen die Akteure mit ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen, ihren diversen kulturellen Hintergründen, spezifischen Erfahrungen, Ressourcen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen, Wünschen und Nöten, kurzum mit allem, was die menschliche Existenz ausmacht. Der öffentliche Raum ist „durch seine allgemeine Zugänglichkeit oft der einzige Ort der Begegnung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, die sonst kaum gemeinsame Handlungszusammenhänge haben. Man muss sich einigen, wer rechts und wer links vorbei geht und welche Regeln einzuhalten sind oder nicht, kurz: in Interaktion treten. Begegnungen heißt nicht nur Verständnis und Akzeptanz, sondern vor allem auch Aushandeln, Abgrenzung und Konflikt“ (Keding 2009: 13). Dabei darf der Konflikt keinesfalls nur als Problem betrachtet werden, er ist vielmehr unabdingbar, denn „Gesellschaften integrieren sich nicht über Harmoniebekundungen und hehre Ziele, sondern über Konflikte. Ohne Konflikte keine soziale Integration. Je mehr Konflikte desto besser – vorausgesetzt sie durchkreuzen sich gegenseitig; dadurch werden aus Streithähnen in einem Konflikt Verbündete im Anderen“ (Hondrich 2004: 90).
Konflikte im öffentlichen Raum entstehen häufig in Zusammenhang mit Raumaneignungsprozessen durch einzelne Individuen, Gruppen, Geschäfte oder Organisationen. Weil der öffentliche Raum aber grundsätzlich allen Menschen frei zugänglich sein sollte, werden Bestrebungen zur „Territorialisierung“ immer wieder zu Quellen von Konflikten. Die Raumaneignung kann sehr unterschiedliche Formen annehmen: körperliche durch Mobilität oder Verweilen, symbolische durch das Anbringen von Werbeplakaten, das Zurücklassen von Müll, durch Zigarettenrauch oder Essensgeruch, akustische durch entsprechende Kommunikation oder Musik und schließlich auch über strukturgebende Elemente wie Wegeführung und Bodenbeläge (vgl. Keding 2009: 26). Natürlich haben die Konflikte auch mit der Pluralität der Werteorientierungen der Akteure bzw. der gesellschaftlichen Gruppen im öffentlichen Raum und mit den dort herrschenden Machtverhältnissen zu tun. Abweichende Verhaltensweisen sind in einer durch Pluralität und Vielfalt gekennzeichneten Gesellschaft unvermeidlich und generieren selbstverständlich Konflikte zwischen den beteiligten Akteuren Individuum, Gruppe, Organisation oder der den Staat vertretenden Instanzen. Die entscheidende Frage ist dann nicht mehr, wie Konflikte vermieden werden, sondern vor allem wie mit ihnen umgegangen wird. Konflikte im öffentlichen Raum können auf unterschiedliche Weisen gelöst werden. Lösungsansätze, die auf Partizipation und Dialog beruhen, haben sich bisher als die erfolgreichsten erwiesen, „das Austarieren unterschiedlicher Auffassungen und Anforderungen an den öffentlichen Raum ist dabei zentrale Aufgabe. Auf dem Weg des Ausgleichs divergierender Interessen müssen alle Beteiligten – Anwohner, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, die öffentliche Hand – eingebunden werden. Ziel ist dabei, dass alle beteiligten Akteure gemeinsame Strategien entwickeln“ (Kuhn 2016: 233 f.).