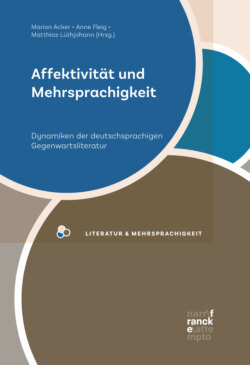Читать книгу Affektivität und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 15
„Der geheime Text“ – Terézia Mora im Gespräch mit Anne Fleig
ОглавлениеIn ihrer Poetik-Vorlesung Der geheime Text (2016) reflektiert die zweisprachig aufgewachsene Autorin Terézia Mora ihren Weg von einer Sprache in die andere.1 Dieser Weg bildet nicht nur die Grundlage ihrer Autorschaft, sondern hat auch sichtbare und unsichtbare Spuren in ihren Texten hinterlassen. Anhand dieser Spuren verfolgt Der geheime Text verschiedene Formen und Funktionen der literarischen Mehrsprachigkeit, die Verfahren der Intertextualität und der Übersetzung einschließen. Das gegenwärtige Interesse der Literaturwissenschaften am Thema der Mehrsprachigkeit hat die Autorin in ihrer an der Universität Salzburg gehaltenen Vorlesung explizit begrüßt, da es die Möglichkeit biete, mit anderen Sprachen auch andere Geschichten in den hegemonialen Diskurs einzuspeisen und unbekannte Sätze ‚weiterzuverteilen‘.2
In Moras Roman Das Ungeheuer (2013) ist es Flora, die in ihren tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, ihrem ‚geheimen Text‘, die Sprache wechselt und Sätze weiterverteilt. Dabei wird deutlich, inwiefern verschiedene Sprachen Erinnerungen und Gefühle, aber auch literarische Formen prägen. Dass ‚teilen‘ immer auch ‚trennen‘ bedeutet, wird im Text durch den horizontalen Strich kenntlich, der jede Seite durchzieht. Er markiert die sichtbaren und unsichtbaren Spuren von Mehrsprachigkeit, die nicht nur Darius Kopp als Leser von Floras Dateien, sondern auch die Leser und Leserinnen von Moras Roman vor erhebliche Herausforderungen stellen.
Zur Eröffnung der Tagung haben wir diskutiert, welche Rolle der Sprachwechsel für das Schreiben von Terézia Mora spielt, worin der ‚geheime Text‘ besteht und wer oder was das ‚Ungeheuer‘ ist? Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus dem Gespräch, das am 2. November 2017 an der Freien Universität Berlin stattfand.
Anne Fleig: In ihrer Salzburger Poetik-Vorlesung sagen Sie: Schreiben beginnt mit der Beobachtung der Sprache. Ich denke, diese Beobachtung setzt einen bestimmten Abstand voraus. Wie hängt dieser Abstand mit Ihrer Zweisprachigkeit zusammen? Inwiefern entsteht daraus der ‚geheime Text‘?
Terézia Mora: Ich mache das nicht rituell: Ich bin Autorin und jetzt beobachte ich mal meine Sprache. Es ist vielmehr immer schon mein Hobby gewesen, auch, als ich noch keine Schriftstellerin war. Insofern entwickeln Sie dann eine gewisse Routine, bevor Sie anfangen zu schreiben.
Welche Rolle spielt die Zweisprachigkeit beim Schreiben?
Die Anwesenheit einer zweiten Sprache war insbesondere bei meinem ersten Buch Seltsame Materie (1999) für mich sehr spürbar. Das sind Erzählungen in einem einsprachig deutschsprachigen Buch, die ihren Ursprung aber in Ungarn haben, sie nähren sich aus Material, das ich aus Ungarn mitgebracht habe, und entweder deswegen, oder weil es mein erstes Buch war, haben sich beim Schreiben immer ungarische Wörter aufgedrängt. Und da musste ich zum Beispiel wahnsinnig aufmerksam sein, was ich da mache und das ist mir auch nicht überall gelungen, muss ich sagen. Manchmal habe ich auch danebengegriffen. Ich musste mich für ein deutsches Wort entscheiden und heute würde ich mich für ein anderes entscheiden. Aber beim zweiten Buch war das bereits, wie ich finde, überwunden, da konnte ich schon mehr so machen, wie ich es wollte.
Aber das ist eher eine Frage der Erfahrung als Autorin – oder würden Sie sagen, das ist eine Frage des Sprachwechsels oder der zwei Sprachen?
Ich würde durchaus sagen, das hat etwas mit der Erfahrung als Autorin zu tun. Bevor ich mein erstes Buch schrieb, habe ich schon ein wenig deutsche Literatur auf Deutsch gelesen, aber mitgebracht hatte ich hauptsächlich Literatur, die entweder Ungarisch im Original oder ins Ungarische übersetzt war. Ich kann mich deutlich an Momente des Sprachwechsels erinnern. Ganz einfaches Beispiel: Den „Panther“ von RilkeRilke, Rainer Maria habe ich zuerst auf Ungarisch übersetzt gelesen, und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich das Original kennengelernt und das Interessanteste war, dass das Original jede Übersetzung, so schön sie auch war, sofort weggefegt hat. Und seitdem weiß ich nicht mehr, wie es auf Ungarisch war, ich weiß nur noch das Original.
Zwischen meinem ersten und dem zweiten Buch habe ich bewusst vieles, was ich vorher in der Übersetzung kannte, im deutschen Original nachgelesen oder ich habe deutsche Übersetzungen von durch mich hoch geschätzter internationaler Literatur, z.B. den Ulysses gelesen, um zu wissen, wie sich Literatur auf Deutsch überhaupt liest. Offenbar war ich der Meinung, dass das notwendig war, bevor ich selbst weiter deutschsprachige Literatur schrieb. In Wahrheit ist das natürlich überhaupt nicht notwendig. Aber ich fühlte mich so besser vorbereitet.
Ich fand Ihre Formulierung mit dem Sehen, dass Sie gesagt haben, „man beobachtet die Sprache“, auch deswegen interessant, weil Sehen dabei auf spezifische Weise eine Rolle spielt. Es gibt von Herta Müller Müller, Herta eine berühmte Formulierung, dass in jeder Sprache andere Augen sitzen. Und ich dachte …
Interessant, dass es Augen sind und nicht Ohren, ja.
Genau darauf zielt meine Frage.
Das ist spontan jetzt schwierig – „andere Augen“ … nicht unbedingt, ich würde eher auf die Ohren gehen …
Herta MüllerMüller, Herta hat damit ja zum Ausdruck bringen wollen, dass man durch jede Sprache seine Umwelt mit anderen Augen wahrnimmt.
Und vom Sehen ist sie zurückgegangen auf Augen und schon haben wir ein außergewöhnliches Bild. Das ist etwas, was Zweisprachige häufig machen! Du untersuchst das einzelne Verb, gehst dann zurück auf das Hauptwort, vergleichst es wieder mit anderen Sprachen und dann sagst du, ah interessant.
Aber ich bin tatsächlich bei Ihnen auf das Hören gekommen, denn Sie bringen immer wieder Lyrik als Beispiel. Auch jetzt in dieser Situation haben Sie als Beispiel Rilke Rilke, Rainer Maria s „Panther“ gewählt. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass Sie immer wieder auf Lyrik zu sprechen kommen?
Es ist so, wenn man in Ungarn zur Schule gegangen ist, zumindest bis zum Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, denn nur darüber kann ich mich verbindlich äußern, hat man gelernt, dass die Lyrik alles ist. Man lernt wahnsinnig viele Gedichte von ‚unseren Dichtern‘ in ungarischen Schulen, das ist ganz wichtig. Und sie werden tatsächlich damit sozialisiert, weniger mit Prosa. Die Prosa, die wir zu meiner Zeit in der Schule lesen mussten, war unglaublich öde. Historische Romane. Und nicht aus literarischen, sondern aus historischen Gründen. Solange ich in die Schule ging, haben wir es nicht bis zur Gegenwartsliteratur geschafft, also zu den spannenden Sachen. Dabei ist in den siebziger Jahren mit der ungarischen Prosa etwas Phänomenales passiert. Man nennt das auch das Péter-Paradigma, weil recht viele Autoren Péter mit Vornamen hießen: Péter EsterházyEsterházy, Péter, Péter NádasNádas, Péter, Péter LengyelLengyel, Péter, Péter HajnóczyHajnóczy, Péter. Die ganzen Péters, und noch andere, die nicht Péter hießen, haben da was Tolles gemacht, was es bis dahin nicht gab. Ich musste mir es dann selber erlesen, in der Schule gab es dazu keinen Zugang. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich, wenn ich beim Schreiben auf eine Schicht zugreife, was ganz spontan passiert, ich meist bei den länger und tiefer verankerten Dingen lande, also bei der Lyrik. Die später verinnerlichte Prosa liegt darüber, auf einer neueren, einer bewussteren, weniger spontanen Ebene.
Ich hatte für mich die Lyrik mit dem Hören und dem Klang verbunden. Und da stellt sich natürlich die Frage: Inwiefern geht es Ihnen um diesen Klang, diese Materialität der Sprache?
Ich muss sagen, die Prosa, die ich mag, ist auch sehr rhythmisch. Einen EsterházyEsterházy, Péter-Satz können sie gar nicht monoton vor sich hinsagen, weil der ganze Satz sehr musikalisch ist.
Eine Frage, die uns sehr beschäftigt, und die auch mit Klang und Materialität zu tun hat, ist, inwiefern Sprache das Vermögen hat, Dinge oder Welt fremd zu machen? Das hat auch mit Affekten zu tun und Empfindung. Was heißt es für Sie, eine Sprache zu spüren?
Wichtig ist vor allem: welche Art von Literatur spricht mich an. Ich würde das tatsächlich als sinnliches Erlebnis beschreiben. Es ist so, dass ich auf Sachen, die ich gut oder schlecht finde, körperlich reagiere. Es kann buchstäblich passieren, dass man einen Text zum Kotzen findet. Das ist kein Zufall, uns allen geht das so.
Ich kann mich erinnern, wie ich einmal versucht habe, einen Text auf Ungarisch zu machen. Mein allererster literarischer Text war eine Erzählung mit dem Titel Durst, ich war 26 Jahre alt, und er war auf Deutsch. Wenn man mehrsprachig ist, taucht ja immer wieder die Frage nach diesem Moment auf, wo man sich entschieden hat, in einer der beiden Sprachen zu schreiben. Und abgesehen davon, dass ich in Deutschland lebte, und dass es widersinnig gewesen wäre, für einen deutschen Literaturwettbewerb auf Ungarisch zu schreiben, stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Material, wenn du anfängst auf Deutsch zu schreiben und hättest du es auch auf Ungarisch machen können? 15 Jahre später habe ich die Probe aufs Exempel gemacht und versucht, Durst auf Ungarisch zu schreiben, es wenigstens anzufangen. Wobei das natürlich keine gute experimentelle Situation war, denn 15 Jahre später ist man ja nicht mehr an demselben Punkt. Man kann also nicht mehr herausfinden, was wirklich passiert wäre, hätte man es damals auf Ungarisch geschrieben. Tatsache ist, dass es jetzt, später, überhaupt nicht ging. Schon beim zweiten Satz auf Ungarisch hatte ich das Gefühl, ganz unsicher zu sein, obwohl ich mittlerweile schon einige Erfahrungen als Autorin gesammelt hatte. Während ich damals, als blutige Anfängerin, mit dem Deutschen ein ganz anderes, ganz sicheres Gefühl hatte. Da dachte ich schon nach dem ersten Satz, „Großvater trinkt“, ja, das ist es, von hier aus sehe ich die ganze Erzählung vor mir. Während das Ungarische ebenso deutlich nirgendwo hinführte.
Wenn Sie jetzt am Schreibtisch sitzen oder wo immer Sie auch schreiben, klingt dann noch die ungarische Sprache im deutschen Schreiben mit?
Durchaus an manchen Stellen, also dort, wo das Deutsche sehr dünn wird.
Was heißt das?
Wo mein Deutsch dünn wird, kommt das Ungarische herein. Mitunter tut sich beim Schreiben eine Lücke im Satz auf, weil mir nur das ungarische Wort einfällt. Warum ist das eine Lücke? Weil an dieser Stelle das Deutsche fadenscheinig ist oder das Ungarische sehr stark ist. Warum ist es stark, kommt dann die Frage. Warum kommt an dieser Stelle das ungarische Wort herein? Überprüfe: Inwiefern unterscheidet es sich von dem nächstmöglichen deutschen Wort? Kannst du das dann nehmen, ja oder nein? Du musst natürlich ein deutsches Wort nehmen, aber welches nimmst du? Das Ungarische ist im Grunde genommen eine Störung, aber auch eine Hilfe, denn offensichtlich befindest du dich im Satz an einem Punkt, wo für dich eine Frage entsteht. Du kannst sie nicht spontan beantworten, du musst darüber nachdenken. Also mache ich das. Das Ungarische ist auch jedes Mal präsent, wenn es inhaltlich evoziert wird, wenn zum Beispiel die Figur Ungarin ist oder die Behauptung aufgestellt wird, sie würde auf Ungarisch scheiben.
Mein Roman Das Ungeheuer enthält beispielsweise zwei Texte: Einmal den Text eines trauernden Ehemannes, der Deutscher ist, und einmal die nachgelassenen Aufzeichnungen seiner verstorbenen ungarischen Ehefrau Flora, die diese Aufzeichnungen auf Ungarisch verfasst hat. Wir wissen nicht genau, weshalb, aber wir können es uns denken: Weil das ihre geheime Sprache ist. Für mich als Autorin stellte sich daraufhin die Frage: In welcher Sprache schreibst du jetzt Floras Texte? Es wird am Ende zwar ein deutschsprachiges Buch sein, aber es wäre schlau, die Texte zuerst auf Ungarisch zu schreiben. Das ist ein sehr spannender Moment, weil ich ein paar Monate vorher die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer noch nicht auf Ungarisch schreiben kann.
Das hat mich dann dazu veranlasst, einen halben Roman auf Ungarisch zu schreiben. Ich wusste, dass Das Ungeheuer schwierig werden würde, aber ich wollte, dass sich die beiden Texte radikal voneinander unterscheiden. Floras Text sollte tatsächlich etwas komplett anderes sein und dazu habe ich meine nicht mehr so gut beherrschte Muttersprache benutzt. Es kostete mich Blut, Schweiß und Tränen. Häufig fing ich an, auf Ungarisch zu schreiben, merkte jedoch: Das ist nicht Ungarisch, du übersetzt gerade! Ich habe das Schreiben in solchen Momenten dann immer radikal unterbrochen. Es war furchtbar! Schließlich habe ich mich aber mit Floras Text durchgequält und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Text weniger literarisch wurde oder besser gesagt, dass der Text privater und inoffizieller wirkt. Als ich damit fertig war, kam die nächste Herausforderung: Der Text sollte einsprachig deutsch sein und das heißt, dass der ungarische Text ins Deutsche gebracht werden musste, darauf achtend, dass ich ihn nicht verbessere. Das war ein wahnsinnig spannender Prozess. Das Ungeheuer ist das Buch, in dem ich das Ungarische ganz bewusst und ganz massiv eingesetzt habe, um einen speziellen deutschen Text zu erhalten.
Sie haben jetzt schon viel von Ihrem Verfahren erklärt, das auf Zweisprachigkeit beruht. Wie verhält sich das zur Frage des Originals, die wir vorhin am Beispiel Rilke Rilke, Rainer Maria diskutiert haben? Und inwiefern ist die Frage des Originals an Einsprachigkeit gebunden?
Ich schätze, für Sie als Germanistin ist die Frage wichtig, was das Original ist. Ich als Autorin kann sagen: Ich bestimme jetzt einfach mal, was das Original ist, nämlich das einsprachige Buch, das hier erschienen ist, und das Ungarische ist das, was als Hilfstext benötigt worden ist, um das Original zu erstellen. Die Frage wird dann nochmal kompliziert, wenn man bedenkt, dass es eine ungarische Übersetzung von diesem Buch gibt. Ich sagte dem ungarischen Verlag und der Übersetzerin, ich möchte, dass sie das deutsche Original nimmt und ins Ungarische übersetzt. Das heißt, es hätte dann sozusagen zwei ungarische Versionen gegeben. Das hat man aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Erstens sicherlich aus Geldgründen. Und zweitens wollte sich die Übersetzerin vermutlich nicht in die Lage bringen lassen, in der ihre ungarische Version mit meiner hätte verglichen werden können. Deswegen ist die ungarische Ausgabe jetzt so, dass oben die Version der Übersetzerin ist und unten meine ursprüngliche. Ich weiß nicht, wie das wirkt, ich schaue mir das nicht an. Obwohl ich die Gründe des Verlags und der Übersetzerin verstehe, bin ich mit dieser Lösung nicht sehr glücklich. In der ungarischen Ausgabe steht jetzt das Ungarisch zweier Personen.
Mich interessiert diese Frage auch, weil die ungarischen Dateien auf Ihrer Homepage zu lesen sind und wir den Flora-Text in „Das Ungeheuer“ in Dateien haben. Ihr Ehemann trauert um sie und setzt sich mit ihrem Nachlass, das heißt ihren Tagebuchdateien auf einem Laptop, auseinander. Und was heißt das für uns? Halten wir das Original in den Händen oder gehören dazu auch die Dateien auf der Homepage?
Ich habe die Form der Datei deswegen gewählt, weil es sehr fragmentarisch sein sollte. Und wenn es im Text heißt, das steht in der Datei so und so, dann unterbricht es erstens den Lesefluss noch einmal, und zweitens hat der Ehemann keine andere Möglichkeit als die Reihenfolge danach festzulegen, wann die Datei zuletzt geändert wurde. Deshalb ist das garantiert nicht die Reihenfolge, in der sie ursprünglich geschrieben worden sind. Außerdem gibt es eine ganz lange Datei, in der Flora Träume gesammelt hat, die über mehrere Jahre gehen. Das heißt, unter dem Strich ist die Chronologie ganz anders, weil natürlich auf einem Rechner einzelne Dateien ganz anders liegen, als wenn ein langer Text als eine Datei da liegt.
Wobei man da auch sagen muss, dass auch Darius Kopps Text bei mir in einer Datei steht und auch dort ist Seite 318 eventuell älter als Seite 1. Sie wissen ja nicht, wie das zeitlich entstanden ist, aber es präsentiert sich Ihnen als Einheit, während Floras Text, noch dazu durch die auf Ungarisch belassenen Überschriften, erstens immer wieder unterbrochen wird und zweitens nochmal unterbrochen wird, weil die Aufschrift unverständlich ist. Das ist ein ungarisches Wort und entweder Sie verstehen es oder auch nicht.
Ich glaube, theoretisch ist der ungarische Hilfstext schon Teil des Originals, in etwa so, wie die Apokryphen Teil der Bibel sind.
[Lesung aus Das Ungeheuer]
Wir haben vor der Veranstaltung darüber gesprochen, dass der Text zweigeteilt ist. Sie haben gleich gesagt, dass Sie den Darius lesen wollen, aber jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund der zwei Sprachen: Was trägt der Teil unter dem Strich?
Ich verweise hier noch einmal auf den Begriff Apokryphen. Das, was unter dem Strich steht, ist Floras Version, und zwar nur über ihr eigenes Leben. Vielleicht haben das auch schon einige von uns miterlebt. Der Partner hat ein Tagebuch und erwähnt einen darin nicht. Das kommt relativ häufig vor. So auch hier. In ihrem Tagebuch geht es ausschließlich um sie selbst, um ihre Vergangenheit, ihre Mutter, ihre Großmutter, ihr Leben noch vor Darius Kopp, als alleinstehende Ausländerin im Kulturbereich, und alles, was da passiert, ist relativ furchtbar. Wobei es ziemlich alltäglich ist. So leben wir. In einem Jammertal. Der eine reagiert so darauf, der andere so. Flora so, dass sie zunehmend depressiv wird. Sie versucht Sinnvolles zu tun, in diesem Fall, Übersetzungen zu machen, aber sie bringt nichts zu Ende und schließlich scheitert sie auch, was den Rest ihres Lebens und ihre Krankheit anbelangt. Es geht irgendwann fast nur noch um die Krankheit, die gegen Ende mit dem Verlust der Sprache einhergeht, sie redet immer, immer weniger, und je weniger Sprache da ist, umso weniger Leben ist da, bis am Ende alles zerfällt und nichts mehr da ist. Was unten passiert, ist also, dass jemand dem Tod entgegengeht, der Vernichtung, der Nicht-Existenz, und das sieht man daran – so zumindest meine Intention –, dass die Sprache immer gebrochener, zerbrochener wird. Und Darius oben sortiert sich immer mehr, seine Sprache ist nicht so schwankend, die ist relativ gleichbleibend, das passt eher zu seiner Figur. Er ist ganz anders gestrickt.
Ich fand es interessant beim Zuhören, dass das Stück, was Sie vorgelesen haben, mit dem Bild des Fadens endet. Der Lebensfaden verlangt einen konsistenten Text, das ist auch der Erzählfaden, und das ist das, was reißt oder was lange zu reißen droht und dann auch gerissen ist. Meine Frage zielt darauf, inwiefern die Vorstellung eines linearen Erzählens im Text unter dem Strich unterbrochen ist.
Natürlich.
Nicht nur das Dateiformat, worüber wir schon gesprochen haben, sondern auch weil es ganz unterschiedliche Texte sind.
Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, das so fragmentarisch zu machen, aber ich dachte mir: insbesondere bei so einem Text muss es eine minimale Entwicklung doch geben, es ist eh schon schwierig genug zu lesen. Deswegen gibt es auch in diesen Fragmenten, auch trotz der zeitlichen Intransparenz (siehe oben: wann ist welche Datei entstanden) einen nachvollziehbaren zeitlichen Ablauf. Am Anfang der Aufzeichnungen war Flora um die 20, am Ende, als sie gestorben ist, ist sie 30+. Das heißt, die Figur verändert sich ein bisschen und die Krankheit schreitet fort, und das gibt dann eine kleine Bewegung in den Texten, die ansonsten viel um sich selbst kreisen. Bei Lesungen lese ich deswegen immer nur Darius Kopp, weil es bei ihr schwierig ist, einen Bogen vorzulesen. Bei ihm passiert A und dann B und bei ihr passiert nicht wirklich was. Ein bisschen was passiert, aber es sind immer nur so punktuelle Sachen, die Bögen sind viel länger, man kann im Laufe einer Lesung nicht wirklich weiterkommen.
Ich habe mich gefragt, was eigentlich das Ungeheuer ist. Das Ungeheuer steht für die voranschreitende Depression der Protagonistin Flora. Aber könnte man auch sagen, dass der Strich das Ungeheuer ist? Dieser Strich, der anzeigt, dass Flora keinen Platz im Haupttext des Lebens hat?
Ich habe mehrere Vermutungen oder Gedanken dazu, was das Ungeheuer ist. Die möchte ich aber nicht sagen, denn das wäre ja blöd. (Publikum lacht.)
Die Interpretation mit dem Strich würden Sie aber nicht von sich weisen, oder?
Nein, das würde ich nicht von mir weisen. Hauptsächlich kommt das Ungeheuer aber aus einem Gedicht von Ágnes Nemes NagyNemes Nagy, Ágnes, einer großartigen, bereits verstorbenen ungarischen Dichterin. Das ist ein ganz gruseliges Gedicht, und natürlich ist das Ungeheuer zum einen die Krankheit, die Flora abtrennt von der Welt der Gesunden, aber auch ihr Status und ihr Nicht-Klarkommen. Durchaus ist das Ungeheuer etwas, das in Flora wohnt und das Flora umbringt. Aber ich weise auch in Zusammenhang mit der me too-Debatte darauf hin – Achtung, Spoiler! –, dass auch oben etwas ist, dass auch Darius Kopp vielleicht nicht ganz un-ungeheuerlich ist. Durchaus könnte auch er das Ungeheuer sein. Natürlich ist er das nicht von Anfang bis Ende und immer. Aber hauptsächlich ist das Ungeheuer, von dem hier die Rede ist, das von Ágnes Nemes NagyNemes Nagy, Ágnes, wovon bisher niemand etwas weiß, aber ich habe es Ihnen jetzt erzählt.
Ich habe mal die Wortbedeutung von ‚Ungeheuer‘ nachgeschlagen und dabei herausgefunden, dass das, was nicht geheuer ist, auch das ist, was nicht zum Hauswesen gehört, also kein Zuhause hat.
Oh! Tatsächlich! Das erinnert mich an ‚das Unheimliche‘.
Genau! Aber das Wort ‚geheuer‘ ist heute nicht mehr üblich.
Ja, das erkennen wir nicht so gut wie das ‚Heim‘ im ‚Unheimlichen‘. Danke, jetzt weiß ich es und ich kann es beim nächsten Mal einsetzen.
Ja, das heißt nicht-beheimatet sein und keinen Ort haben. Auch dieser Ort unter dem Strich ist ja eben kein Ort oder vielleicht auch ein heimlicher Ort und heimlicher Text.
Oh, sehen Sie, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den Text auch „Der heimliche Text“ nennen können. Jetzt ist es „Der geheime Text“.
[Lesung aus Das Ungeheuer]
Kann hier jemand Ungarisch? (Nein aus dem Publikum.)
Schade. Sonst hätte ich Ihnen noch das Grusel-Gedicht auf Ungarisch vorgelesen. Dazu muss man folgendes sagen, apropos der ‚geheime Text‘: Als ich in Salzburg war, dachte ich, das ist ja Österreich, das ist quasi nebenan und es werden bestimmt ungarische Studenten da sein. Ich hielt meinen ersten Vortrag mit zahlreichen ungarischen Einsprengseln und sie fielen in diesen Raum hinein, fielen vor meine Füße und verendeten, denn niemand in dem Raum konnte Ungarisch.
Und da ist es mir klargeworden, wie müssen meine einsprachigen deutschen Texte mit geheimen Zitaten auf den einsprachigen deutschen Leser wirken? Nämlich genau so: dass das nicht klingt. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was Sie lesen, wenn Sie das lesen, weil ich es selbst ganz anders lese.
Aber ich kann natürlich die Fremdheit wahrnehmen und kann darüber auch Betrachtungen anstellen.
Natürlich, das können Sie schon …
Es ist schon mühsam, vor allem durch die Unterteilung. Es ist eine Herausforderung, diesen Text zu lesen, nicht nur weil er unendlich traurig ist an vielen Stellen, sondern weil er wirklich im praktischen Sinne schwer zu lesen ist. Das würde ich schon sagen, aber weniger wegen des Ungarischen als tatsächlich dieser ganz ungewohnten Trennung.
Aber ich hoffe, Sie haben die Seite dann nicht so gelesen: immer von oben nach unten.
Nein, nein.
Was sehr auffällig ist bei der Flora, der wirklich nichts geschenkt wird und die sich auch viele schwere Gedanken dazu macht, dass Sie hier gleichzeitig das erste Mal eine weibliche Figur stark machen, die all diese Lasten tragen muss. Sie haben ja, als Sie anfingen zu schreiben, gesagt, komisch, irgendwie schreibe ich immer Männer, und jetzt ist da diese Flora und schreibt auch noch selbst. Und dann muss sie das alles tragen.
Ich weiß nicht, ob sie das stark macht. Ich meine, ich nehme eine weibliche Person und zerstöre sie. Im Übrigen habe ich mit weiblichen Figuren angefangen, aber es waren Kinder, und das ist was vollkommen anderes als eine erwachsene weibliche Figur zu haben. Sie hat durchaus ihre Stärke, indem sie es schafft, präsent zu sein. Auch mit Verweigerung kann jemand natürlich sehr präsent sein. Ich fühle mich ein wenig schlecht, dass ich jemanden zerstöre, aber es muss jemand zerstört werden. Sie hat sich dafür besser angeboten als er. Außerdem ist es eine Trilogie und Darius muss demzufolge alle drei Teile überleben oder zumindest die ersten zwei.
Ich vermute auch, dass es mit ihm eigentlich nicht gut ausgehen kann, aber das ist nur eine Spekulation. Da wir aber jetzt über die Frage sowohl der Mehrsprachigkeit als auch der Mehrstimmigkeit, die sich durch diese Aufteilung ergibt, gesprochen haben, würde ich die Frage nach dem Geschlecht der Figur auch nochmal vor diesem Hintergrund anbringen wollen. Weil sie ja eine schweigende Figur ist und schreibt dieses Tagebuch. Tief in ihrem Inneren, glaube ich, wäre sie gerne Schriftstellerin. Sie haben gesagt, sie arbeitet oder versucht als Übersetzerin zu arbeiten, aber man kann es an einigen Stellen durchaus so verstehen, dass sie selber schreibt. Und sie liest auch interessanterweise Literatur von anderen Autorinnen.
Ja klar, sie ist eine Leserin, das muss man sagen.
Sie liest sehr viel, sie liest aber eben auch forciert andere Schriftstellerinnen, das ist ja nicht selbstverständlich. Auch die Lyrikerin, die sie genannt haben, ist dafür ein Beispiel, es gibt andere. Haben Sie schon mal überlegt, was das bedeutet, dass Flora durch die Tagebuchform auf die autobiographische Schiene fällt? Was wiederum auch ein Klischee….
… ach so, ob das sozusagen die weibliche Form ist, ob die Biographie, das Tagebuch, ob das den Frauen so zugeschriebene Formen sind? Meine Herangehensweise ist beim Schreiben eine viel zu pragmatische, als dass ich Angst vor Klischees haben könnte. Oder mir diese erlauben könnte. Ich habe mir gesagt: wir brauchen hier die hinterlassenen Texte einer toten Figur, was haben wir da für Möglichkeiten? Dann entschied ich mich für diese Möglichkeit, das heißt diese Dateien, die manchmal tagebuchartig sind und manchmal nicht. Ich mache mir in dem Moment keine Gedanken darum, ob das gut zu einer Frau passt. Die Figur war nun einmal weiblich. Natürlich hätte es auch die Möglichkeit gegeben, das fällt mir jetzt erst ein, Floras geheimen Roman zu schreiben. Dann hätten wir zwei Romane in einem. Der hätte immer noch fragmentiert sein können. Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht bin ich feministisch nicht gut genug geschult dafür. Oder, wer weiß. Man kann darüber unmöglich eine sinnvolle Aussage treffen.
Sie hätte auch einen Roman schreiben können?
Sicher, aber so, wie die Dinge stehen, müssen wir uns damit abfinden, dass eine andere Frau, nämlich ich, einen Roman geschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Verfahrensweise wäre, eine weibliche Figur um Gottes Willen nichts machen zu lassen, was man gemeinhin dem Weiblichen zuordnet. Das würde die Figur und das ganze Erzählen, das würde die Autorin unnötig einschränken, und das wollen wir doch nicht? Ich denke, sowohl Männer als auch Frauen schreiben Tagebücher. Sind es nicht sogar Tagebücher von Männern, die wir als literarische Tagebücher rezipieren?
Ja, aber vor dem Hintergrund der Frage, ob Frauen überhaupt Kunst produzieren, vor diesem Hintergrund ist es tendenziell zuerst das autobiographische Schreiben, das ihnen zugebilligt wird.
Ich glaube, das ist seit einer Weile nicht mehr so. Tatsächlich hieß es lange, Frauen sind Lyrikerinnen in Ungarn. Ágnes Nemes NagyNemes Nagy, Ágnes wurde vorgeworfen, sie würde zu wenig weiblich schreiben, sie würde über ihr Frausein nicht schreiben, alles Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Prosa-Autorinnen, die es heute in Ungarn gibt, sind heftig und so krass, das ist unglaublich. An die ich jetzt denke, die kennt man hier natürlich alle nicht, man kennt hier die Männer mit den schönen Haaren. Die ungarischen Autorinnen sind unglaublich radikal, sehr feministisch, sehr körperlich, sehr provozierend, und ich muss sagen, mir bleibt jedes Mal die Spucke weg. Ich würde mich das nicht trauen. Aber ich muss mich das auch nicht trauen, weil ich Romane schreibe. Tatsächlich. Die radikalsten ungarischen Autorinnen schreiben nicht die langen Romane, sie nutzen andere, kürzere und amorphere Formen.
Meine letzte Frage dazu wäre vielleicht, inwiefern diese Geschlechterhierarchie auch nochmal bezogen auf die Sprachenhierarchie, die es ja offensichtlich gibt, reflektiert wird oder wie das miteinander zusammenhängt.
Gewisse Sachen kann man nicht. Wenn man einen Roman schreibt unter dem Strich durch die Mitte der Seite, dann hat man ein Oben und Unten, egal was unten hinkommt, das ist dann immer das Sublative. Es ist so, dass unter dem Strich die Frau ist und die Ausländerin, die von vielen nicht verstandene Sprache, ja, es ist halt unten. Sie können nicht alle an einem Ort sein.
Ich kann dazu Folgendes sagen, ich habe mich für die radikale Linie entschieden und nicht für die andere Lösung, die es auch gegeben hätte, sozusagen ihn und sie abwechselnd zu haben. Dann würde es ja so aussehen, als wäre alles auf einer Ebene. Ich habe mich ganz offensichtlich nicht dafür entschieden. Und ich habe das für mich so formuliert: Ich habe mich dagegen entschieden, ihre Texte zwischen seine zu schieben, was bedeutet hätte, seine sind der Haupttext und ihre sind dazwischengeschoben, was aber hauptsächlich damit zu tun hat, dass die Frau tot ist. Der, der lebt, ist immer dominant, weil er seinen Text noch sprechen und weiterschreiben kann. Er hat, solange er lebt, unendliche Möglichkeiten, seinen fortzusetzen, während ihrer fertig ist, da gibt es nichts mehr. Ich habe mich dafür entschieden, ihr einen Rahmen zu geben, eine Linie, die er nicht überschreiten kann, ich wollte nicht, dass der Text der Toten sich einfügt, er sollte ‚aus der Unterwelt heraus‘ nerven. So kann er sich immer melden, während du versuchst, oben ‚in Ruhe‘ etwas zu lesen. Unten passiert irgendetwas und fordert dich damit heraus, dich dazu zu verhalten. Und selbst wenn du dich dazu entscheidest, es zu ignorieren, hast du dich dazu entschieden, es zu ignorieren, und du weißt, dass du dich dazu entschieden hast, also hast du den Text unten doch nicht ganz ignoriert. Auch wenn unten gerade nichts steht, was zwischendurch auch vorkommt, registrierst du das mit dem peripheren Sehen, und auch dieses Nichts ist etwas.
Wie würde ich es darstellen, wenn es zwei Männer wären oder zwei Frauen? Es wäre immer so, dass dem, der unten ist, unterstellt würde, dass er der Unterdrückte ist, natürlich, und der, der oben drauf sitzt, ist halt immer der Dominante. Aber natürlich gehört jetzt auch dazu, dass ich in Deutschland einen Roman auf Deutsch geschrieben habe, wo der deutsche Text oben ist und der Übersetzte unten. Das ist hier auch die Situation, weil meine Hauptsprache, in der ich schreibe, die deutsche ist, also ist sie oben.