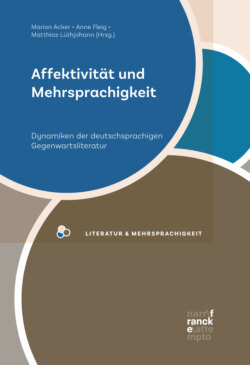Читать книгу Affektivität und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 6
1 Die Perspektive der Mehrsprachigkeit
Оглавление„Ich habe in meinen Büchern noch keinen Satz auf Rumänisch geschrieben, aber selbstverständlich schreibt das Rumänische immer mit […].“1 Mit dieser Aussage reflektiert Herta MüllerMüller, Herta eine Form der Mehrsprachigkeit, die auf den Entstehungskontext bezogen ist, im literarischen Text selbst aber nicht unmittelbar hervortritt. Im Anschluss an die Studie von Guilia RadaelliRadaelli, Giulia zum Sprachwechsel bei Elias CanettiCanetti, Elias und Ingeborg BachmannBachmann, Ingeborg lässt sich hier von einer „latenten“ Form der Mehrsprachigkeit sprechen, die im Gegensatz zu „manifester“ Mehrsprachigkeit dadurch charakterisiert ist, dass „andere Sprachen nur unterschwellig vorhanden und nicht unmittelbar wahrnehmbar sind“2. Um diese auf den ersten Blick „einsprachige Oberfläche“3 untersuchen zu können, hat Radaelli ein differenziertes begriffliches Instrumentarium zur Beschreibung von manifesten sowie latenten Formen von Mehrsprachigkeit entwickelt. Ihr zufolge besteht manifeste Mehrsprachigkeit entweder aus einem Sprachwechsel oder einer Sprachmischung, die unterschiedliche Qualitäten und Markierungen aufweist und auf unterschiedlichen Ebenen (syntaktischer, lexikalischer usw.) wirksam ist, sodass „an der Oberfläche des Textes mehrere Sprachen auftauchen“4. Dagegen sei ein Text latent mehrsprachig, wenn wie im Falle Müllers andere Sprachen zwar ‚mitschreiben‘, diese aber an der Oberfläche nicht wahrnehmbar werden. Eine solche Form der Mehrsprachigkeit meint beispielsweise auch Marica BodrožićBodrožić, Marica, wenn sie ihre Erst- bzw. Muttersprache als ein aus der Tiefe herauftönendes „Unterpfand“5 bezeichnet. Weitere latente Formen von Mehrsprachigkeit bilden Verweise auf andere Sprachen, die Eingliederung von einer oder mehreren Sprachen in die Literatursprache6 sowie Sprachreflexionen. Die jeweilige Bedeutung von manifester oder latenter Mehrsprachigkeit, zu der Radaelli auch das Auftreten von Sprachvarietäten und erfundenen Sprachen zählt, lässt sich jedenfalls nicht von vorneherein bestimmen, sondern ist vielmehr das Ergebnis der konkreten Interpretation, die immer den Entstehungskontext des Textes und den historischen Status der jeweiligen Sprachen einbeziehen muss.7
Wie die jeweilige Sprachwahl letztlich zustande kommt und welche Folgen sie für den jeweiligen literarischen Text hat,8 ist zweifellos eine Frage, die auch bezogen auf Affekte und Emotionen von Bedeutung ist und in auffällig vielen Poetik-Vorlesungen zum Gegenstand expliziter Reflexion wird. Die sprachbiographischen Erkundungen, die die mehrsprachige Textproduktion aus Sicht der Autoren und Autorinnen beleuchten, haben sich inzwischen als unentbehrliches, wenn auch nicht unproblematisches Arbeitsmittel der Mehrsprachigkeitsforschung etabliert.9 Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass Mehrsprachigkeit als soziales Phänomen eine Perspektive erfordert, die textanalytische und autorpoetische Fragestellungen aufeinander bezieht. Gerade in ihren vielfältigen Formen wird der spezifisch affektive Gehalt literarischer Mehrsprachigkeit kenntlich. Ziel dieses Bandes ist es daher, das Verhältnis von Affektivität und Mehrsprachigkeit erstmals zu konturieren, bislang disparate Forschungsfelder in produktiven Austausch miteinander zu bringen und neue theoretische Perspektiven zu entwickeln.