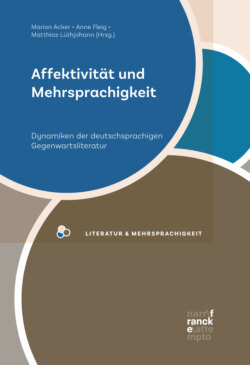Читать книгу Affektivität und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 16
Affekt und Sprachkritik Eine Kulturpolitik des Affekts? Zum Umgang mit Mehrsprachigkeit im Zürcher Dada – mit einem Seitenblick auf Ferdinand de Saussure
ОглавлениеTill Dembeck
EsSaussure, Ferdinand de ging hoch her in Zürich 1916, als Dada im Cabaret Voltaire erfunden wurde. Glaubt man den einschlägigen Berichten der Beteiligten, so lösten die künstlerischen Experimente, die dort zur Vorführung kamen, in einem unerwarteten Maße affektive Reaktionen aus. Bereits am 26. Februar, also nicht einmal einen Monat nach Eröffnung, notiert Hugo BallBall, Hugo: „Ein undefinierbarer Rausch hat sich aller bemächtigt. Das kleine Kabarett droht aus den Fugen zu gehen und wird zum Tummelplatz verrückter Emotionen.“1 Am 11. April endet die Ankunft einer „Gesellschaft holländischer Jungs“ mit dem allgemeinen Ausbruch einer Tanzwut, die „sich bis auf die Straße“ fortsetzt;2 und am 3. Juni gerät Emmy HenningsHennings, Emmy Tochter Annemarie bei einer Soiree „ob all der Farben und des Taumels außer Rand und Band.“3
Es ist zugleich klar, dass man es bei Dada mit einer Bewegung zu tun hat, die in vielerlei Hinsicht mit dem sogenannten ‚Einsprachigkeitsparadigma‘ bricht, dem in der Forschung bescheinigt wird, in engem Verbund mit Kulturpolitiken der Nationalisierung das gesamte 19. Jahrhundert geprägt zu haben. Was läge also näher als die Frage, inwiefern die literarische Mehrsprachigkeit von Dada und die affektive Wirkung der Bewegung etwas miteinander zu tun haben: Wenn die affektive Wirkung eines der Ziele des Unternehmens ist – stellt dann Mehrsprachigkeit schlicht eines der poetischen Mittel dar, es zu erreichen, oder bemüht man sich vielmehr darum, die Affektivität von Sprache(n) selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken?
Diesem Problemkomplex möchte ich mich im Folgenden widmen, ausgehend von der Frage, wie sich Dada zur Semantik der Muttersprache verhält, die eine enge affektive Beziehung zwischen Sprecherinnen und ihren Sprachen unterstellt. Die genauere Auseinandersetzung mit drei Dada-Gedichten aus dem Jahr 1916 soll die These plausibilisieren, dass Mehrsprachigkeit gezielt eingesetzt wird, um vor-muttersprachliche und daher in besonderer Weise affektbezogene sprachliche Kreativität freizusetzen. Um die Spezifik des Zugangs von Dada zu Affekt und Mehrsprachigkeit zu erläutern, werde ich u.a. auf ein Schweizer Parallelunternehmen der Jahre 1915/16 zu sprechen kommen, nämlich die Kompilation des Cours de linguistique générale von Ferdinand de SaussureSaussure, Ferdinand de durch Charles Bally und Albert Sechehaye in Genf. Das ursprüngliche Anliegen SaussureSaussure, Ferdinand des, wie man es seinen Notizen entnehmen kann, ist nämlich an eben jener vor-muttersprachlichen Kreativität interessiert, die auch Dada anzapfen möchte. Aus fachpolitischen Gründen wird diese Facette des SaussureSaussure, Ferdinand de’schen Denkens aber im Cours getilgt. Der Kontrast zwischen der Programmatik der Cours-Edition und dem seltsam konsequenzlosen Treiben in Zürich lässt besonders gut erkennen, was die von Dada anvisierte Kulturpolitik des Affekts auszeichnet.