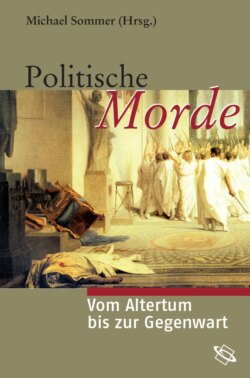Читать книгу Politische Morde - Группа авторов - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеVon Michael Sommer
Rom, 18. September 96 n. Chr., gegen Mittag. Der Freigelassene Stephanus sticht in den Schlafgemächern des Palatin mit einem Dolch auf den Kaiser ein. Domitian, seit fünfzehn Jahren auf dem römischen Thron, wehrt sich nach Kräften, fasst den Dolch bei der Klinge und versucht, ihn mit blutenden Händen dem Angreifer zu entreißen. Opfer und Täter ringen auf dem Fußboden miteinander, ein Page läuft zum Bett des Kaisers, sucht die unter dem Kopfkissen verborgene Waffe und findet – nichts. Aus ihren Verstecken dringen weitere Männer und töten den Kaiser mit wenigstens acht Messerstichen. Domitian, den uns die Quellen unisono als paranoiden Autokraten schildern, verblutet auf dem Marmorfußboden des von ihm errichteten Palasts. Ein politischer Mord?
Die scheinbar banale Frage birgt ungeahnte Brisanz. Der Angreifer Stephanus war erkennbar kein Einzeltäter. Nichts hatte man dem Zufall überlassen. Vorsorglich hatte ein Mittäter den für alle Fälle unter dem kaiserlichen Kopfkissen bereitgelegten Dolch entfernt. Und als Stephanus im Ringkampf mit dem physisch überlegenen Kaiser den Kürzeren zu ziehen drohte, eilten ihm sogleich in Nischen und hinter Vorhängen postierte Komplizen zu Hilfe – und „entsorgten“ den Attentäter, so jedenfalls eine Quelle, als Hauptbelastungszeugen gleich mit. Über Hintermänner des Anschlags und ihre Motive indes schweigen sich die literarischen Berichte, die wir Sueton und Cassius Dio verdanken, aus.
Zwischen den Zeilen aber treten, nimmt man Sekundärquellen zu Hilfe, die Konturen einer Verschwörergruppe hervor, in der höchste Kreise das Sagen hatten und in die Domitians Nachfolger Nerva (96 – 98 n. Chr.) maßgeblich verstrickt war. Sie alle verdankten ihre Karrieren eben jenem Domitian, den sie ins Jenseits beförderten. Getrieben von Furcht vor dem stets misstrauischen, zu eruptiver Grausamkeit neigenden Kaiser und von der Sorge, von dem Autokraten Domitian um jeglichen politischen Einfluss gebracht zu werden, suchten sie den Schulterschluss mit Palastdienern, von denen gleichfalls viele um ihr Leben bangen mussten. Persönliche Beweggründe gingen mit ideologischen und politisch-pragmatischen Erwägungen eine krude Mischung ein. Seinen Motiven nach ist der Mord an Domitian mindestens ebenso sehr ein Akt präventiver Selbstverteidigung wie ein politischer Mord.
I. Das Individuum im historischen Prozess
Die Frage nach den Folgen rührt an eines der großen, seit eh und je kontrovers behandelten Themen der Geschichtswissenschaft: die Rolle des Individuums im historischen Prozess. Ihrer Beantwortung lässt sich, wenn überhaupt, nur spekulativ näher kommen. Das Nachdenken über die Folgen eines historischen Ereignisses schließt notwendig das Nachdenken über das ein, was geschehen (oder nicht geschehen) wäre, wenn das Ereignis ausgeblieben wäre. Um das Geschehen kontrafaktisch weiterdenken zu können, müssen wir für einen Augenblick bei dem verweilen, was wirklich geschah: Hinter der engeren senatorischen Verschwörergruppe standen weitgespannte aristokratische Netzwerke, mit Schwerpunkten in Spanien und Gallien. Nicht zufällig fiel nach Domitians Tod der Purpur Nerva zu: Der schon betagte Konsular galt als Mann des Übergangs, rivalisierenden Interessengruppen war er als Kompromisskandidat vermittelbar.
Bei weitem schwieriger als die Inthronisierung eines neuen Kaisers war der Machterhalt nach einmal errungener Herrschaft. Herrscherwechsel sind für jede Monarchie kritische Momente, und das Römische Reich macht hier keine Ausnahme. Gefährdet war ein Machthaber besonders dann, wenn er keinen Sohn vorweisen konnte, wie Nerva. Gegen Nerva sprachen weiter seine altersbedingte Gebrechlichkeit, die anhaltende Loyalität vieler Soldaten Domitian gegenüber und die Zerrissenheit der senatorischen Aristokratie. Nerva entledigte sich aller Probleme zugleich auf eine Weise, die Respekt abnötigt und ihn, der kurzen Dauer seiner Herrschaft zum Trotz, als einen der Großen in der langen Reihe römischer Kaiser dastehen lässt. Er adoptierte als Nachfolger M. Ulpius Traianus, einen erfahrenen, bei den Soldaten beliebten Truppenführer, der mit seiner weitläufigen Verwandtschaft das gallische und das spanische Aristokratennetzwerk wie ein Scharnier verband.
Nerva hatte sein Haus bestellt und konnte in Frieden sterben (98 n. Chr.). Wie Nerva, so machten auch seine Nachfolger aus der Not fehlender männlicher Nachkommenschaft eine Tugend: Sie bestimmten, jedenfalls in der Propagierung ihrer Herrschaft, den jeweils Besten im Adoptionsgang zum Nachfolger. Über ein ganzes Jahrhundert behaupteten so Familien, die ihren Hintergrund in Spanien hatten, die Macht. Der Letzte einer langen Reihe war der aus der Art geschlagene Commodus, bezeichnenderweise der erste Kaisersohn seit fünf Generationen, der den Thron besteigen konnte.
Trajan verhalf aber nicht nur dem iberischen Netzwerk zur Macht, er verstellte auch tatkräftig die Parameter römischer Außenpolitik. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung hatte Domitian einen groß angelegten Feldzug vorbereitet, der die römischen Legionen von Süddeutschland und Österreich (Noricum) bis weit nach Böhmen und Mähren führen sollte. Er hätte damit nicht nur der römischen Germanienpolitik eine völlig neue Expansionsrichtung gegeben, sondern auch Gebiete annektiert, die 70 Jahre später germanischen Stämmen, den Markomannnen und Quaden, als Ausgangsbasen für Plünderungszüge dienen sollten, die Rom einen langen und verlustreichen Krieg kosteten. Der Markomannenkrieg wiederum war nur ein Vorgeschmack auf jene Völkerbewegungen, die Roms Rhein- und Donaugrenze im 3. und wieder seit dem späten 4. Jahrhundert n. Chr. zur offenen Flanke machten. Statt der markomannisch-quadischen Siedlungsgebiete überfiel Trajan das silberreiche Dakien und führte seine Legionen wenig dauerhaften Siegen in Mesopotamien, gegen die Parther, entgegen.
Hat also die Tat des Stephanus der Weltgeschichte eine entscheidende Wendung gegeben? Hätte Domitians Zangenangriff gegen die germanischen Stämme den notorischen Unruheherd dauerhaft befriedet und das sich für Rom außerhalb seiner Reichsgrenzen zusammenbrauende Unheil verhindert, wenigstens aber abgemildert? Wir wissen es nicht, doch spricht manches dafür. Die römische Außenpolitik, deren Richtlinien der Kaiser und niemand sonst bestimmte, stand an der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert n. Chr. am Kreuzweg. Trajan stieß mit seinen ehrgeizigen Feldzügen in Territorien vor, die auf Dauer für Rom nicht zu halten waren. Domitians wesentlich bescheidener dimensionierte Pläne indes trugen einer sich ändernden Sicherheitslage jenseits des Limes Rechnung. Daran, dass die multiple Krise, in die Rom im 3. Jahrhundert schlitterte, wesentlich von außen induziert war, bestehen heute kaum noch Zweifel. Der Mord an Domitian ist deshalb ein eminent politischer Mord, weil er, unabhängig von den Beweggründen der Mörder, politische Folgen von erheblicher Reich- und Tragweite zeitigte.
Der Mord an Domitian zeigt aber auch, dass die Strukturen und Prozesse, die letztlich in einen politischen Mord münden können (namentlich die spezifische, Eigendynamik entwickelnde Situation am flavischen Hof), nicht unbedingt etwas zu tun haben müssen mit der historischen Nah- oder gar Fernwirkung eines Anschlags. Beim zeitlichen Zusammenfall des Hofkomplotts mit einer für Rom vitalen außenpolitischen Weichenstellung hatte, wenn man so will, der Zufall seine Hand im Spiel.
II. Das Dilemma der Kontingenz
Mustergültig verquickt sich im Mordfall Domitian und seinen langfristigen Auswirkungen individuelles Handeln und Wollen mit kontingenten Faktoren, die menschlichem Zugriff entzogen sind. Auf der einen Seite stehen der Kaiser, seine politische Handlungsfreiheit, Intentionen und Strategien sowie die Pläne und Absichten seiner Mörder und ihrer Hintermänner, auf der anderen die für sie alle nicht zu ändernden – und in ihrer Komplexität auch kaum zu überblickenden – politischen, sozialen und mentalen Strukturen, die den Handelnden ihre Rollen zuweisen und den Raum abstecken, in dem sie sich bewegen. Erst die eigentümliche Verfasstheit der Prinzipatsordnung und des Hofes sowie die spezifischen Probleme römischer Außenpolitik gaben dem Mord Sinn und Wirkungsmacht.
Jeder Mord ist eingebettet in Strukturen, die sich der Kontrolle der Handelnden entziehen, jeder Mörder mit dem Dilemma der Kontingenz konfrontiert. Deshalb ist ein Mord „politisch“ nicht nur dann, wenn der oder die Täter von politischen Beweggründen getrieben werden, sondern immer auch, wenn er eine Bedeutung erlangt, die über das bloß Ereignishafte hinausreicht. Ein Mord kann tief in politischen Strömungen und Strukturen der Epoche wurzeln und dadurch „politisch“ sein, oder er kann, mit seinen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen, elementare politische Parameter so grundlegend verstellen, dass eine Gesellschaft oder gar die Welt nach dem Mord eine andere geworden ist.
Der Mord am österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand (1914) erfüllt beide Bedingungen und geht obendrein auf das Konto von Überzeugungstätern, deren politische Motive über jeden Zweifel erhaben sind. Schon das symbolträchtige Datum des Mordes, der Sankt-Veits-Tag, verweist auf die schier endlose Kette nationaler Traumata, die den serbischen Weg ins Europa der Nationalstaaten pflasterten. Aus ihr bezogen die Mörder die Rechtfertigung für ihre Tat. Die kurz- und mittelfristigen Folgen des Attentats entsprachen genau ihrem Kalkül. Gavrilo Princip und seine Gesinnungsgenossen aus dem Kreis militanter bosnischer Serben hatten es vergleichsweise leicht. Man musste nicht mit übermäßigem politischem Weitblick begabt sein, um kalkulieren zu können, dass der Mord an Franz Ferdinand binnen kurzem einen politischen Brand kontinentaler Größenordnung auslösen würde, in der Österreich-Ungarn mit dem Rücken zur Wand stehen musste (Beitrag Geiss). Wirklich brach gut einen Monat nach der Bluttat der Erste Weltkrieg über Europa herein, der den Serben tatsächlich ihren, als Jugoslawien verbrämten, Traum von Groß-Serbien erfüllte. Doch waren Erster Weltkrieg und groß-serbische Monarchie nur Durchgangsstationen auf einem Weg, der im Ergebnis die serbische Nation an den Rand des moralischen Bankrotts führte. Keiner kann Princip und seinen Leuten vorhalten, sie hätten den Gang der Ereignisse voraussehen müssen.
Nur selten treffen sich die Intentionen der Mörder mit den Folgewirkungen des Mordes, jedenfalls den unmittelbaren, so passgenau wie im Fall des Attentats von Sarajevo. Wer oder was dem Mörder John F. Kennedys die Hand führte, wird sich vermutlich nie restlos aufklären lassen (Beitrag Kellerhoff). Auch wenn, wofür vieles spricht, die Tat das Werk eines verwirrten Einzeltäters war, so war sie doch ein Ereignis von globaler Bedeutung, wirkt in den USA bis heute als nationales Trauma nach und begründete, wenigstens indirekt, indem sie das politische Klima aufheizte, eine ganze Serie politischer Bluttaten im Amerika der 60er Jahre, die alle wiederum, im Kleinen wie im Großen, ihre Folgewirkungen hatten.
Opfer einer privaten Fehde wurde der Athener Tyrann Hipparchos (514 v. Chr.), doch machte sein Tod kurzfristig den Weg frei für die Beseitigung der Tyrannis, mittelfristig für die Reformen des Kleisthenes und langfristig für die entwickelte attische Demokratie (Beitrag Möller). Im Kreis politischer Überzeugungstäter wird man auch die Mörder Philipps II. von Makedonien (336 v. Chr.) nicht suchen wollen, wer immer die Tat beging (Beitrag Meißner). Und doch ist ohne den Mord am Vater Alexanders des Großen der Aufstieg des Hellenismus zur „Weltkultur“ (Hermann Bengtson) undenkbar: Alexanders innere, gerade auch irrationale Triebkräfte, die ihn bis tief nach Indien führten, wird heute kaum noch jemand ernsthaft in Abrede stellen. So war auch Philipps Ermordung eine historische Wasserscheide ohne Wenn und Aber.
Die Aussicht auf schnelles Geld kann auch einen im Herzen unpolitischen Menschen zum politischen Mörder machen. James Earl Ray, der Martin Luther King ermordete (1968), war ein Kleinkrimineller ohne jede politische Ambition, den allein die auf Kings Kopf ausgesetzte Prämie von 50 000 Dollar zur Tat anstiftete. Gleichwohl entfachte er mit der Bluttat unmittelbar einen politischen Flächenbrand, ebnete à la longue aber den Weg dafür, dass King – und mit ihm die amerikanische Bürgerrechtsbewegung – als Ikonen nationaler Sinnstiftung von allen Amerikanern vereinnahmt werden konnten (Beitrag Sommer). Was nach dem Mord geschieht, welche Reaktionen und langfristigen Folgen er auslöst, hängt von einer Unzahl von Variablen ab, welche die Mörder – oder ihre Hintermänner – unmöglich alle überblicken können.
Yitzhak Rabins Mörder lebt in seiner israelischen Gefängniszelle in der Überzeugung, mit seinem Attentat (1995) sein Land von einem Verräter befreit und es dadurch gerettet zu haben, dass der mit dem Oslo-Abkommen in Gang gesetzte Prozess nun scheitern würde (Beitrag M. Zimmermann). Auf kurze Sicht ist seine Rechnung sogar aufgegangen. Der Friedensprozess hat in Rabin seinen charismatischen Verfechter verloren, Frieden im Heiligen Land erscheint heute wieder, mehr denn je, als Fata Morgana. Doch dass Yigal Amir dem jüdischen Staat mit der Bluttat einen Dienst erwiesen hat, kann nur jemand glauben, der, wie er, von messianischem Sendungsbewusstsein erfüllt ist.
Oft aber entgleiten politischen Mördern selbst die unmittelbarsten Folgen ihres Tuns. Valentinian III. meinte in Aëtius einen lästigen Rivalen zu beseitigen (254) – und unterschätzte dessen über den Tod hinaus loyale Gefolgschaft: Binnen Jahresfrist war der Kaiser selbst ein toter Mann (Beitrag Leppin). Besonders kritisch für die Mörder wird es, wenn sich einstige Gegner über der Leiche des Mordopfers die Hände zur Versöhnung reichen. Aldo Moro war noch nicht tot, als das politische Italien gegen die Entführer seine Reihen schloss und jegliche Verhandlungen mit den Roten Brigaden ablehnte (Beitrag Sommer). Aus der Krise, die auf Moros Ermordung folgte, ging seine Partei, die Democrazia Cristiana, sogar gestärkt hervor. Dauerhaft diskreditiert aber war die radikale Linke, die, vollständig isoliert, hernach nur noch mit Gewaltaktionen auf sich aufmerksam machen konnte.
Auch andere Morde provozierten Solidarisierungen, die das Kalkül der Täter mit sofortiger Wirkung durchkreuzten, besonders dann, wenn sie Märtyrer schufen. Martin Luther King, dessen Gewalttod erst den in den „heißen Sommern“ der 1960er Jahre zerbrochenen nationalen Konsens erneuerte, konnte nicht mehr erleben, wie sich sein Traum erfüllte. Paradoxerweise war es gerade sein Tod, der die Afroamerikaner jenem Gelobten Land, das er ihnen zu Lebzeiten verheißen hatte, ein gehöriges Stück näher brachte. Zwar sah Mahatma Gandhi, dessen Enkel im Geiste King war, noch die Erfüllung seines Traums, die Gründung des indischen Nationalstaats, doch war der Bürgerkrieg zwischen Hindus und Muslimen, mit einer halben Million Toter, für ihn ein inakzeptabler Preis. Gandhi wurde, ermordet von einem fanatischen Hindu-Nationalisten, eines der letzten Opfer des Krieges (1948); er wurde gerade so, wie King, zum Märtyrer nationaler Einheit (Beitrag Rothermund). Der Mord trug, entgegen der Absicht des Mörders, auf lange Sicht zur Stabilisierung der größten Demokratie dieser Erde bei.
Mit einer im Prinzip ähnlich gelagerten dialektischen Fernwirkung versehen, ebnete erst Caesars Ermordung (44 v. Chr.) den Weg für die Regierungsform, die er den Römern hatte verordnen wollen. Gerade im Tod bewies Caesar, wie sehr er seine Mörder an politischem Format überragte. Brutus und Cassius ließen den Moment der Schreckstarre, in die sie Rom gestürzt hatten, ungenutzt verstreichen und verspielten so das symbolische Kapital, das sich aus dem Mord hätte schlagen lassen (Beitrag Zecchini). In einer beispiellosen Koalition disparater Elemente fanden Caesars politische Nachlassverwalter so lange zusammen, bis die Mörder vernichtet waren.
Enger zusammenrücken ließen auch die politischen „Fememorde“ der frühen 1920er Jahre die staatstragenden Kräfte der Weimarer Republik (Beitrag Pappert). Die Morde an dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger (1921) und an Reichsaußenminister Rathenau (1922) markierten, gemeinsam mit der Inflationskrise (1923), die erste, fast letale Krise des demokratischen Gemeinwesens. Doch schufen sie auch so etwas wie ein demokratisches Gemeinschaftsgefühl. „Dieser Feind steht rechts“, konnte Reichskanzler Joseph Wirth nach der Ermordung Walther Rathenaus unter dem Beifall zahlreicher Abgeordneter im Reichstag ausrufen. Allerdings war das Band demokratischer Solidarität, wie sich erweisen sollte, allzu brüchig.
Andere Morde verschaffen der Tendenz nach autokratischen Machthabern erst Vorwände, die Schrauben von Repression und Terror noch weiter anzuziehen. Der Rachemord Herschel Grynszpans an dem Legationssekretär Ernst vom Rath lieferte dem NS-Regime den willkommenen Anlass zur „Reichskristallnacht“ (1938). Der Ermordung August von Kotzebues durch Karl Ludwig Sand (1819), dem der russische Staatsrat die inkarnierte Reaktion war, folgten die Karlsbader Beschlüsse auf dem Fuß, Auftakt zu massiver Verfolgung der deutschen Freiheits- und Nationalbewegung (Beitrag Mehring).
Kuriosen Bahnen folgte auch das Nachspiel des Anschlags Friedrich Adlers auf den Reichsgrafen Stürgkh, den österreich-ungarischen Ministerpräsidenten, mitten im Ersten Weltkrieg (1916; Beitrag J. Zimmermann). Der Mörder wollte mit seiner Tat ein Zeichen setzen, gegen den Krieg, gegen die Regierung, aber auch gegen seine eigene Partei, die Sozialdemokratie. Just von ihr wurde er nach seiner glänzenden Parade im Gerichtssaal vereinnahmt. Die Partei nahm den Verstoßenen stillschweigend wieder in ihre Reihen auf und machte ihn zum Kronzeugen ihres eigenen Pazifismus und Internationalismus, wodurch sie – anders als die deutschen Genossen – 1918 der Spaltung entging.
Jeder politische Mord löst eine Kettenreaktion von Folgeereignissen aus, die sich in ihrer Komplexität vorausschauender Planung entziehen. Selbst wenn die Ereignisse – jedenfalls post festum – präziser Regelhaftigkeit zu gehorchen scheinen, so ist doch für den oder die Handelnden jeweils nur ein Bruchteil aller Parameter durchschaubar. Auch bei noch so bedachtsamer Planung hat, spätestens ab dem Moment, in dem das Opfer tot am Boden liegt, der Zufall seine Hand im Spiel. Insofern gleicht die Kugel des Attentäters einer Billardkugel, deren Kurs sich, wenn überhaupt, nur über einige wenige Geraden vorausberechnen lässt.
III. Der soziale Ort politischer Morde
So unberechenbar wie die Folgen der Mordtat für den Mörder ist meist das Eintreten des Ereignisses selbst für das Mordopfer und die Öffentlichkeit. Gewiss: Manche prominente Persönlichkeit scheint Attentate förmlich auf sich zu ziehen. Viele politische Mordopfer waren, als sie ermordet wurden, nicht zum ersten Mal Ziel eines Anschlags. Die meisten verfügen über Personenschutz, etliche über Zugang zu nachrichtendienstlichen Informationen, um Attentaten vorzubeugen. Höherer Informationsquellen erfreuten sich die römischen Kaiser, deren Ermordung, folgen wir den römischen Historikern, stets durch unheilvolle Vorzeichen angezeigt wurde. So kündeten angeblich auch von Caligulas Ermordung (41 n. Chr.) düstere Omina (Beitrag Arand).
Römischer Aberglaube in allen Ehren, politische Morde sind nicht prognostizierbar. Unvorhersagbarkeit freilich ist nicht mit Unerklärbarkeit zu verwechseln. Personen, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, sind nicht von ungefähr Zielpersonen von Anschlägen. Selbst dann, wenn Politiker – wie kurz hintereinander Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble und unlängst in den Niederlanden Pim Fortuyn – Opfer von offensichtlich Geistesgestörten werden, erklärt sich das Geschehen aus ihrem Bekanntheitsgrad und der daraus erwachsenden Publicity eines Attentats – unvermeidliche Begleiterscheinung der Mediendemokratie (Beitrag Leggewie).
Doch auch bevor Zeitungen, Funk und Fernsehen politische Morde in alle Welt verbreiteten, war die öffentliche Aufmerksamkeit, die dem Mörder gewiss war, für viele Täter ein wesentliches Motiv zum Handeln. Häufig richtete sich der Mord weniger gegen die Person, als gegen Ideen und politische Programme, für die ihr Name stand. Die Caesar-Mörder töteten in dem Diktator einen Mann, dem sie – besonders Brutus – persönlich nahe standen, der für sie aber den Untergang des bereits in der Agonie liegenden republikanischen Systems verkörperte. Der Mordanschlag des Studenten Sand auf den Schriftsteller August von Kotzebue zielte nicht auf den Mann an sich, sondern auf die reaktionäre Ordnung, deren Repräsentant Kotzebue vermeintlich war. Die eigentliche Wirkung eines politischen Mordes ist vielfach ihre Symbolwirkung, die jede reale Konsequenz an Bedeutung weit überragt.
Symbolwirkungen können Morde selbst dann entfalten, wenn dies ursprünglich gar nicht in der Absicht des Mörders lag. Bestes Beispiel ist der Mord an dem athenischen Tyrannen Hipparchos, dem Sohn des Peisistratos (Beitrag Möller). Die möglicherweise von rein persönlichen Motiven getriebenen Täter konnten beim besten Willen nicht voraussehen, dass ihre Tat kurzfristig die Tyrannis in ihre letale Krise stürzte und auf lange Sicht zum Archetypus des Tyrannenmordes avancierte, zum historischen Präzedenzfall, auf den sich – wirkliche oder selbsternannte – Tyrannenmörder immer wieder beriefen, von den Caesar-Mördern bis zu den Verschwörern des 20. Juli um Claus Schenk Graf Stauffenberg. Die wenigsten von ihnen werden gewusst haben, dass wenigstens dem Historiker Thukydides Harmodios und Aristogeiton gerade nicht als Herolde der Freiheit galten.
Dass die symbolische Bedeutung politischer Morde, im Vergleich zu ihren faktisch-unmittelbaren Folgen, so übermächtig erscheint, mag auch daran liegen, dass sich Institutionen und politische Systeme nur selten dadurch treffen lassen, dass man ihre Repräsentanten aus dem Weg räumt. Oft stellte sich im Nachhinein heraus, dass man die Bedeutung der Persönlichkeit gründlich überschätzt hatte. „Mit einer Kugel die Welt verändern“ (Sven Felix Kellerhoff) – und zwar in ihrem Sinne –, das gelang nur vergleichsweise wenigen politischen Mördern. Meist fanden sich in der Umgebung des Mordopfers genügend Figuren, die in die Bresche springen konnten, von den dialektischen Fernwirkungen der Tat ganz zu schweigen, die immer wieder die Intentionen des Mörders auf den Kopf stellten.
Freilich gibt es eine prägnante Ausnahme von der Regel: Hochgradig auf Persönlichkeiten zugeschnitten sind monarchische Systeme, besonders, wenn sie eine mehr oder weniger starke dynastische Komponente haben. Sie stürzen immer dann, wenn die Nachfolgefrage auf die Tagesordnung rückt, in eine strukturell bedingte Krise. Je nach Umständen kann die Krise so einschneidend sein, dass sie ein ganzes Staatswesen aus dem Tritt bringt. Selbst wenn, wie im Fall des Knut Lavard (Beitrag Kraack), das Opfer „nur“ ein aussichtsreicher Anwärter auf die Königswürde war, konnte der Mord langwierigen Zwist nach sich ziehen, der das Zentrum auf lange Sicht lähmte. Zwei weitere politische Morde und ein blutiger Bürgerkrieg waren Fernwirkungen des Anschlags von Haraldsted.
Der Mord an Knut Lavard fügt sich in die Ratio einer Wahlmonarchie mit dynastischer Komponente. Der Obotritenfürst konnte sich, als Neffe des amtierenden Königs Niels, reelle Chancen auf die Nachfolge ausrechnen, obwohl mit Niels’ Sohn Magnus, Knuts Vetter, ein direkter Nachkömmling des Herrschers vorhanden war. Der einzige Weg auf den Thron führte für Magnus, der seinem Vetter an Charisma ebenbürtig, aber an Hausmacht und Prestige unterlegen war, über die Ermordung Knuts. Sie war, aus Sicht der Handelnden, nachgerade alternativlos.
IV. Kulturen politischen Assassinentums
Ähnlich gelagert und in seiner rationalen Planhaftigkeit eines Cesare Borgia würdig war das Massaker von Senigallia (Beitrag Reinhardt). Kalt räumte Cesare die Stadtherren, die seinem Projekt, das Territorium des Patrimonium Petri zu einem straffen Staatsgebilde zusammenzuschweißen, entgegenstanden, aus dem Weg. Das war das Holz, aus dem ein machiavellischer principe geschnitzt war! Doch Vitellozzo, die Orsini und die übrigen in Senigallia niedergemetzelten Signori wurden nicht nur Opfer von Cesares berechnendem Willen zur Macht, sondern auch eines Systems, in dem charismatische Führerpersönlichkeiten den Ausschlag gaben. Cesare konnte sich darauf verlassen, dass mit dem Tod der Anführer jeder Widerstand in sich zusammenbrach. Machiavelli sah die Grausamkeiten dadurch gerechtfertigt, dass sie viele andere Leben retteten. Ein politischer Mord vom Borgia-Typus schuf Fakten, in aller wünschenswerten Vollkommenheit und Irreversibilität.
Einer ganz anderen Mechanik gehorchten offensichtlich die Ermordungen römischer Kaiser, von denen viele eine bestürzend geringe Lebenserwartung hatten. Domitians Ende als Opfer einer bunt zusammengewürfelten Verschwörung erscheint, überblickt man die fünfhundertjährige Geschichte des römischen Kaiserreichs, eher als Ausnahme denn als Regelfall. Während Domitian auf dem Höhepunkt seiner Machtfülle aus dem Leben gerissen wurde, waren die meisten der vielen römischen Kaiser, die ein gewaltsames Ende fanden, politisch längst tot, bevor sie ermordet wurden. In einem System, das gerade nicht auf persönlichem Charisma, sondern ganz wesentlich auf der Akzeptanz beruhte, die der Herrscher in maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen (dem Senatorenstand, den Rittern, der römischen plebs und den munizipalen Eliten) fand – oder eben nicht fand –, war das Mittel der Wahl, den amtierenden Herrscher herauszufordern, die Usurpation. Schon der Historiker Tacitus sah in aller Deutlichkeit, dass die arcana imperii nicht in Rom, sondern in den stark militarisierten Provinzen der Peripherie lagen. Wenn es für den Kaiser eng wurde, konnten sich Generäle, im Rücken ihre Legionen, zum Kaiser ausrufen lassen, die unvermeidliche Konfrontation mit dem Inhaber des Purpurs vorbereiten und um Bundesgenossen werben. Jede Usurpation entwickelte Eigendynamik. Am Ende stand der Tod, entweder des Kaisers oder des Usurpators. Nicht wenige traf das Schwert ihrer eigenen Soldaten, sobald die Niederlage unabwendbar schien. Für das Überleben des Unterlegenen war im System keine Leerstelle vorgesehen.
Die Usurpation im Akzeptanzsystem stellt gewissermaßen die Logik des politischen Mordes auf den Kopf. Der Mord ist hier keine Fakten schaffende Handlung, wie im Fall der Borgia-Morde, sondern lediglich Fakten sanktionierendes Nachspiel. Er folgte in Rom meist dem einfachen Kalkül der unterlegenen Seite, Schlimmeres dadurch zu verhindern, dass man sich des eigenen Anführers entledigte, oder Überlegungen der Sieger, sich das Überleben des unterlegenen Rivalen schlicht nicht leisten zu können. Noch heute folgt auf Staatsstreiche und Revolutionen meist ritualhaft die „Nacht der langen Messer“.
Der römische Kaisermord-Typus teilt deshalb mit den Borgia-Morden das Moment rationaler Planhaftigkeit. Daneben erstreckt sich das weite Feld affektueller Motive, aus denen die Rache als stärkste Triebkraft ragt. Wer sich zu kurz gekommen fühlt, kreidet es gern den politisch Verantwortlichen an. Aufgestaute Demütigungen, Frustrationen und Ressentiments erlangen, wenn sie auf öffentliche Figuren projiziert werden, rasch politische Brisanz. Ein von Rachegelüsten geleitetes politisches Assassinentum etablierte sich in der Moderne auf dem indischen Subkontinent: Drei Generationen politischer Führer, alle mit dem Namen Gandhi, fielen ihm zum Opfer, wenn auch die Täter aus ganz unterschiedlichen kulturellen und sozialen Ecken kamen. Rachegelüste herrschten auch in der Motivationshaltung der „Fememörder“ in der Weimarer Republik vor. Je stärker das Normensystem einer Gesellschaft auf Begriffen von Ehre basiert – und die ultrarechten Kreise Weimars, denen Erzbergers und Rathenaus Mörder entstammten, hatten einen pseudo-aristokratischen Ehrbegriff –, desto stärker werden die politischen Repräsentanten dem Risiko ausgesetzt sein, Racheakten zum Opfer zu fallen.
Eine vierte Kategorie gewinnt im Zeitalter der Mediengesellschaft immer mehr an Bedeutung, ist aber keineswegs nur ihr zu eigen: der politische Mord als Fanal. Er zielt als Symbolhandlung weniger auf die Person des Opfers als unmittelbar auf die Öffentlichkeit. Der Fanal-Mörder möchte niemanden aus dem Weg räumen, um seine Ziele zu erreichen, ihn treibt auch kein Rachedurst, er möchte ein Zeichen setzen, so publikumswirksam wir es nur geht. Urbild waren die Caesar-Mörder, denen es an jeglicher politischer Konzeption für die Ära nach dem Mord gebrach. Sie setzten ein – ebenso heroisches wie sinnloses – Zeichen gegen die Autokratie des einen, alle überragenden Mannes. Der perversen Logik des Fanal-Mords folgend, werden mehr und mehr auch völlig Unbeteiligte zu Zielscheiben politischer Triebtäter, im jüngsten Extremfall potenziert zum tausendfachen Massenmord bei den Anschlägen vom 11. September. Die globalisierte Moderne scheint auf dem besten Weg, sich ihre eigene grausige Semantik politischen Assassinentums zu schaffen.
Literatur: A. Demandt (Hrsg.): Das Attentat in der Geschichte, Köln 1996; E. Flaig: Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich, Frankfurt am Main 1992; S. F. Kellerhoff: Attentäter. Mit einer Kugel die Welt verändern, Köln/Weimar/Berlin 2003; H. Münkler: Die neuen Kriege, Reinbek 62003; ders.: Machiavelli. Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, Frankfurt am Main 2004; M. Sommer: Die Soldatenkaiser, Darmstadt 2004; M. Weber: Soziologische Grundbegriffe, Tübingen 61984.