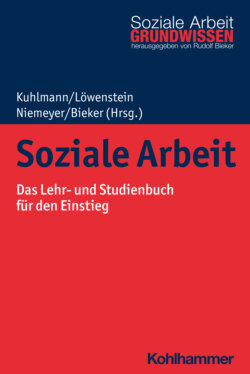Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Soziale Arbeit als Ko-Produktion
ОглавлениеWeil Soziale Arbeit nur mit, und nicht ohne oder gegen ihre Adressat*innen aussichtsreich ist, wird sie in der Fachliteratur als Ko-Produktion beschrieben. Sozialfachkräfte und Adressat*innen müssen im ›Produktionsprozess‹ erfolgreich zusammenwirken. Der Handlungserfolg im Sinne einer diskursiven Verständigung und der Umsetzung ihrer Ergebnisse in aktives Handeln entsteht in der Interaktion als das gemeinsame Ergebnis beider Akteur*innen. Sozialfachkräfte gelten hierbei in der Regel als die Produzent*innen, die Adressat*innen als Ko-Produzent*innen (Badura & Gross 1976, S. 69; Gartner & Riessman 1978, S. 21ff.).
Adressat*innen als Ko-Produzent*innen zu sehen, folgt – zunächst – keiner moralischen Grundhaltung, die der Unterwerfung von Menschen unter die Anweisungsmacht von kommunalen und staatlichen Behörden und ihren Mitarbeiter*innen entgegenwirken soll; sie ist eine Notwendigkeit, die sich nüchtern aus der Tatsache ergibt, dass ein direkter Zugriff Dritter auf die Dispositionen von Individuen (Sichtweisen, Motivation, Selbstreflexion, Handlungsbereitschaften etc.) nicht möglich ist. Menschen sind immer auch eigensinnige, durch ihre Biografie und ihre soziale Umwelt geprägte Subjekte, die über eigene Präferenzen, Überzeugungen, Alltagstheorien, Deutungsmuster und Gewohnheiten verfügen (Oelerich & Schaarschuch 2005, S. 80). Wenn Adressat*innen der Sozialen Arbeit demzufolge als Subjekte und nicht als Objekte ihnen zugedachter Angebote und Maßnahmen betrachtet werden müssen, liegt darin zugleich aber auch die moralische Verpflichtung, sie entsprechend zu behandeln, d. h. sie ihres Subjektstatus nicht durch fürsorgliche Bevormundung und ungerechtfertigte Gängelung und Eingriffe zu berauben. Damit dient das Subjektkonzept zugleich der kritischen Analyse von Verhältnissen, in denen Adressat*innen das Recht auf Eigensinnigkeit und Selbstbestimmung genommen wird, ohne dass hierfür zwingende Gründe (z. B. Selbst- oder Fremdgefährdung) vorliegen ( Kap. 1.4.2; zu ethischen Fragen des Umgangs mit anderen Menschen bei eingeschränkter Selbstbestimmung: Schmid Noerr 2021, S. 163ff.).
Schaarschuch (1999 und 2003) hat den Subjektstatus der Adressat*innen – die bei ihm Nutzer*innen genannt werden (dazu: Schaarschuch 2008) – theoretisch noch weiter zugespitzt. In dieser radikaleren Sichtweise kommt es zu einer Rollenumkehr: Die Nutzer*innen sind für Schaarschuch die Produzent*innen, Sozialfachkräfte nur Ko-Produzent*innen. Indem Nutzer*innen sich die Sichtweisen ihres Gegenübers aneignen, bewirken sie eine Veränderung ihrer Person. Die Tätigkeit der Dienstleistenden wird somit zu einem Mittel, das erst durch die aktive Anerkennung/Aneignung durch die Nutzer*innen seinen Zweck erfüllen kann (ebd., S. 156). Damit sind Nutzer*innen nicht nur Konsument*innen einer Dienstleistung, sondern auch Produzent*innen ihres Ergebnisses; Sozialfachkräfte werden zu Ko-Produzent*innen, die den Prozess der Selbstveränderung anleiten, unterstützen, begleiten und der »Produktion des Subjektes« zuarbeiten. Dadurch leisten sie einen Dienst (Oelerich & Schaarschuch 2005, S. 81).