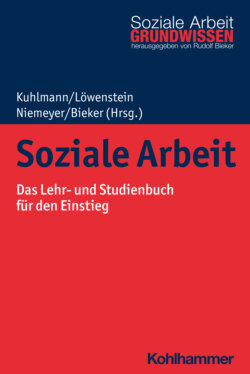Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZu diesem Buch
Soziale Arbeit ist heute ein in vielen Ländern der Welt ausgeübter Beruf, entstanden häufig aus sozialen Bewegungen und staatlicher Armutspolitik. In Deutschland hat sie sich im 19. Jahrhundert aus privater Wohltätigkeit heraus entfaltet und ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine der zentralen Säulen des im Grundgesetz verankerten Sozialstaatsprinzips. Soziale Arbeit ist immer dann gefragt, wenn andere Mittel der gesellschaftlichen Teilhabesicherung wie Geld- oder Sachleistungen nicht geeignet oder alleine nicht ausreichend sind, um nachteilige Lebenslagen zu überwinden, um Fähigkeiten zur autonomen Lebensbewältigung zu entwickeln oder wiederzugewinnen, um vor Übergriffen durch andere geschützt zu werden und Konflikte zwischen dem*der Einzelnen und der Gesellschaft in Grenzen zu halten. Wie die Soziale Arbeit die Idee der gleichberechtigten Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft in ihren wissenschaftlichen Konzeptionen, in ihren Methoden und rechtlichen und sozialpolitischen Fundamenten aufgreift, ist Gegenstand dieses einführenden Bands.
Zu den Beiträgen des Bandes
Im Beitrag von Rudolf Bieker ( Kap. 1) geht es um eine grundlegende Einführung in den Gegenstand und die Funktionen Sozialer Arbeit. Soziale Arbeit wird als eine gesellschaftlich gewollte, sozialstaatlich institutionalisierte Dienstleistung markiert, die sich auf der Grundlage theoretischer Konzepte und professionstypischer Methoden um individuelle und zwischenmenschliche Probleme und Lebenslagen kümmert, für deren Bearbeitung eine öffentliche (Mit-)Verantwortung anerkannt ist oder begründet werden kann. Der Beitrag geht der Frage nach, welche Strukturmerkmale die Dienstleistung Soziale Arbeit charakterisieren und ob sie neben den ihr staatlicherseits zugedachten Funktionen der Hilfe und der sozialen Kontrolle nicht auch ein weitergehendes sozialpolitisches Mandat übernehmen muss, um soziale Benachteiligungen zu vermeiden und soziale Gerechtigkeit zu fördern.
Im Anschluss an diese Einführung rekonstruiert Carola Kuhlmann die Geschichte der Ausbildung und des Berufs der Sozialen Arbeit von der zunächst ehrenamtlich ausgeübten »Liebesthätigkeit« und Armenpflege bis heute ( Kap. 2). Der Beitrag führt zunächst über die Etablierung von Fürsorger*innen im Weimarer Wohlfahrtsstaat zur Mittäterschaft an menschenverachtenden Fürsorgepraxen der »Volkspflege« nach 1933 bis zur Sozialfürsorge der DDR. Anschließend werden die Demokratisierung durch verschiedene soziale Bewegungen nach 1968, die Akademisierung des Berufs sowie die Ökonomisierung der Praxis nach 1990 ausgeführt und heutige Perspektiven der Entwicklung vorgestellt. Dabei werden in diesen Phasen die theoretischen (z. B. von der Lebenswelt- zur Dienstleistungsorientierung) und die praktischen Entwicklungen sowie die sich ändernde Sicht auf die Klient*innen herausgearbeitet. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte soll dabei zu einem vertieften Verständnis von sich wandelnden Interpretationen von Armut und Hilfsbedürftigkeit verhelfen wie auch dazu, ›klassische‹ Probleme zu erkennen, mit denen die Soziale Arbeit konfrontiert wurde und wird: Armut, häusliche Gewalt, Kindesvernachlässigung, Sucht, Behinderung, soziale Isolation usw.
Als Profession stützt sich die Soziale Arbeit notwendigerweise auf wissenschaftliches Wissen, um ihre anspruchsvollen Problemstellungen systematisch analysieren und bearbeiten zu können. Vor diesem Hintergrund skizziert Heiko Löwenstein in seinem Beitrag über »Wissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit« ( Kap. 3) den aktuellen Stand der Diskussion um Soziale Arbeit als Profession und als wissenschaftliche Disziplin, um davon ausgehend in Theoriediskurse Sozialer Arbeit einzuführen. Allgemein lässt sich von einer Theorie sprechen, wenn einzelne wissenschaftliche Erkenntnisse logisch zueinander in Bezug gesetzt und verdichtet werden können. Anhand spezifischerer Kriterien lassen sich explizite Theorien Sozialer Arbeit von Theorien anderer wissenschaftlicher Disziplinen wiederum unterscheiden. Aktuell existiert in der Sozialen Arbeit eine kaum mehr zu überblickende Zahl an unterschiedlichen Fachkonzepten und Theorien. Um diese Vielfalt zu strukturieren, übersichtlicher zu gestalten und eine erste Orientierung zu geben, wird eine Typologie entwickelt, die fallorientierte, lebensweltorientierte, feldorientierte und systemorientierte Ansätze voneinander unterscheidet. Indem in die jeweiligen theoretischen Grundannahmen entlang der zentralen theoretischen Anschlussstellen eingeführt wird, soll ein erstes Fundament für eine tiefergehende Auseinandersetzung im Laufe des Studiums gelegt werden. Soweit es das Verständnis unterstützt, werden theoriegeschichtliche Einordnungen vorgenommen. Um dafür zu sensibilisieren, dass aus verschiedenen theoretischen Orientierungen auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der Praxis Sozialer Arbeit resultieren, werden erste Hinweise gegeben, welche Konsequenzen sich für das methodische Handeln am Fall, in der Lebenswelt, im Feld und mit Systemen ergeben können.
Der Beitrag leitet damit zu den Methoden der Sozialen Arbeit über ( Kap. 4). Wie schon zuvor von Heiko Löwenstein postuliert weisen auch Anne van Rießen und Michael Fehlau eingangs auf die Theoriebezüge methodischen Handels in der Sozialen Arbeit hin. Am Beispiel der Jugendberufshilfe verdeutlichen sie sodann die Relevanz eines integrierten und zugleich partizipatorisch ausgerichteten Methodenverständnisses, das den Einsatz von Methoden als spezifische Handlungsformen an den jeweiligen Kontext des Handelns bindet und damit Offenheit verlangt. Nach diesen Vorklärungen führen die Autor*innen in elf ausgewählte Methoden ein, die das Repertoire der Vorgehensweisen Sozialer Arbeit heute weithin bestimmen. Sie folgen dabei einem eigenen Ordnungsversuch, der die überkommene Dreiteilung der Methoden in Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit – ergänzt um professions- und organisationsbezogene Methoden – als strukturbildenden Ausgangspunkt nutzt. Präsentiert werden u. a. die Methoden Soziale Diagnostik, Beratung, Soziale Netzwerkarbeit, Supervision und kollegiale Beratung sowie (Selbst-)Evaluation. Die Verfasser*innen zeigen auf, wie die alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringende Digitalisierung auch das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit immer stärker verändert. Welche Ergebnisse dieser hochdynamische Prozess zeitigen wird, ist gegenwärtig noch kaum abschätzbar. Methodisches Handeln muss auf Seiten der Adressat*innen jedenfalls neben den Inklusionschancen auch die Exklusionsrisiken der Digitalisierung bedenken.
Professionelle Soziale Arbeit ist heute keine freiwillige und ehrenamtliche »Liebesthätigkeit« mehr, sondern trägt, eingebunden in gesetzliche Regelungen, wesentlich zur Umsetzung des in Deutschland verfassungsrechtlich verankerten Sozialstaatsprinzips bei. Hiervon ausgehend legen Heike Niemeyer und Timo Schwarzwälder die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Soziale Arbeit dar ( Kap. 5). Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen werden politische Entscheidungen getroffen, die ihren Ausdruck in Gesetzen, Gesetzesänderungen und -reformen finden. Somit stehen Sozialpolitik und Sozialrecht in enger Wechselbeziehung zueinander und haben entscheidenden Einfluss auf die konkreten Voraussetzungen vor Ort, unter denen Soziale Arbeit stattfindet.
Überwiegend wird Soziale Arbeit heute in einem Beschäftigungsverhältnis ausgeübt, für das neben dem allgemeinen Arbeitsrecht meist tarifvertragliche oder ähnliche Regelungen gelten. Diese können sich je nach Trägerschaft der Arbeitgeber*innen und Organisation der Arbeitnehmer*innen unterscheiden. Welche Sicherheiten, Besonderheiten, aber auch Lücken diese Regelungssysteme aufweisen, wie demzufolge die Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit beschaffen sind, beschreiben Heike Niemeyer und Rudolf Bieker in ihrem abschließenden Beitrag ( Kap. 6).
| Köln und Bochum, im September 2021 | Die Herausgeber*innen |