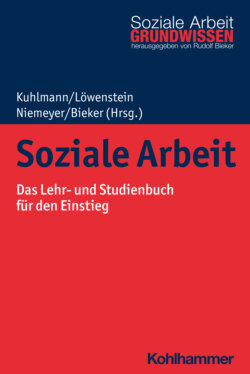Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abgrenzung zu marktförmigen Dienstleistungen
ОглавлениеSich am Subjekt bzw. den Adressat*innen zu orientieren (ihren Sichtweisen, Bedürfnissen, Prioritäten) ist nicht nur eine Notwendigkeit und ein ethisches Postulat moderner Sozialer Arbeit, sondern – bekannt unter dem Begriff Kundenorientierung – auch ein zentrales Leitprinzip des Wirtschaftslebens. Während Soziale Dienste und Einrichtungen durch mangelnde Adressat*innenorientierung mangelhafte Wirksamkeit und vermeidbare Folgekosten produzieren, gefährdet fehlende Kundenorientierung von Wirtschaftsunternehmen im Extremfall sogar ihren Fortbestand. Kunden- bzw. Marktorientierung sind deshalb das A und O jeder kommerziellen Wirtschaftstätigkeit. Wenngleich die Grundperspektive vergleichbar ist – Angebote müssen sich am Bedarf der Kunden/Adressat*innen ausrichten –, sind die Dienstleistungskonzepte zwischen markttätigen Unternehmen und Sozialer Arbeit nicht gleichzusetzen (Oechler 2009, S. 73). Versuche Mitte der 1990er Jahre, die kommunalen Verwaltungen (und damit auch die Ämter der Sozialverwaltung) in einem kommerziellen Verständnis zu »kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen« umzubauen, konnten daher nicht überzeugen (KGSt 1994; Bieker 2004).
Kommerzielle Dienstleister bedienen ihr Eigeninteresse an einem Geschäftsabschluss. Dienstleistungen der Sozialen Arbeit haben ihren Erfolgsmaßstab dagegen in der Fremdnützigkeit des Handelns. Zwar könnte Sozialarbeiter*innen grundsätzlich gleichgültig sein, ob es ihnen gelingt, Adressat*innen von der Notwendigkeit einer Therapie oder dergleichen zu überzeugen, dagegen stehen aber der sozialstaatliche Auftrag sowie professionstypische ethische Bindungen. Diese richten sich hier auf das Wohl der*des Einzelnen und/oder das Wohl der Allgemeinheit und nicht darauf, durch bedingungslose Wunscherfüllung sich selbst einen (wirtschaftlichen) Vorteil zu verschaffen. Deshalb werden Sozialfachkräfte den Wunsch überforderter Eltern, das auffällige Kind ›ins Heim zu stecken‹, aus der Situation der Eltern heraus zu verstehen versuchen, aber nicht ohne weiteres zur Ausführung entgegennehmen. Der Auftrag der Sozialen Arbeit lautet nicht, Adressat*innen möglichst nicht zu irritieren, sie nicht auf die Unsinnigkeit und Unstimmigkeit ihres Handelns aufmerksam zu machen oder sie davor zu bewahren, Ausflüchte und Ausreden als Hindernisse einer notwendigen Veränderung zu erkennen. In der Sozialen Arbeit geht es in einem oft längerfristig angelegten Prozess der kooperativen Problembearbeitung um
• das Klären uneindeutiger und komplexer Situationen,
• das respektvolle Hinterfragen der Adressat*innensicht,
• das behutsame Einbringen alternativer Handlungsoptionen und deren Begründung,
• die Ermutigung, unbekannte Wege zu gehen,
• die Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen,
• das Erschließen von lebensweltlichen und anderen Ressourcen,
• das begründete Eingrenzen nicht erfüllbarer Ansprüche.
Solche Handlungsziele sind dem Wirtschaftsleben ebenso fremd wie Zielsetzungen, die auf die Erweiterung individueller Handlungskompetenzen oder die sozialpädagogische Förderung der Persönlichkeit gerichtet sind.
Soziale Arbeit als Dienstleistung wird zentrale wirtschaftliche Handlungsimperative zurückweisen. Sie wird ihre Leistungen vor dem Hintergrund ihrer sozialstaatlichen Beauftragung und ihrer ethischen Grundlagen auch dann erbringen, wenn diese aus wirtschaftlicher Sicht ›unrentabel‹ sind.
Die Frage z. B., ob sich Soziale Arbeit hochbetagten Menschen überhaupt zuwenden sollte, wo doch der Mitteleinsatz im Kinder- und Jugendbereich angesichts der größeren Lebenserwartung einen höheren Kosten-Nutzen-Quotienten verspricht, wäre betriebswirtschaftlich zwar konsequent, ethisch aber verwerflich.
Adressat*innen sind auch keine Kund*innen. Die Metapher »Kunde« kann zwar hilfreich sein, um Soziale Dienste und Einrichtungen in ihrer Organisationsstruktur, in ihren Angeboten und ihrem Umgang mit Menschen möglichst weitgehend an die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Adressat*innen anzupassen. Angebote sollten z. B. leicht zugänglich und vernetzt sein; sie sollten für potenzielle Nutzer*innen attraktiv sein und in der Lage sein, unbürokratisch zu operieren etc. Im Gegensatz zum kommerziellen Bereich will Soziale Arbeit aber
• ihre Angebote nicht aus Umsatzgründen soweit wie möglich ausdehnen, weitere Leistungswünsche hervorrufen, laufende Leistungen verlängern und den Kunden binden, damit er bald wiederkommt.
• nicht jeden Wunsch, für den der Kunde im Wirtschaftsleben bereit ist zu zahlen, erfüllen (ein Alkoholiker wird also keinen Schnaps als Hilfe zur Lebensbewältigung bekommen). Leistungen in der Sozialen Arbeit erfolgen auf der Grundlage rechtlicher Bestimmungen und fachlicher Beurteilungen und nicht nach Zahlungsfähigkeit. Fachlich geht es nicht darum, Adressat*innen möglichst perfekt zu bedienen, sondern um die Befähigung zur Lebensbewältigung und um Hilfe zur Selbsthilfe unter Mitwirkung/Partizipation des »Kunden«.
• den »Kunden« möglichst nicht von Eigenleistungen abhalten.
Im Wirtschaftsleben ist der Status eines Kunden im Allgemeinen durch die folgenden Merkmale charakterisiert (Bieker 2004, S. 35):
• Der Kunde tritt aktiv als Nachfrager auf den Markt; dementsprechend erfolgt ohne Nachfrage keine Lieferung. Im Rahmen seiner Möglichkeiten kann er zumeist zwischen verschiedenen Anbietern frei wählen.
• Für das zu erwerbende Produkt/die Dienstleistung erbringt der Kunde eine Gegenleistung in Form des zu entrichtenden Preises. Auf diesen kann er grundsätzlich einwirken.
• Beginn und Ende einer Geschäftsbeziehung legt der Kunde fest.
• Mit der Wahl des Angebotes übt der Kunde einen Einfluss auf Inhalt und Qualität des Angebots aus.
• Der Kunde ist von existenzieller Bedeutung für den Anbieter einer Leistung und wird daher umworben.
Einzelne Merkmale können in der Praxis zwar erfüllt sein, z. B. können Wahlmöglichkeiten bestehen, z. T. werden Adressat*innen umworben, um die Finanzierung der Einrichtung zu sichern, z. T. entscheiden die Adressat*innen darüber, ob und wie lange sie psychosoziale Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Insgesamt lassen sich die genannten Kundeneigenschaften aber nicht bruchlos auf Adressat*innen der Sozialen Arbeit übertragen. Dies liegt wesentlich in der Tatsache begründet, dass sich der Dienstleistungsauftrag der Sozialen Arbeit nicht darauf beschränkt, den Bedarf ihrer Adressat*innen zu befriedigen, sondern dass sie gegenüber ihren Adressat*innen zugleich gesellschaftliche Erwartungen erfüllen muss. Soziale Arbeit ist auch Dienstleisterin für die Gesellschaft ( Kap. 1.4.2).