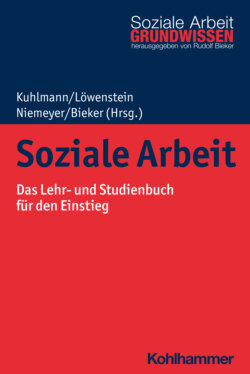Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verstehen
ОглавлениеVerstehen bedeutet nachzuvollziehen, welche Bedürfnisse und Interessen die Sichtweise des Anderen zum Ausdruck bringt und zu prüfen, ob diese gesellschaftlich anerkennungsfähig sind. Bedürfnisse können legitim sein, auch wenn die Mittel zu ihrer Verwirklichung nicht anerkennungsfähig sind. Verstehen bedeutet nicht billigen. Verstehen kann aber bedeuten, Adressat*innen Zeit für Veränderungen zuzugestehen.
Auch wenn das Verhältnis zwischen Sozialfachkräften und Adressat*innen strukturell asymmetrisch ist (z. B. durch den fachlichen Kompetenzvorsprung der Sozialfachkräfte, durch die Abhängigkeit von Hilfen, Kap. 1.3), erfordert der Subjektstatus der Adressat*innen, diesen ohne Helfer- bzw. Überlegenheitsattitüde zu begegnen und die Kommunikation so weit wie möglich auf Augenhöhe zu führen. Selbstbestimmungsrechte sind hier nicht deshalb suspendiert, weil Menschen Adressat*innen sozialstaatlicher Leistungen sind. Adressat*innen dürfen demzufolge Angebote auch ablehnen, und zwar auch dann, wenn dies aus Sicht der Sozialfachkräfte nicht ›zielführend‹ ist. Ob etwas veränderungsbedürftig ist, wo genau der Bedarf liegt und wie er zu befriedigen ist, ist nach dem Dienstleistungsverständnis nicht der exklusiven Beurteilung der Fachkraft als ›Expertin‹ überlassen, sondern Gegenstand einer diskursiven Verständigung. Bei dieser geht es weder darum, Veränderungsbedürftigkeit unwidersprochen der Selbstdefinition der Betroffenen zu überlassen noch Veränderungsbedürftigkeit aus einer Haltung fachlicher Überlegenheit für nicht verhandelbar zu halten. Die Zustimmung der Adressat*innen zu einer gemeinsamen Definition von Hilfebedürftigkeit kann hierbei als »Kriterium für eine gelungene Kommunikation« (Hamburger 2016, S. 178) gelten. Diese kann aber nicht erzwungen werden. Am Ende ist es – zumindest vorläufig – hinzunehmen, dass Adressat*innen die Deutungsangebote der Sozialfachkraft und die damit korrespondierenden Hilfsangebote ablehnen (Müller 2015, S. 54) oder noch nicht annehmen können. Allerdings kann sich die Soziale Arbeit bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Fällen nicht aus der Interaktion mit ihren Adressat*innen zurückziehen (z. B. bei Personen, die wegen einer psychischen Behinderung nicht für sich selber sorgen können und deshalb in einem gesetzlichen Betreuungsverhältnis stehen, Kap. 1.4.2).
In der Praxis sind die Fähigkeit und Bereitschaft zu einer diskursiven Verständigung auf Seiten der Adressat*innen oft nicht gegeben. Es gehört daher zum Handlungsauftrag einer subjektorientierten Sozialen Arbeit, sich um die Erweiterung dieser Fähigkeit zu bemühen. Darin steckt das Dilemma, das Recht auf Selbstbestimmung trotz der individuell eingeschränkten Handlungsautonomie zu respektieren und dieses Ziel nicht vorschnell aufzugeben (Brumlik 2020; zur praxisorientierten Auflösung dieser ethischen Antinomie: Schmid Noerr 2021, S. 163ff.).