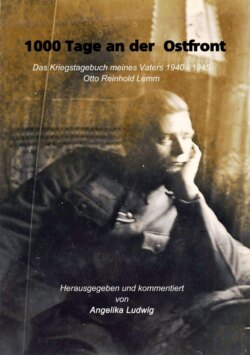Читать книгу 1000 Tage an der Ostfront - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Vormarsch in Richtung Leningrad
ОглавлениеAls der Oberleutnant und der Wagen mit den Gefallenen zurückkamen, befahl er sofort Stellungswechsel. Wir lagen nun an der Rollbahn, auf der ununterbrochen die Fahrzeuge nach Osten rollten.
Es begann nun der Vormarsch, denn der Russe begann seinen Rückzug. Wir fuhren die ganze Nacht hindurch. Erst früh um vier bezogen wir eine neue Feuerstellung. Der Vormarsch ging ununterbrochen durch Litauen hindurch. Mit ihnen standen wir ja nicht im Kriegszustand. Nach zwei Tagen bezogen wir am Abend an der Düna erneut eine Feuerstellung. Hier tauchten das erste Mal Flugzeuge des Gegners auf, die versuchten, unsere Stellungen zu bombardieren. Als sich unsere Jäger aber dazwischen stürzten, wurden wir Augenzeugen der ersten Abschüsse. Der Übergang über die Düna jedoch blieb unbeschädigt, so dass wir ohne Schwierigkeiten übersetzen konnten.
Erst am 1. Juli bezogen wir eine Feuerstellung. Mein Kollege Fritz Tofanke und ich waren gemeinsam auf der B-Stelle. Wir wurden damals in Litschen ganz zufällig Fernsprecher. Leutnant Schmidt war unser VB. Er suchte das Gelände mit dem Scherenfernrohr nach irgendwelchen Bewegungen oder lohnenden Zielen ab. Er errechnete Kommandos auf verschiedene Punkte, die wir Fernsprecher aufschrieben, Die meiste Zeit war jedoch Ruhe.
Hättest du gedacht, dass wir nach Russland ziehen? fragte ich ihn. Wenn wir uns nur nicht totlaufen, sagte er nachdenklich. Du siehst doch, es geht ganz gut vorwärts, versuchte ich ihn zu beruhigen. Ja, schon, aber denk nur nicht, dass es immer so weiter geht. Einmal ist dann Schluss damit. Der Russe muss sich doch erst fangen. Für ihn kam dieser Überfall doch völlig überraschend. Er war doch unvorbereitet.
Ehe er sich besinnt, ist er von uns überrumpelt. Wir dürfen ihm keine Zeit zur Besinnung lassen, sagte ich voller Überzeugung. Du bist sehr optimistisch, sagte Fritz. Der Russe hat große Verbündete. Und die wären? Die langen Wege, seine Armut und im Winter die große Kälte.
Im Verlaufe dieser Unterhaltung schaltete sich Leutnant Schmidt ein. Er sagte: Die heutige Kriegsführung geht davon aus, dass Russland noch vor Antritt des Winters zur Kapitulation gezwungen wird. Es liegen noch einige Monate vor uns, in denen wir versuchen werden, eine Entscheidung herbeizuführen.
Sollte es uns nicht gelingen, bis zum Eintritt des Winters unser Ziel zu erreichen, wird das OKW sicherlich umdisponieren. Der Oberleutnant Schmidt war ebenfalls zuversichtlich.
In Wirklichkeit sah das Unternehmen „Barbarossa“ vor in drei Truppenkörpern – den Heeresgruppen Nord (Leeb), Mitte (Bock) und Süd (Rundstedt) – auf jeweils einer der historischen Vormarschstraßen ins europäische Russland, in Richtung Leningrad, Moskau und Kiew zu ziehen.
„Nord“ folgte der Ostseeküste durch ein Gebiet, das vor mehr als 500 Jahren vom Deutschen Orden und hanseatischen Kaufleuten germanisiert worden war.
Die zweite Route, der Napoleon 1812 gefolgt war, verlief durch die alten, vor langer Zeit einmal polnisch-litauischen Städte Minsk und Smolensk.
Die dritte Einfallstraße wurde vom Kamm der Karpaten im Süden begrenzt und von der mittleren und nördlichen Route durch die riesigen Pripjetsümpfe geschieden. Diese Südroute führte nach Kiew, ins Schwarzerdegebiet der Ukraine, Russlands Kornkammer, weiter zu den großen Industrie- und Bergbauregionen an Donez und Wolga und zu den Ölfeldern des Kaukasus.
Auf diesen Routen sollten die Heeresgruppen nun entschlossen vorstoßen. Es war vorgesehen, dass die Panzereinheiten, unterstützt durch die Artillerie und aus der Luft, die russischen Fronten durchstoßen, so dass sie die russischen Heeresgruppen von hinten in die Zange nehmen konnten. Für die nachrückenden Infanterieeinheiten wäre es dann ein Leichtes, die eingeschlossenen russischen Verbände zu zerschlagen.
Mit Bedacht hatte man für den Angriff den trockenen Hochsommer gewählt. So waren die deutschen Verbände nicht auf ein Straßennetz angewiesen, um mit einer Vorwärtsbewegung in den Rücken des Feindes zu gelangen. Man wusste, dass die Russen die Masse ihres stehenden Heeres in das enge Grenzgebiet hinter dem schmalen und noch unvollständigen Befestigungsgürtel, der sogenannten Stalin-Linie, gepresst hatten.
Am 14. Juni standen in den östlichen und nördlichen Landesteilen Deutschlands 180 deutsche Divisionen mit annähernd 4 Millionen Mann, 3350 Panzer und 7200 Geschütze sowie 2000 Kampfflugzeuge zum Angriff bereit. Zu ihrer Unterstützung waren 14 rumänische Divisionen aufgeboten, zu denen wenig später die Armeen der Finnen, Ungarn und Slowaken hinzukamen, ergänzt um eine spanische und etliche italienische Divisionen.
Früh um sechs ging es weiter. Am 4. Juli stieß unsere Infanterie über die russisch- lettische Grenze vor. Hier befand sich die erste Auffangstellung der Russen. Sie war durch eine Bunkerlinie befestigt. Wir verspürten den ersten Widerstand.
Wir bezogen hintereinander viermal Feuerstellung, wichen zurück oder wichen nach rechts oder links aus. Dann erst ging es wieder vorwärts und wir verlebten wieder ruhige Tage.
Auf einer Wiese, die an einen Wald grenzte, bezogen wir Bereitschaftsstellung. Wir bauten Zelte auf und reinigten unsere Sachen.
Abends ließ der Spieß die ganze Batterie antreten. Den beiden Geschützführern und ihren Richtkanonieren, die in den ersten Tagen dieses Feldzuges die sowjetischen Panzer in unserer Feuerstellung abgeschossen bzw. kampfunfähig geschossen hatten, wurde für ihre mutige Tat das EK 2 verliehen. Wir freuten uns mit ihnen.
Lange dauerte diese Ruhe aber nicht, denn es ging schon am nächsten Tag weiter. Wir zogen durch Ostrow und bezogen gleich hinter der Stadt Feuerstellung. Ich war wieder mit meinem Kameraden Fritz Tofanke auf der B-Stelle. Wir bauten die Leitung und blieben auch gleich da. Hier kam unsere Batterie endlich zum Schuss. Nun hieß es, das Gelernte in der langen Zeit unserer Ausbildung, in die Tat umzusetzen.
Ich bekam zunächst von Herrn Leutnant das Kommando: Vierte Ladung Aufschlag, zwotes allein. Von Grundrichtung zehn mehr, feuern!
Nachdem das zwote Geschütz feuerbereit gemeldet hatte, rief der Leutnant: Feuern!
Abgefeuert! rief der Fernsprecher in der Feuerstellung.
Jetzt dauerte es nicht lange und wir hörten die Granate über unsere Köpfe zischen.
Leutnant Schmidt beobachtete den Schuss durch das Scherenfernrohr. Jetzt kamen die Korrekturen sowohl in der Entfernung, als auch in der Seite. Erst als der Schuss richtig im Ziel lag, schoss der Leutnant mit der ganzen Batterie. Er glaubte, eine Wirkung seiner Einschläge zu erkennen.
Des Nachts trat Ruhe ein, die auch den ganzen nächsten Vormittag anhielt. Wie nicht anders zu erwarten, kam am Nachmittag der Befehl zum Stellungswechsel.
So rückten wir durch Lettland, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Nach der Durchbrechung der Bunkerlinie an der russisch-lettischen Grenze, sind wir weiter auf lettischem Gebiet vorgerückt. Oft fuhren wir den ganzen Tag und manchmal die ganze Nacht. Oft lagen wir in der Stellung, ohne einen Schuss abgegeben zu haben.
Es war ein richtig faules Leben. So halten wir es schon aus, sagte ich und so hörte man es auch von den anderen Kameraden.
Wir bekamen gute Verpflegung und Strapazen hatten wir so gut wie keine, denn wir waren ja vollmotorisiert. Oft trafen wir auf unserem Vormarsch freundliche Leute, die uns Milch oder Butter gaben. Wir bedankten uns freundlich dafür und lachten. Wir benahmen uns überall soldatisch, besonders wenn wir sie manchmal um eine Gefälligkeit baten. Denn wir kamen ja nicht als ihre Feinde, sondern als ihre Befreier. Deshalb war uns an einem guten Verhältnis zur Zivilbevölkerung viel gelegen.
Das ging solange, bis es auf einmal nicht mehr ging. Wir erhielten den Befehl, sofort in Stellung zu gehen. Gerüchte tauchten auf, eine Bunkerlinie sei zu durchbrechen und starker Widerstand sei zu erwarten.
Die Fahrzeuge wurden rechts und links der Straße untergestellt und die Geschütze gingen am Waldrand in Stellung. Eine B-Stelle wurde eingerichtet und eine Sprechstelle in der Feuerstellung. Wir legten nur 2 km Kabel aus. Sofort begann die Batterie zu schießen. Meist schoss sie mit der vierten Ladung, das bedeutet, das Ziel liegt zwischen vier oder fünf Kilometer.
Nun kam das Kommando: Jedes Geschütz 60 Schuss bereit legen. Die Kanoniere arbeiteten fieberhaft. Sie schleppten Munition und machten die Kartuschen fertig. Diese mussten ja alle auf die vierte Ladung umgestellt werden.
Ein Geschützführer meldete schon nach kurzer Zeit: Feuerbereit! Es folgte das Kommando: Batterie feuern! Ein Donnern und Dröhnen setzte ein, das die Erde erzittern ließ.
Die Geschütze wetteiferten miteinander. Jedes schoss so schnell es ging. Die Kanoniere hielten sich die Ohren zu und machten den Mund auf. Wir Fernsprecher taten dasselbe, denn da spürte man den Druck in den Ohren nicht so, da schonte man das Trommelfell.
So wie die Batterie mit dem Trommelfeuer aufhörte, erschienen Bombenflugzeuge und Stukas am Himmel. Die Kanoniere und auch wir richteten unser Augenmerk auf das Ereignis am Himmel. Gewaltig war das Dröhnen der Bombeneinschläge und das Geheul der Stukas. Dieses Bombardement war sicher noch gewaltiger als der Beschuss durch unsere Artillerie.
Das Feuer wurde von drüben sogar erwidert. Wie war das möglich? Hatte unser Bombardement keine Wirkung gehabt oder ging die Wirkung daneben? Zunächst lagen ihre Einschläge in unmittelbarer Nähe der Feuerstellung. Das waren wir nicht gewöhnt und wir bauten sofort Deckungslöcher. Die ganze Nacht behielten wir den Stahlhelm auf dem Kopf und beim Hinlegen legten wir den Kopf in den Stahlhelm.
Interessant für uns waren die Luftkämpfe, die wir am klaren Himmel beobachten konnten. Immer wieder brachten unsere Jäger die sowjetischen Flugzeuge zum Absturz, die dann meist brennend abstürzten.
Als es gegen Abend ruhiger wurde, hieß es Stellungswechsel. Alles wurde so schnell wie möglich abgebaut und verladen. Die Geschütze wurden auch abmarschbereit gemacht. Zugmaschinen fuhren ein und bald darauf kamen die Fernsprecher mit dem Kabel. Der B-Wagen kam und wurde auch verladen. Der Tross stand auch schon marschbereit auf der Straße. Nun zogen die Fahrer der Zugmaschinen die Geschütze heraus, dann folgten B-Wagen und die Muni-LKWs.
Es ging in eine neue Feuerstellung. Um uns herum brach die Nacht herein. Alles dachte an Schlaf, aber damit wurde es heute nichts. Wir bezogen nach einer kurzen Fahrt eine neue Feuerstellung. Alles wurde eingerichtet. Die Geschütze mussten ordnungsgemäß stehen, sie wurden ausgerichtet, die B-Stelle musste ausgesucht werden und eine Leitung gelegt werden. Ein Melder brachte uns zur B-Stelle, die glücklicherweise nur drei Kilometer vor der Feuerstellung lag. Auf seinem Motorrad nahm er sogar unsere Decken mit.
Die Nacht verlief ruhig und am nächsten Tag schossen wir zur Unterstützung der Infanterie.
Unsere B-Stelle war in einem alleinstehenden Gehöft untergebracht, von wo man einen guten Einblick in eine weit ausgedehnte Moorlandschaft hatte. Die Bewohner waren sehr freundlich und gaben uns große Mengen von Butter und Milch.
Erst am Mittag ging es weiter. Wir fuhren nur zehn Kilometer und gingen sofort in eine neue Feuerstellung.
Am nächsten Tag hatte ich frei und hielt mich in der Protzen-Stellung auf, die an einem kleinen Bach lag. Diese Gelegenheit nutzten wir, mein Kamerad und ich, wir badeten nach Herzenslust, wuschen unsere Wäsche und brachten auch unsere Sachen in Ordnung. Es war auch einmal schön, in der Sonne zu liegen und nur an sich selbst zu denken.
Am Abend saßen wir gemütlich vor unseren Zelten und sangen Volks- und Heimatlieder. Ein Kamerad vom Tross begleitete uns dabei mit einer Gitarre. Fast alle Kameraden vom Tross saßen mit uns auf einem Haufen und wir sangen nacheinander ein Lied nach dem anderen.
Vom Krieg war im Augenblick nichts zu merken. Diese Ruhe dauerte auch noch den ganzen nächsten Tag. Wir liefen in Badehosen herum und fühlten uns wie im Urlaub. Nebenbei machten wir Bratkartoffeln und auch Puffer.
Diese Schilderungen zeigen nur zu deutlich, wie gern die Soldaten den Ernst der Lage vergessen wollten. Obwohl sie bereits die Bombardierung einzelner Frontabschnitte erlebt hatten, gab man sich gern der Illusion hin, dass der ganze Krieg ein siegreicher Vormarsch sein könnte, der mit dem schnellen Erreichen des Ziels vorbei sein würde. Es ist auch noch Sommer und man ist noch nicht in Russland, wo man einer feindlich gesonnenen Bevölkerung gegenüber stehen wird.
Am 12. Juli ging es dann weiter. Wir fuhren Richtung Leningrad. Tag und Nacht saßen wir jetzt wieder auf unseren Fahrzeugen, die abwechselnd fuhren und dann wieder stundenlang standen. Bei jedem Halt stiegen wir aus und streckten uns im Grase aus. Wir fuhren durch Wälder und Felder, durch kleinere Ortschaften und auch Städte, deren Namen man sich nicht immer merken konnte, zumal die Beschriftung oft nur russisch war.
Hielten wir einmal in einem Walde, dann suchte alles nach Blaubeeren oder Erdbeeren, die es hier in reichem Maße gab.
Am sechsten Tag dieser Fahrt hatte unser B-Wagen einen Federbruch. Der Fahrer scherte aus und besah sich den Schaden. Federbruch, sagte er zum Kradmelder, der bei uns hielt. Das kann lange dauern. Ich wechsle das Teil selbst aus. Wilhelm, unser Fahrer fing an zu bauen.
Auf der Straße rollte es unentwegt weiter. Vorbeirollende Panzer ließen die Straße erzittern. Alles fuhr Richtung Osten.
Als wir am nächsten Vormittag wieder fahrbereit waren, kam uns auf halbem Wege schon der Kradmelder entgegen. Die Batterie steht bereits in Stellung, sagte er. Die Fahrzeuge stehen 20 km von hier rechts im Walde. Wir fuhren zunächst zur Protze, denn der andere Wagen hatte ja die Leitung schon gebaut. Wir lagen hier an der Luga, auf deren jenseitigem Ufer der Russe starke Befestigungen angelegt hatte. Er beschoss uns mit Waffen aller Kaliber.
Unsere Infanterie hatte es schwer, denn der Russe war auf alles vorbereitet. Dieses war der äußere Ring um Leningrad. Sofort wurde auch der Fernsprechtrupp eingesetzt, denn die Leitung war zu oft gestört. Unsere B-Stelle war in einem kleinen Haus untergebracht, das in einem Garten stand. Das Haus lag am Rande einer größeren Ortschaft. Fünfhundert Meter vor der B-Stelle war ein Waldrand, auf den besonders geachtet werden musste. Der Wald war zwar schon in deutschem Besitz, aber man konnte nicht wissen. Unsere Infanterie hatte den Wald durchkämmt und lag dort in Stellung. Immer wieder ertönte Gewehr- und MG-Feuer im Ort. Überall patrollierten die Landser mit schussbereiter Waffe. Sie trugen den Stahlhelm auf dem Kopf und ihr Sturmgepäck auf dem Rücken. An ihrem Koppel hingen mehrere Handgranaten.
Leutnant Schmidt hatte sich mit dem Scherenfernrohr im Dachgeschoss eingerichtet, während die Fernsprecher im Parterre saßen. Sie hatten eine Stichleitung nach oben gelegt. Nachts krochen alle in den Keller des Hauses, wo sich die Fernsprecher ein richtiges Lager eingerichtet hatten.
Wir hatten uns alle zur Ruhe begeben. Nur ein Fernsprecher wachte am Apparat.
Als es kaum richtig hell geworden war, wurden wir durch einen ohrenbetäubenden Knall aus dem Schlaf gerissen. Jeder von uns griff zu den Waffen und eilte ins Freie. Da hatten wir die Bescherung! Auf der Straße war eine riesige Staubwolke, sicherlich durch eine Explosion entstanden.
Es knallte ja immer noch. Was ist denn passiert? Hundert Meter von unserem Haus entfernt, war mitten auf der Straße ein sowjetischer Panzer explodiert. Trotz erhöhter Wachsamkeit der Infanteristen, trotz Lauscher und Späher, war es einem sowjetischen Panzer doch gelungen, in die Ortschaft vorzudringen. Plötzlich war er da. Die Pak schoss sofort und machte ihn bewegungsunfähig. Aber hier noch konnte er für uns gefährlich werden.
Da schlich sich ein beherzter Mann von der Infanterie von hinten an den Panzer heran. Er hatte eine geballte Ladung in der Hand. Er sprang auf den Panzer, drückte die Luke auf und schob die geballte Ladung hinein.
Blitzschnell sprang er herunter und brachte sich in Sicherheit. Dann erklang der ohrenbetäubende Knall. Die Explosion zerriss den Panzer mitsamt der Besatzung in viele winzige Teile. Nun war es die mitgeführte Munition, die immer noch knallte. Vom Panzer war nicht viel zu sehen, lediglich die Stelle, wo er gestanden hatte. Verbrannt waren auch die Häuser und Gärten neben der Straße und von Splittern durchsiebt.
Staunend standen wir da und bestaunten das gewaltige Werk der Vernichtung. Nur einige größere Teile des Panzers lagen noch herum, sonst war von dem Riesenkoloss nichts mehr zu sehen.
Das war für die sowjetische Panzerbesatzung ein schneller Übergang vom Leben in den Tod. Warum nur wagte er sich denn so weit vor? Glaubte er, er könne durch seine mutige Tat den Krieg zu seinen Gunsten entscheiden? Oder was war der Anlass zu seinem spontanen Handeln?
Nur kein falsches Heldentum, so ging es mir jetzt durch den Sinn. Das führt zu nichts, außer zur Katastrophe.
Nach einer Woche war der Kessel an der Luga immer noch nicht bereinigt. Ja der Kampf erschwerte sich sogar. Der Russe hatte unsere Feuerstellung ausgemacht und hatte einige Treffer in unserer Feuerstellung gelandet. Nun hieß es umziehen. Das hatten ja die Kanoniere oft genug geübt. Die Fernsprecher mussten die Leitung vollkommen umbauen.
Während die Heeresgruppe Mitte im Kessel von Smolensk die sowjetische 16., 19. Und 20. Armee aufrieb, beschleunigte die Heeresgruppe Nord entlang der Ostseeküste ihren Vormarsch auf Leningrad. Anfänglich hatten Seen, Wälder und Flüsse das Vordringen von Leebs Panzerspitzen verzögert. Obgleich ihm nur drei Panzerdivisionen zur Verfügung standen und ihm keine so spektakulären Einkreisungen gelangen wie Bock, hatte die Heeresgruppe Nord am 30. Juni Litauen besetzt und sicherte Brückenköpfe jenseits der Düna, wo man den Verlauf der Stalin-Linie vermutete. Rasch überwand die Panzergruppe 4 den Fluss, erreichte Ostrow an Lettlands Vorkriegsgrenze mit Russland und stand 10 Tage später an der Luga, dem letzten größeren Wasserhindernis 100 km vor Leningrad.
Die Heeresgruppe Nord hatte ihre konzertierten Anstrengungen zur Einnahme Leningrads am 8. August mit einem energischen Angriff auf die Luga begonnen, an der sich die vordersten Verteidigungsstellen der Stadt befanden. Parallel dazu war eine deutsch-finnische Offensive über die Karelische Landenge geplant.
Aber Leebs Offensive wurde durch drei Faktoren erschwert.
Erstens, wurde Leningrad im Rücken vom Ladogasee, einer riesigen Wasserfläche, geschützt, wodurch jeder nördliche Umfassungsversuch unmöglich war.
Zweitens hatte das Leningrader Truppenkommando die Stadtbevölkerung mobilisiert, um konzentrische Verteidigungsringe um die Stadt zu legen. Dazu gehörten 1000 km Erdwälle, 650 km Panzergräben, 600 km Stacheldrahtverhau und 5000 Bunker- eine ungeheure Arbeitsleistung, zu der 300 000 Komsomolzen und 200 000 Zivilisten, Frauen wie Männer, herangezogen worden waren.
Als dritter erschwerender Faktor kam hinzu, dass das finnische Heer oberhalb des Ladogasees stehenblieb, da es nicht mehr Gebiet besetzen wollte, als ihm zustand. Daher war Hoepners Panzergruppe 4 bei dem Versuch, die Befestigungsanlagen zu durchbrechen und die Stadt einzunehmen, auf sich allein gestellt.
Wir errichteten eine Zwischenstelle in einem tiefen Bunker, der von den Russen bereits angelegt war. Er lag im Walde in einer tiefen Schlucht und hatte seinen Ausgang nach Osten, also nach der Feindseite. Dieser Wald wurde von der russischen Artillerie besonders scharf bewacht und unter Feuer genommen. Es klang unheimlich, wenn die Einschläge in unserer Nähe niedergingen. Wir waren drei Mann mit dem Staffelführer, und einer machte dem anderen Mut.
Als wir nach vier Tagen wieder in der Feuerstelle waren, begann die russische Artillerie wieder zu schießen. Die Einschläge waren verdächtig nah. Plötzlich bekam unser B-Wagen einen Volltreffer in den Führersitz. Er stand dicht an einem Gebäude. Wir erschraken und warfen uns spontan auf die Erde. Zum Glück saß kein Fernsprecher im Wagen und es wurde auch keiner verletzt.
Nun hatten wir nur noch einen B-Wagen, denn der getroffene wurde abgeschleppt. Den sahen wir nie wieder.