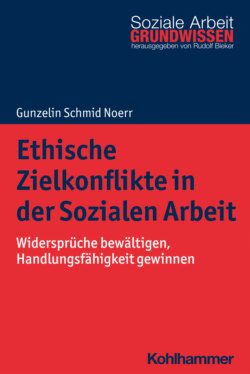Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Suspendierung und Umdeutung von Moralfragen
ОглавлениеOft genug sind es Klagen über die Verletzung moralischer Erwartungen an Andere, die Klienten in Beratungssituationen vorbringen. Sie suchen Hilfe gegenüber den Zumutungen Anderer. Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe wird aber in erster Linie die Klientinnen zur Selbstaufklärung zu bringen versuchen, auch weil ihnen dies am ehesten helfen wird, ihre Interessen mit dem richtigen Maß und auf die richtige Weise vertreten zu können. Die vorangegangene Schilderung der Suchtberaterin Else Wickert zeigt nicht nur die berechtigte Ablehnung des Moralisierens, sondern auch einen offenbar mit guten Gründen vorgenommenen psychologischen Umgang mit Moralfragen, den man als deren Umdeutung bezeichnen könnte. Sie beantwortet die selbst gestellte Frage nach dem psychischen Gewinn der moralisierenden Anklage mit einem dadurch aufrechterhaltenen Sicherheitsgefühl:
»Die Mutter hat die Tochter schon nicht losgelassen, die Tochter will das Kind jetzt bekommen, damit sie was hat, wodran sie sich festhalten kann, ne, unter anderem. Im Grunde genommen geht es ums Loslassen, darum, dass jeder Verantwortung für sein Leben übernimmt.«
Die Sozialarbeiterin versteht die moralischen Anklagen nicht als Bezeichnung der Ursache der zu bearbeitenden Problematik, sondern als deren Symptom: Was hat die Mutter davon, wenn sie den zukünftigen Vater ihres Enkelkindes moralisch beschuldigt? Die Antwort ist, dass sie die eigene Verantwortung verleugnet, wobei diese Verantwortung in sublimer Weise darin besteht, die Tochter in die Eigenverantwortung zu entlassen. Weiterhin wird damit aber auch deutlich, dass eine beratungstechnisch offenbar sinnvolle Suspendierung von Moralfragen nicht den generellen und langfristigen Verzicht auf diese oder gar das Außerkraftsetzen der Professionsethik bedeutet. Denn es geht sowohl bei der Mutter als auch bei der Tochter mit der (Eigen-)Verantwortungsübernahme um ein Stück moralischen Lernens.
Die entsprechende fachliche Intervention ist jedoch nicht ohne Risiko. Denn sie beruht auf einer psychosozialen Diagnose, die das Selbstverständnis der Beteiligten im Sinn einer wissenschaftlichen Verhaltenserklärung überschreitet. Die Sozialarbeiterin muss sich zutrauen, psychische Zusammenhänge zu erkennen, die den Beteiligten mindestens teilweise verborgen zu sein scheinen. Aus ihrem Expertentum leitet sie die Berechtigung ihrer Annahme über deren eigentliche Motive ab. Was aber bürgt für die Richtigkeit dieser Sichtweise? Dies kann letztlich nur die Bestätigung seitens der Beteiligten sein. Das bedeutet, dass deren Rolle nicht die von Objekten, sondern von (Co-)Subjekten einer Diagnose und der erfolgreichen Suche nach einer Problemlösung ist. Ein solcher Ansatz wird in dem folgenden Beispiel deutlich. Auch in ihm wendet die Beraterin die moralischen Klagen konsequent in Richtung einer Selbstreflexion um:
»So kann es fruchtbar sein, die geschiedene Mutter, die verzweifelt gegen die Umgangsregelung mit dem Vater ihres Kindes kämpft, zu fragen, warum dieser Umgang sie verzweifeln lässt, und umgekehrt kann es genauso fruchtbar sein, den geschiedenen Vater, der verzweifelt für ein Umgangsrecht mit seinem Kind kämpft, zu fragen, warum er eigentlich sein Kind so dringend zu sehen wünscht.« (Finger-Trescher 2006, 145)
Aber so wichtig der Schritt der Richtungsumkehr von der moralischen Anklage zur Selbstbefragung auch ist, so wird sich die Beraterin nicht notwendig mit den Auskünften der Klienten zufriedengeben. Ihre berufliche Erfahrung und ihre wissenschaftlich gestützte Expertise geben ihr Anhaltspunkte an die Hand, um die Selbstauskünfte zusammen mit den Klientinnen zu vertiefen. Expertentum, dialogische Offenheit und ethisches Taktgefühl ergänzen und korrigieren einander.
So gibt es Handlungsweisen, die an sich ethisch-normativ klar einzuordnen sind und dennoch eine flexible, kontextsensible Umgangsweise bis hin zur Toleranz des Unmoralischen erfordern. Typisch dafür ist das Lügen, das einerseits moralisch als verletzend angesehen wird und andererseits schon in der Alltagskommunikation verbreitet ist und stillschweigend toleriert wird, weil es die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen oft erleichtert, indem andere mögliche Verletzungen konventionell verschleiert oder vermieden werden. Auch in der Sozialen Arbeit empfiehlt sich manchmal, um längerfristiger Ziele willen, ein Verzicht auf strikte Moral, wie am folgenden Beispiel des bereits zitierten Verfahrensbeistands Martin Klemke deutlich wird:
»Man kann die moralischen Dinge thematisieren, aber die Frage ist, ob das angebracht ist. […] Ein Beispiel ist, wenn Eltern lügen, das kommt ja sehr häufig vor. […] Wenn ich die Kinder frage: ›Hat die Mama es gern, wenn du zum Papa gehst?‹, kommt von den Kindern immer die Spontanantwort: ›Nein‹. Kinder denken ja nicht um zehn Ecken. Und die Mütter sagen dann meistens: ›Ich habe nichts dagegen, wenn er zu seinem Vater geht.‹ Daraufhin sage ich: ›Das Kind hat aber gesagt, dass Sie es auch nicht gernhaben.‹ Und dann ist Stille. Da sage ich dann auch nicht: ›Sie haben aber gelogen.‹ Unter Erwachsenen gehört sich das nicht. Das kann ich mit meinem Beruf nicht vereinbaren. Es ist ja auch so, dass das Gesetz manchmal sogar das Lügen erlaubt. Nehmen Sie als Beispiel doch einmal den Angeklagten. Der Angeklagte braucht nicht die Wahrheit zu sagen, der darf lügen, und es wird akzeptiert.«
Hier scheint sich der Unterschied zwischen lebensweltlicher Moral und Berufsethik ein Stück weit aufzulösen, in denen beiderseits das Lügen, obwohl es manifest negativ sanktioniert wird, latent dennoch kontextabhängig toleriert wird. Aber die Gründe dafür sind doch unterschiedlich. Während es im ersten Fall vor allem um ›Gesichtswahrung‹ geht, kommen im zweiten Fall Grundsätze des professionellen Auftrags mit ins Spiel. So muss der Verfahrensbeistand in hinreichend umfassender Weise sich über die Lebensumstände und Interessen des Kindes informieren können.
Moral ist eine Gesamtheit von Werten, Normen und Tugenden, die für Einzelne, Gruppen, oder Kulturen orientierende und handlungsanweisende Funktionen haben. Insofern spielt sie in jeder Lebensäußerung und jeder Interaktion eine manchmal offene, meist jedoch eher versteckte Rolle. Mit der dem Faktischen in gewisser Weise übergeordneten Funktion der Anleitung und Rechtfertigung ist sie auch in extremer Weise missbrauchsanfällig. Indem sie Allgemeines beansprucht, Pflichten einfordert, höhere Ideale beschwört, lenkt sie vom praktisch sich Aufdrängenden und Erforderlichen allzu leicht ab und erlaubt es, dass wir uns Andere oder sogar uns selbst über Wünsche, Ängste und andere verschwiegene Regungen hinwegtäuschen können. Diese Erkenntnis liefert für die meisten Formen von Psychotherapie und Beratung heute ausreichend Gründe, die Moral sozusagen nur mit spitzen Fingern anzufassen, obwohl sie die Moral weder als Problemgebiet leugnen noch selbst auf professionsethische Grundsätze verzichten können oder wollen. Zur professionellen moralischen ›Abstinenz‹ hier beispielhaft nur ein methodologisches Zitat aus Carl Rogers’ Grundsätzen der nicht-direktiven Beratung:
»Moralische Werte gehen in diese Art der Therapie nicht ein. Die positiven Gefühle werden ebenso als Teil der Persönlichkeit akzeptiert wie die negativen. Dieses Akzeptieren sowohl der reifen wie der unreifen Impulse, der aggressiven wie der sozialen Einstellungen, der Schuldgefühle wie der positiven Äußerungen bietet dem Individuum zum ersten Mal in seinem Leben Gelegenheit, sich so zu verstehen, wie es ist.« (Rogers 1972, 46)