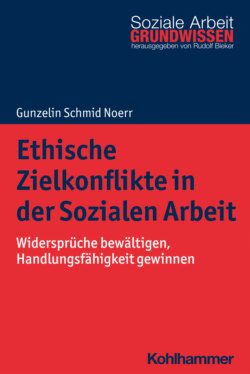Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Soziale und ethische Antinomien
ОглавлениеDie Ethik bringt die möglichen Unterschiede und Widersprüche zwischen den moralischen Werten und Normen zur Sprache, die auf der Ebene der Moral selbst eher unmittelbar ausgefochten oder verdrängt werden. Sie verfolgt damit die Absicht der Klärung, Schlichtung und begründeten Orientierung. Moralische Werte und Normen sind immer auch Ausdruck einer Lebenswirklichkeit und der darin verankerten Ansichten, Bedürfnisse und Erwartungen. Da diese je nach individuellen und sozialen Bedingungen unterschiedlich, ja gegensätzlich sein können, kommt es auch zu entsprechend unterschiedlichen Werten und Normen.
Zur Zeit der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Sozialgesetzgebung, diese kam in Deutschland erst in den 1880er Jahren unter dem damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck auf, während bis dahin sich vor allem die Kirchen um die Fürsorge von Armen und Kranken gekümmert hatten. Mit dem neuen Reichtum der Produzenten, Händler und Finanziers entstand um die industriellen Zentren herum auch massenhaft neue Armut. Bismarck wolle damit vor allem sozialen Unruhen, vielleicht gar einer Revolution des von Armut und Elend bedrohten Proletariats vorbeugen. Nach und nach wurden Nothilfen eingerichtet und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber den Fabrikanten reguliert. Noch einige Jahre zuvor hatte Karl Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital (1867) über die Auseinandersetzungen um die Länge des Arbeitstages geschrieben:
»Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer [der Arbeitskraft], wenn er den Arbeitstag so lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. […] der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warentausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.« (Marx [1867] 1968, 249)
Marx spricht von einer »Antinomie« (Unvereinbarkeit von Gesetzen), wobei er sich auf das ökonomische »Gesetz des Warentausches« bezieht, bei dem zwei Partner Waren tauschen, indem sie jeweils so viel wie möglich zu erlangen suchen, wofür sie so wenig wie nötig geben müssen. Unter Bedingungen der beiderseitigen Freiheit von Angebot und Nachfrage der Ware Arbeitskraft wird der Tausch bei einem einigermaßen gerechten Mittelwert erfolgen oder, wenn die Erwartungen zu weit auseinanderliegen, nicht zustande kommen. Nur gab es in der Realität der ungleichen Ausgangslagen diese Freiheit kaum. Deshalb spricht Marx hier von Gewalt als Mittel der Entscheidung über ökonomische Antinomien im Kampf der sozialen Klassen.
Der frühe Kapitalismus konnte sozialstaatlich ein Stück weit gebändigt, die Verelendung der Massen zurückgedrängt werden. Damit verschwanden freilich nicht die praktischen Antinomien. Die Interessengegensätze, Widersprüche in den Ansichten, Unterschiede in den sozialen Lagen blieben bestehen. Durch die Einbindung der arbeitenden Bevölkerung in die Industrie wurden die traditionellen Familien- und Verwandtschaftsstrukturen aufgelöst, und damit zerfielen auch die überkommenen Hilfestrukturen. An ihre Stelle trat nun die Soziale Arbeit, als Teil des Sozialstaatsregimes. Infolgedessen hatte auch sie es immer wieder mit der Bewältigung von praktischen Antinomien zu tun. Der ihr innewohnenden Ethik entsprechend, ersetzte sie reale oder drohende Gewaltverhältnisse durch Vereinbarungen.
Von dieser Herkunft zeugt die sie bis heute bestimmende Grund-Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle. War ihr herrschaftlich vorwiegender Zweck die Kontrolle der aus den Kreisläufen der Normalität Herausgefallenen oder Ausgeschlossenen, so war doch dieses Ziel nachhaltig allenfalls dadurch zu erreichen, dass man ihnen Hilfe zuteilwerden ließ: Hilfe zur Versorgung der Grundbedürfnisse und zur Arbeitsfähigkeit. Unbedachte, naive Hilfe konnte aber auch zur Verstärkung der Abhängigkeit führen, wie beispielhaft im Falle eines Alkoholikers, der sich mit dem ihm zugesteckten Almosen wiederum Alkoholisches kauft. In der Abwehr solchen absehbaren Scheiterns von Hilfe konzipierte man Hilfe sozialpädagogisch als Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe sollte sich selbst überflüssig machen. Schon der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1824) hatte mittels einer ganzheitlichen Bildung in Familie und Schule das Volk zu einem selbständigen und kooperativen Wirken in einem demokratischen Gemeinwesen befähigen wollen. Dieser Gedanke wurde in der Reformpädagogik wie auch in der Sozialen Arbeit weiterentwickelt. Aber auch er war nicht unberührt vom Aspekt der Kontrolle, unterschied man doch schon früh zwischen würdigen und unwürdigen Hilfsbedürftigen, wobei die ersteren sich als arbeitswillig, die letzteren als arbeitsunwillig zeigten.
Soziale Arbeit als Profession soll ihre Adressatinnen bei der Lösung von Problemen ihrer Lebensführung unterstützen. Ein »Beruf«, d. h. ein durch Ausbildung institutionalisiertes Wissen und Können, das gegen Bezahlung der Gesellschaft zur Verfügung steht, wird dadurch zu einer »Profession«, dass sich dieses Wissen und Können auf einen gesellschaftlich zentralen Wert bezieht und dass dies mithilfe von Institutionen wie Wissenschaft, Lehre, Prüfungen abgesichert wird. Im Fall der Sozialen Arbeit ist der entsprechende Terminalwert der der »Wohlfahrt«. Er kann auf zweierlei Wegen verwirklicht werden, einerseits negativ, durch Verhinderung derjenigen Umstände, die ihn gefährden, andererseits positiv, durch Verstärkung anderer Bedingungen, die ihn begünstigen. Kontrolle und Zwang gehören damit ebenso grundlegend zur Sozialen Arbeit wie Hilfe und Förderung, wenn auch ihr jeweiliges Mischungsverhältnis in den verschiedenen Arbeitsfeldern sehr unterschiedlich ist.
Die Lösung von Problemen der Lebensführung zielt darauf, das sonst als ›normal‹ geforderte Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit zu erreichen. Dieses Ziel steht in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis mit den gesellschaftlichen und natürlichen Bedingungen, die zu den Schwierigkeiten der Einzelnen wesentlich beitragen. Globale Veränderungen von Produktion, Handel und Finanzwirtschaft sowie die von Naturkatastrophen, Kriegen oder Flüchtlingsströmen ausgehenden kulturellen Verwerfungen lassen sich von den Individuen nicht oder kaum beeinflussen und schlagen doch auf ihre Lebensbedingungen durch. Betroffen sind diese allerdings in sehr unterschiedlichem Maße, je nachdem, über welche Ressourcen sie an ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital verfügen. Der Sozialen Arbeit wird dabei die Aufgabe zugewiesen, im individuellen Maßstab Probleme zu bearbeiten, die im gesellschaftlichen, ja globalen Maßstab verursacht wurden. Soziale Arbeit, die dies erkennt, intendiert sowohl Verhaltensänderung als auch (im beschränkten Maßstab) Verhältnisänderung, und kann doch nicht beides zugleich tun. In ihrer Praxis hat dies zur Folge, dass sie immer wieder Zielkonflikte bewältigen muss.
Die generelle praktische Zielvorstellung der Sozialen Arbeit besteht im Empowerment ihrer Klientel. Deren Selbstbestimmung wird vielfach durch physische und psychische Lebensbedingungen der Individuen verhindert. Das Leben unter materiell schwierigen Bedingungen, in gewaltaffinen Verhältnissen, mit Arbeits- oder Wohnungslosigkeit, mit körperlichen, psychischen oder mentalen Einschränkungen, mit Belastungen durch Krankheit und Alter, all dies verursacht bei den Betroffenen strukturelle Fremdbestimmungen. Sie sind deshalb auf besondere Rücksichten und Unterstützungen seitens der Sozialen Arbeit angewiesen, die aber nun ihrerseits allzu leicht in Fremdbestimmung umschlagen kann. Diese Fremdbestimmung muss nicht unbedingt durch fragwürdige Machtgelüste der Fachkräfte bedingt sein, sie kann auch dem Schutz der Klienten geschuldet sein. Jedenfalls stellen Selbst- und Fremdbestimmung ein zentrales Spannungsverhältnis der Sozialen Arbeit dar.
Auch in den beruflichen Ethikkodizes der Sozialen Arbeit wird regelmäßig auf derartige Spannungsverhältnisse hingewiesen. So wird zum Beispiel im Vorwort der Proklamation »Ethics in Social Work, Statement of Principles« (2005) der Berufsverbände »International Federation of Social Workers« und »International Association of Schools of Social Work« darauf hingewiesen, dass die Problembereiche, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat, folgendes beinhaltet:
• »die Tatsache, dass die Loyalität der Sozialarbeiter/-innen oft inmitten widerstreitender Interessen liegt,
• die Tatsache, dass Sozialarbeiter/-innen einerseits die Rolle des Helfers und andererseits die des Kontrolleurs ausfüllen,
• den Konflikt zwischen der Pflicht der Sozialarbeiter/-innen, die Interessen der Menschen, mit denen sie arbeiten, zu schützen, und den gesellschaftlichen Erfordernissen von Effizienz und Nützlichkeit,
• die Tatsache, dass die Ressourcen der Gesellschaft begrenzt sind.« (IFSW/IASSW 2005, 2)
Ähnlich wird im »Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz« (2010) darauf hingewiesen, dass Spannungsfelder bestehen zwischen
• »der Anordnung von bestimmten Hilfsformen durch Dritte und den Erwartungen der Klientinnen und Klienten,
• der Loyalität zu den Adressatinnen oder Adressaten und der Loyalität zu Arbeitgebenden, auftraggebenden Trägerschaften oder weisungsbefugten Behörden,
• dem Selbstbestimmungsrecht und momentaner oder dauernder Unfähigkeit der Klientinnen und Klienten zur Selbstbestimmung,
• dem Beharren auf Selbstbestimmung durch die Adressatinnen und Adressaten und der Notwendigkeit der Übernahme von Schutz und Fürsorge für die Klientinnen und Klienten durch die Soziale Arbeit,
• dem Ansprechen oder Verschweigen von Fehlverhalten und der Loyalität zu Kolleginnen und Kollegen, die den ethischen Prinzipien zuwiderhandeln,
• dem Ansprechen oder Verschweigen von Sachverhalten beispielweise bei Behörden oder Arbeitgebenden und der Anwaltschaftlichkeit gegenüber Klientinnen und Klienten,
• dem ausgewiesenen Bedarf und der Beschränktheit der Ressourcen, die zu Rationierungsmaßnahmen führt.« (Avenir-Social 2010, 7)
Die Erörterung von Zielkonflikten war seit jeher ein klassisches Feld der philosophischen Ethik und wurde dies im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts auch in der Entwicklungspsychologie, vor allem in den Forschungen Lawrence Kohlbergs (1927–1987). Dieser konnte (im Anschluss an Jean Piaget) zeigen, dass es bei der Entwicklung des moralischen Urteils bei Kindern und Heranwachsenden eine Reihenfolge in dem Sinne gibt, dass die höheren Stufen nicht ohne Durchgang durch die niedrigeren erreichbar sind. Kohlberg bestimmte diese Stufen, indem er seinen Probanden moralische Dilemmata vorlegte, in denen sie sich virtuell zu entscheiden und ihre Entscheidung zu begründen hatten. Am bekanntesten daraus wurde das sogenannte »Heinz-Dilemma«:
»Eine Frau […] war dem Tode nahe, da sie an einer seltenen Form von Krebs litt. Es gab ein Medikament, von dem die Ärzte annahmen, dass es die Rettung bringen könnte. Es handelte sich um eine Art Radium, das ein Apotheker aus derselben Stadt jüngst entdeckt hatte. Der Apotheker verlangte 2000 Dollar, das Zehnfache dessen, was ihn die Herstellung kostete. Der Ehemann der kranken Frau, Heinz, suchte alle, die er kannte, auf, um sich das Geld zu leihen. Aber er konnte nur etwa die Hälfte des Kaufpreises zusammenbringen. Er sagte dem Apotheker, dass seine Frau im Sterben lag, und bat ihn, das Mittel billiger abzugeben oder ihn später bezahlen zu lassen. Aber der Apotheker lehnte ab. Heinz geriet in Verzweiflung und brach in die Apotheke ein, um das Medikament für seine Frau zu stehlen. – Hätte der Ehemann dies tun sollen? Warum?« (Kohlberg 1996, 147 f.)
Heinz’ moralisches Dilemma besteht darin, entweder einen Einbruchsdiebstahl zu begehen, um seiner Frau zu helfen, oder das Eigentumsrecht zu achten, seine Frau aber hilflos der Krankheit zu überlassen. Der Fall erscheint einigermaßen gekünstelt. Denn welcher Betroffene würde in Wirklichkeit hier ernsthaft zwischen Eigentum und Leben ›abwägen‹? Das Künstliche kommt auch daher, dass in der individualisierten Fallgeschichte von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vollständig abstrahiert wird. Kein Wort zur Fragwürdigkeit der entsprechenden Eigentumsordnung und des Gesundheitssystems. Allerdings kommt es im Zusammenhang von Kohlbergs Untersuchungen, die allein diagnostischen Zwecken im Sinne der Zuordnung zu den Entwicklungsstufen des moralischen Bewusstseins dienen, bei der Befragung der Probandinnen zu der von ihnen präferierten Alternative nicht auf die Wahl selbst an, sondern auf die Antworten auf Nachfragen nach den Gründen. Denn daraus lässt sich auf die Kriterien schließen, nach denen die Probanden über Gut und Richtig entscheiden. Dass die geschilderte Dilemma-Situation unrealistisch ist, soll ihrer psychologisch-diagnostischen Funktion keinen Abbruch tun.
Allerdings ist in ethischen Diskursen nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Jugendlichen und Kindern wiederholt gezeigt worden, dass auch so manche andere kreative Lösung denkbar gewesen wäre, um das Dilemma zu entschärfen. Hier nur eine Lösung von vielen möglichen, die Anthony Weston erwähnt:
»[…] nehmen wir an, Heinz riefe die Zeitung an. Kaum etwas ist so wirksam wie schlechte Publicity. Auf diesem Wege ließen sich auch Spendengelder für die kranke Frau sammeln. Tausend Dollar – mehr braucht sie nicht – ist in der heutigen Welt nicht viel Geld.«
Und er betont,
»dass wir oft nur allzu bereit sind, angebliche ethische Dilemmas ohne weitere Fragen zu akzeptieren, als sei das Dilemma die einzige angemessene oder natürliche Form für ethische Probleme. Wir schließen die Möglichkeit eines kreativen Denkens aus, bevor wir überhaupt anfangen. Wir stellen enge und begrenzte Fragen, die uns – nicht überraschend – zu engen und begrenzten Antworten führen.« (Weston 1999, 54 f.)
Ein anderes, für Gerechtigkeitsfragen im Sinne Kohlbergs typisches Gedankenexperiment, das Kindern vorgelegt wurde, wird von Andreas Gruschka beschrieben: Ein Kind hat an seinem Geburtstag Kuchen in den Kindergarten mitgebracht. Nachdem alle vorhandenen Stücke gleichmäßig verteilt wurden, bleibt eines übrig, und die Frage ist nun, wer von den Anwesenden es aus welchen Gründen (ein Versprechen, besonders viel Hunger usw.) erhalten solle. Um das Dilemma zwischen der Einlösung verschiedener an sich berechtigter Ansprüche doch noch zu lösen und vor allem, um Streit und Ärger zu vermeiden, wurden nun einige kreative Ideen entwickelt (von vornherein mehr Kuchen mitbringen, das Stück wieder mit nach Hause nehmen usw.), die in der Versuchsanordnung nicht vorgesehen sind. Dabei nimmt die Bereitschaft sich zu unterwerfen mit dem Alter zu:
»Legt man älteren ein analoges Problem aus ihrer schulischen Erfahrung vor, so lässt sich in den Antworten immer weniger dieser Versuch einer aufhebenden Vermittlung der widerstreitenden Konzepte der Gerechtigkeit finden. Es setzt sich dafür zunehmend rigide die Gleichbehandlung aller gegen die Berücksichtigung individueller Unterschiede durch. Die aus dem Bedürfnis der Vermeidung von Streit und vielleicht aus der Erfahrung nicht knapper Güter im Elternhaus (alle Geschwister bekommen zunächst die gleiche Portion Eis, und wer noch einen Nachschlag will, bekommt auch den) resultierende Haltung […] zum Problem der Gerechtigkeit verflüchtigt sich fast restlos.« (Gruschka 1997, 36)
Im Unterschied zu den virtuellen Dilemma-Konstruktionen geht es in diesem Buch um ethische Antinomien, die die Praxis der Sozialen Arbeit tatsächlich prägen. Die entsprechenden Fallbeispiele dienen, anders als bei Kohlberg, nicht einer moralpsychologischen Diagnostik, sondern der Veranschaulichung und Erörterung professionsethischer Zielkonflikte. Es handelt sich nicht um derart einfache (wenn auch zwickmühlenartige) Ja-Nein-Entscheidungen wie im »Heinz-Dilemma«, sondern um ethische Spannungsfelder, die sich im Laufe der Betreuungsprozesse, also der Beziehungen zwischen Fachkräften und Klientinnen, entwickeln. In ihnen treten die möglichen Entscheidungsalternativen zumeist in unterschiedlichen Mischungen auf. Sie müssen sich nicht vollständig ausschließen, verlangen aber immer wieder neu ihre Verhältnisbestimmung. Grundsätze wie Nähe und Distanz, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung usw. mögen sich zwar begrifflich ausschließen, in der Praxis aber geht es um Wege ihrer Vermittlung, Balance oder Abwägung. Sollen diese Entscheidungsprozesse nicht allein ›aus dem Bauch heraus‹ ablaufen, sondern professionellen Ansprüchen genügen, dann bedürfen sie professionsethisch geklärter Kriterien und Abläufe.
Dabei handelt es sich um Zwangslagen, in denen man zwischen konkurrierenden oder konfligierenden, womöglich sich ausschließenden Handlungszielen zu wählen hat, die jeweils einen hohen ethischen Stellenwert einnehmen. Das bedeutet, dass man eines der Handlungsziele manchmal nur dadurch erreichen kann, dass man das andere verfehlt. Solche Strukturen können unterschiedlich bezeichnet werden:
• Spannungsverhältnis
Der Begriff ist eine Übertragung aus der Natur, in der unterschiedliche Kräfte gegeneinander wirken, wodurch bestimmte physische Effekte bewirkt werden, zum Beispiel elektrischer Strom. In psychischen und sozialen Bereichen geht es um ein Gegen- und Miteinander von Polaritäten jeglicher Art.
• Zielkonflikt
Er liegt dann vor, wenn zwei oder mehr Handlungsziele verfolgt werden sollen, die nicht gleichzeitig und im selben Umfang erreicht werden können. Ein Beispiel ist das »Magische Viereck« der liberalistischen Wirtschaftspolitik (hohe Beschäftigungszahl, Wachstum, Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht).
• Widerspruch
Es gibt logische Widersprüche im Denken und Sprechen und, in übertragener Bedeutung, sachliche Widersprüche zwischen Menschen, Prozessen, Dingen. Bilden Widersprüche eine »höhere« Einheit, werden sie als »dialektischer« Widerspruch bezeichnet. Dabei entwickelt sich aus dem Widerspruch eine neue Einheit.
• Antinomie (wörtlich: Gegengesetzlichkeit, Widerspruch der Gesetzlichkeit mit sich selbst)
Ein Widerstreit, der aus zwei gegensätzlichen, jeweils für sich gut begründeten Allgemeinaussagen (Gesetzen) über denselben Gegenstand beruht.
• Dilemma (wörtlich etwa: zweifache Einnahme, Plural: Dilemmata, auch: Dilemmas)
Die Bedeutung des Ausdrucks hat sich im Lauf der Zeit vom Positiven zum Negativen verschoben: Man kann einen Nachteil nur vermeiden, indem man sich einen anderen einhandelt. In der Ethik steht er für eine Handlungssituation mit sich ausschließenden moralischen Anforderungen, deren Einlösung in beiden Fällen zu unerwünschten Nebenfolgen führt.
• Paradoxie (wörtlich: entgegen der Meinung)
Paradox in diesem Sinn sind zum Beispiel produktive wissenschaftliche Ergebnisse, die den üblichen Erwartungen widersprechen. Darüber hinaus werden damit sich widersprechende Sinngehalte bezeichnet, die jeweils für sich gut begründet sind. Und schließlich kann eine »Paradoxie« auch darin bestehen, dass man, in dem man konsequent ein bestimmtes Ziel verfolgt, dadurch am Ende gerade das Gegenteil erreicht – ob im Guten oder (zumeist) im Schlechten.
• Antagonismus (wörtlich: Gegeneinander-Handeln)
Der Widerstreit zweier Kräfte, Objekte oder Menschen. Zumeist ist ein feindseliges Verhältnis gemeint, seltener aber auch in neutraler Hinsicht ein Verhältnis des Gegenübers.
• Aporie (wörtlich: Ausweglosigkeit) Eine Aporie ist ein Problem, das mit den vorhandenen Mitteln nicht befriedigend gelöst werden kann. Die verschiedenen Lösungen, die sich anbieten, widersprechen sich. Man kann Aporien aufzeigen, um Adressaten über ihr NichtWissen aufzuklären, oder um nach neuen Wegen ihrer Auflösung zu suchen.
• Double-Bind (Doppelbindung)
Der Ausdruck bezeichnet eine bestimmte Kommunikationsstruktur mit zwei widersprüchlichen Botschaften des Inhalts- und des Beziehungsaspekts einer Mitteilung.
Die Liste ist nicht vollständig, andere, auch umgangssprachliche Bezeichnungen lassen sich hier nennen (Konflikt, Gegensatz, Zwickmühle, Kalamität, Verlegenheit o. ä.). Offensichtlich sind die Bezeichnungen, bei teilweise unterschiedlichen Konnotationen, nicht scharf gegeneinander abgegrenzt. Welche davon eignet sich am ehesten zur Analyse der hier fokussierten ethischen Orientierungs- und Entscheidungsprobleme? Einige der Bezeichnungen haben den Nachteil, dass bei ihnen negative Konnotationen vorherrschen (Dilemmata oder Aporien enthalten eher unerwünschte als erwünschte Alternativen). Bei anderen Bezeichnungen überwiegt der logische Aspekt gegenüber dem Praxisaspekt (Widerspruch, Paradox). Die Double-Bind-Kommunikation entfaltet ihre Problematik aufgrund einer Bindung, die im professionellen Handeln der Sozialarbeit normalerweise so nicht vorliegt. Im Begriff des Dilemmas wird die Situation unmittelbar auf die Entscheidung zwischen zwei Zielen zugespitzt, wodurch die Gefahr entsteht, mögliche Wege der Integration der Gegensätze oder die Suche nach Auswegen zu vernachlässigen.
So bietet sich als Oberbegriff, vor allem mit Bezug auf die professionelle Planung von Interventionen, der Begriff des Zielkonflikts an. Er bezieht sich nicht nur unmittelbar auf die einzelne Entscheidung und Handlung, sondern auch auf das hier in Frage stehende Gegen- und Miteinander der ethischen Werte in der Sozialen Arbeit. Nicht ausgeschlossen werden soll aber, dass hier gelegentlich auch andere der genannten Bezeichnungen verwendet werden, wenn ihre Konnotationen passend erscheinen.