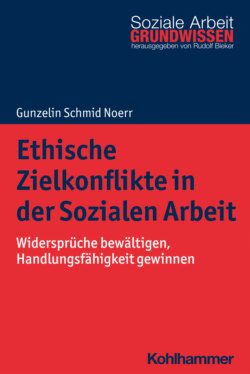Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Top-down und Bottom-up
ОглавлениеWie lassen sich nun diese Themenbereiche konzeptualisieren? Die ethische Reflexion der Sozialen Arbeit muss auf den philosophischen Ethikentwürfen der Geschichte und Gegenwart aufbauen. Dennoch kann sie nicht allein als Aufgabenstellung der Philosophie bestimmt werden. Die häufig vorkommende Rede von der Professionsethik als »angewandter Ethik« suggeriert, dass sich Erkenntnis als Einordnung des Besonderen in ein Modell der »allgemeinen Ethik« begreifen lasse.
Dass dies ungenügend ist, lässt sich an einem der bekanntesten allgemeinen Prinzipien aus der Geschichte der Ethik, Immanuel Kants »kategorischem Imperativ«, zeigen. Dessen Grundform lautet:
»Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« (Kant [1785] 1996, 51)
Kant war der Ansicht, dies sei der fundamentale und letztlich einzige Grundsatz der Moral, mittels dessen sich alle moralischen Normen ableiten ließen. Der kategorische Imperativ ist selbst keine moralische Verhaltensregel, sondern ein Prüfinstrument für solche Regeln. Dabei ging es Kant allein um die Begründung allgemeiner Handlungsmaximen. Bei ihrer Anwendung auf die konkrete moralische Praxis verstrickte er sich jedoch in unhaltbare Positionen, so bei dem überkonsequenten Verbot zu lügen, das er an dem Beispiel demonstrierte, man müsse auch dann die Wahrheit sagen, wenn man von den gewaltsamen Verfolgern seines Freundes, den man eben versteckt habe, nach dessen Aufenthaltsort gefragt werde. Der Fehler besteht darin, dass Kant hier die besonderen Umstände des Falles, die tödliche Bedrohung des Flüchtenden, ausblendet und sich prinzipienethisch zur unhaltbaren Konsequenz eines unbedingten Ehrlichkeitsgebots entschließt.
Daraus kann man ersehen, dass die Top-down-Modellierung (von oben nach unten) von Erfahrungen immer auch auf die gegenläufige des Bottom-up (von unten nach oben) angewiesen bleibt. Wer sich mit der philosophischen Begründung ethischer Prinzipien befasst, weiß allein deswegen noch nicht viel über Richtigkeit und Falschheit, Wirkung und Tragfähigkeit konkreter Entscheidungen in arbeitsteilig organisierten Berufsfeldern. Auch wenn die Philosophie ethische Grundprinzipien begründen kann, kann sie nicht von außen oder oben her der Sozialen Arbeit verpflichtende Antworten auf ethische Fragen vorgeben. Andererseits aber gelingen ethische Fallanalysen nicht ohne Bezug auf allgemeine Prinzipien, denn nur mittels ihrer lassen sich verschiedene Fälle auf das ihnen Gemeinsame hin vergleichen. Zu entscheiden, ob ein einzelner Fall eine ethische Dimension hat und welche, setzt immer schon einen Vorbegriff der entsprechenden ethischen Kategorien voraus. Wer nicht eine Idee von Respekt hat, kann einen Fall von Respektlosigkeit gar nicht erst als solchen wahrnehmen.
Das Zusammenspiel von Top-down und Botton-up trägt dazu bei, dass sich die Soziale Arbeit angesichts des fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels ethisch positioniert. Theorie und Praxis treffen sich gleichsam auf einer mittleren Ebene von Grundsätzen, die im Hinblick auf praktische Fragestellungen konkretisiert werden. Wie die individuellen ethischen Maximen sich lebensgeschichtlich als Kondensate von moralischen Erfahrungen und Gefühlen bilden, so bilden sich auch die professionsethischen Grundsätze als Abstraktionen von unterschiedlichen professionspraktischen Konstellationen.
Die Untersuchungen des vorliegenden Buches gehen weder von einer allgemeinen ethischen Theorie und ihren obersten Prinzipien (deren Wahl oft strittig bliebe) noch von den Prinzipien mittlerer Reichweite wie Nichtschaden, Wohltun oder Integrität aus. Vielmehr lassen sie sich von der sozialarbeiterischen Praxis typische Szenarien des jeweiligen Arbeitsalltags vorgeben, in denen professionsethische Fragen und Anforderungen sichtbar werden und als klärungsbedürftig erscheinen. Dabei wird deutlich, dass ethische Werte in ihrer konkreten Anwendung und Ausformung keineswegs immer ein harmonisches Ganzes bilden, sondern, wie man am Fall des Schüttelbabys ( Kap. 1.1) bereits erkennen konnte, zu widersprüchlichen Anforderungen führen können.
Die in diesem Fall entscheidenden ethischen und zugleich rechtlichen Grundsätze, die wegen ihrer weitreichenden Bedeutung im sozialen Leben zugleich auch rechtlich kodifiziert sind, sind die des Kindeswohls und des Elternrechts. Während die große Bedeutung das Elternrechts sich darin äußert, dass es in das Grundgesetz aufgenommen wurde, gilt dies (bisher noch) nicht für das Kindeswohl. Doch ist die grundgesetzliche Festschreibung des Elternrechts untrennbar auch mit der Elternpflicht verbunden, für das Kindeswohl zu sorgen, wobei der Staat über die Einhaltung dieser Pflicht wacht.
Um diese Grundsätze professionsethisch zu wahren, sind im oben zitierten Ethikkodex des DBSH die Grundsätze »Wohlwollen« und »Nichtschaden« einschlägig. Diese beziehen sich unmittelbar auf das Verhalten der professionellen Kraft gegenüber der Klientel, nämlich dem Kind, was bedeutet, dass alle Maßnahmen dazu dienen sollen, eine Verschlechterung der Lage des Kindes zu vermeiden und sein Wohl zu vermehren. Wie dies hier zu erreichen wäre, kann konkret nicht angegeben werden, solange der Sachverhalt nicht hinreichend geklärt ist. Auch ist das Wohlergehen des Kindes im weiteren Sinn durchaus mit dem Wohlergehen der Eltern verbunden, die dadurch zum Adressaten nicht nur der Kontrolle, sondern auch der Hilfe durch die Soziale Arbeit aufrücken. Damit gerät die Soziale Arbeit erneut in einen Zielkonflikt.