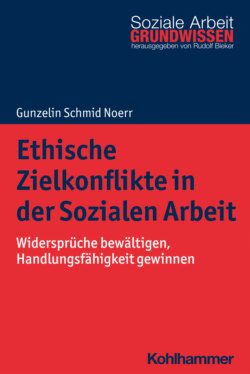Читать книгу Ethische Zielkonflikte in der Sozialen Arbeit - Gunzelin Schmid Noerr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zu diesem Buch
Оглавление»Feldgendarmen kennen immer nur zwei Möglichkeiten.« Mit diesen spöttischen Worten beschreibt Günter Grass in seinem großen Roman Die Blechtrommel (Grass 2009, 21) das Verhalten dieser Ordnungshüter in einer Entscheidungssituation: Im Jahre 1899 verfolgen zwei pommersche Feldgendarmen den flüchtenden Brandstifter Joseph Koljaiczek. Am Rande eines Ackers treffen sie auf die vor einem Kartoffelfeuer hockende Bäuerin Anna Bronski. Sie fragen sie nach dem Verbleib des Flüchtenden. Anna weist in Richtung des nächsten Dorfes. Nachdem die Verfolger den Verfolgten nicht in der Nähe des Ackers finden, machen sie sich schließlich in Richtung des Dorfes davon. Joseph aber hat sich – dies war die von den Gendarmen nicht erkannte dritte Möglichkeit – unter Annas weiten Röcken versteckt, wo er mit dieser ohne weitere Umstände das Kind Agnes, die spätere Mutter des Ich-Erzählers, zeugt.
Die Episode bezeichnet bildhaft das Thema des vorliegenden Buches: Zwei Möglichkeiten, sich zu verhalten, liegen auf der Hand. Wenn man die eine realisiert, ist man in Gefahr, die andere aus dem Blick zu verlieren. Soweit scheint die Sache klar zu sein. Der amerikanische Journalist und Publizist Walter Lippmann hat sie, wie Stephen Toulmin berichtet, zugespitzt so formuliert: »Zu jedem menschlichen Problem gibt es eine Lösung, die einfach, sauber und falsch ist« (Toulmin 1991, 321). Grass’ Gendarmen laufen einer solchen einfachen, sauberen und falschen Lösung ihres Problems hinterher. Daraus folgt: Nicht nur das wechselseitige Für und Wider ist gut zu überlegen, sondern auch, wie vielleicht eine dritte Option aussehen könnte. Denn diese könnte die eigentlich fruchtbare sein.
Auch in der Sozialen Arbeit kennt man das Gefühl gut, sich in einem Spannungsfeld der Interessen und Handlungsoptionen zu bewegen. Vielleicht ist ja die Vorstellung eines Entweder – Oder und eines erlösenden Dritten immer noch zu einfach. Dies jedenfalls deutet die Schulsozialarbeiterin Johanna Voss in einem der hier verwendeten Interviews an:
»Man hat den einzelnen Schüler, die Eltern, die Klasse, die Lehrer, und man steht da so zwischen und hat oft so die Aufgabe halt, zu gucken, wie man das miteinander in Verbindung bringt.« Das Resümee ist: »In der Sozialarbeit steht man immer dazwischen.«
Die Soziale Arbeit, als Teil eines umfassenderen sozialpolitischen Konzepts, ist ein Interventionsinstrument der Gesellschaft zum Ausgleich defizitärer Lebenslagen. Sie soll Menschen in Notlagen der verschiedensten Art zu einem jeweils besser gelingenden Alltag verhelfen. Die Soziale Arbeit stellt ein Set von Leistungen bereit, die von Hilfsbedürftigen zum größten Teil in Anspruch genommen werden, weil sie von ihrem sozialen Umfeld dazu gedrängt werden, und zu geringeren Teilen, weil sie nach ihnen freiwillig nachfragen oder weil sie ihnen gesetzlich oktroyiert werden. Gesellschaftliche Hilfeleistung und individueller Hilfebedarf greifen ineinander, freilich nicht als gleichsam gut geölte Maschinerien, sondern oft stockend, als unterschiedliche Instanzen, deren Miteinander kollektiv wie individuell immer wieder ausgehandelt werden muss.
Dementsprechend kann die theoretische Reflexion der Sozialen Arbeit grundsätzlich von zwei Seiten aus erfolgen. Einerseits kann nach ihrer gesellschaftlichen Funktion im Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, andererseits nach dem Vollzug der Praxis, der Interaktion zwischen Fachkräften und Klienten gefragt werden. Diese Doppelperspektive von System und Handlung spiegelt eine Zweiteilung der Wissenschaften vom Menschen wider, die entweder gesellschaftliche Strukturen oder individuelle Handlungen – oder auch beides in unterschiedlicher Gewichtung – in den Focus nehmen. Die Soziale Arbeit befindet sich auf der Schnittlinie beider Felder. Zwar ist sie als interaktive Praxis eine personenbezogene Dienstleistung, diese aber ist nicht möglich und kann nicht begriffen werden ohne Rekurs auf ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Auch die Ethik lässt sich in diesem Sinn entweder als Sozial- oder als Individualethik betreiben. Die Sozialethik betrachtet nicht unmittelbar die Moralität von Individuen und ihren Handlungen, sondern von sozialen Systemen, insofern sich in ihnen Normierungen des Handelns zu Institutionen verfestigt haben. Die Soziale Arbeit selbst ist eine solche Institution, insofern die Gesellschaft durch die Schaffung von Hilfeagenturen ihre Mitglieder von individuellen moralischen Verpflichtungen gegenüber Notleidenden entlastet. Die Institutionen können sozialethisch zum Beispiel daraufhin untersucht werden, ob sie den eigenen Ansprüchen auf Hilfeleistung oder Gerechtigkeit strukturell entsprechen. Dies ist etwas anderes als die individualethische Frage nach dem moralisch richtigen Verhalten in der Interaktion von Fachkraft und Klientin.
Das ehemals verbreitete Selbstverständnis der Sozialen Arbeit, eine »moralische Profession« zu sein und damit von vornherein »auf der Seite des Guten« zu stehen, ist in der Gegenwart kaum noch vorhanden. Die praktische Soziale Arbeit sieht sich heute eingezwängt zwischen den gesetzlichen Regelungen, den Vorgaben der Einrichtungen, in denen sie tätig ist, den Rahmenbedingungen seitens der Träger der Einrichtungen sowie den Bedürfnissen der Klientel. Sie hat diese verschiedenen Ansprüche unter Kriterien des fachlich Richtigen, des ökonomisch und organisatorisch Effektiven und Effizienten, des rechtlich und ethisch Zulässigen und Gebotenen zu filtern, das Unangemessene vom Angemessenen zu unterscheiden und das letztere praktisch umzusetzen.
Die Erwartungen seitens der Gesellschaft, der Einrichtungen, der Träger oder der Klientel können in besonderen Fällen untereinander und mit der Überzeugung der Fachkraft kollidieren. Diese hat sich dann nach den Maßstäben der Profession zu richten. Trotz sozialstaatlicher Steuerung kann und muss die Soziale Arbeit selbst über ihre Ziele, Mittel und Methoden entscheiden. Als Profession nimmt sie ein gewisses Maß an Autonomie in Anspruch, die sich auf ihr wissenschaftlich begründetes und methodisch bewährtes Wissen sowie ihr praktisch eingeübtes Können stützt. Die Gesellschaft stattet sie mit einem institutionellen Vorschuss an Vertrauen auf ihre Expertise aus. Diesen Vorschuss soll sie durch ihre verantwortungsethischen Grundsätze einlösen, fachliches Handeln sowohl im Sinne des Gemeinwohls als auch im Sinne des Wohls ihrer Klientel einzusetzen.
Die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit stellen ein System von Normen dar, aus denen Handlungsanweisungen abzuleiten sind. Anders die professionsethischen Grundsätze. Sie fungieren als Eröffnung eines Reflexionsraums, innerhalb dessen die Fachkräfte Ziele, Mittel, Folgen und Grenzen der Interventionen hinsichtlich ihrer Verantwortbarkeit zu bedenken haben. Die Professionsethik ist Teil der sozialberuflichen Fachlichkeit, weil sich diese auf das Alltagsleben ihrer Klientel richtet, nicht auf ein davon abtrennbares, isoliertes Problem. Diese relative Offenheit des Ethischen hängt mit der Mehrdimensionalität der Problemlagen zusammen, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat. Dabei geht es um die Bewältigung von Interessenkonflikten, von unterschiedlichen Situationsdeutungen und von widersprüchlichen Anforderungen.
So sehen sich die Fachkräfte der Sozialen Arbeit oft Situationen gegenüber, in denen sie, wie sie sich auch entscheiden, das Gefühl haben, unvermeidlicher Weise etwas falsch zu machen oder zu versäumen. Solche ethischen Zwickmühlen bestehen darin, ein Gutes nur auf Kosten eines anderen Guten verwirklichen zu können. In der alltäglichen beruflichen Praxis kann man aber nicht bei der Analyse solcher Widersprüche stehen bleiben, vielmehr müssen pragmatische Lösungen gefunden werden. Diese können zum Beispiel darin bestehen, sich auf Kompromisse einzulassen oder unerwünschte Nebenfolgen erwünschter Handlungsziele durch weitere Maßnahmen abzuschwächen oder auch einen Weg zu finden, der es erlaubt, einem solchen Dilemma von vornherein auszuweichen.
Um einen fruchtbaren wie ethisch zulässigen Kompromiss oder Ausweg zu finden, ist es zunächst erforderlich, die zugrundeliegende Problematik als »Antinomie« von Regeln oder Gesetzen zu erkennen. »Ethische Antinomien« sind dementsprechend Anforderungen prinzipieller Art, die im strikten Sinn miteinander unvereinbar sind. Dabei wird die logische Unvereinbarkeit von Anforderungen/Regeln/Gesetzen erst unter besonderen situativen Bedingungen zum Problem, die es nicht erlauben, beiden Seiten zugleich gerecht zu werden. So widersprechen sich zum Beispiel die Anforderungen von Mitgefühl und Gerechtigkeit als solche nicht. Wohl aber gibt es Situationen, in denen die eine Anforderung nur zu erfüllen ist, wenn die andere verletzt wird.
Die in der Sozialen Arbeit vielleicht am häufigsten genannte Antinomie dieser Art ist die von Hilfe und Kontrolle. Sie resultiert aus unterschiedlichen Entwicklungssträngen und Auftragslagen, die beiderseits als unverzichtbar gelten. Als sozialstaatliche Institution und im gesellschaftlichen Auftrag dient die Soziale Arbeit der Lösung, Minderung oder Prävention sozialer Konfliktlagen. Das kann bedeuten, das Verhalten von Klienten zu sanktionieren. Zugleich versteht sie sich – und das zunehmend mehr – als Hilfsangebot für Individuen in ernsthaft gefährdeten Lebenslagen. Kontrolle und Hilfe müssen sich nicht ausschließen, können aber durchaus zu unterschiedlichen Anforderungen führen, die nicht zugleich zu verwirklichen sind.
Weitere Antinomien, die sich auf das Handeln der Fachkräfte beziehen, sind zum Beispiel die folgenden:
• Nähe oder Distanz,
• Klientenwohl oder Allgemeinwohl,
• Machtgefälle oder Kommunikation auf Augenhöhe,
• Problemdiagnostik oder intersubjektives Aushandeln,
• Gerechtigkeit oder Mitgefühl,
• Aufrichtigkeit oder Rücksichtnahme,
• Direktivität oder Non-Direktivität,
• Loyalität gegenüber Arbeitgebenden oder gegenüber Klientinnen,
• Gesinnungs- oder Verantwortungsethik.
Gegen die Vergegenwärtigung von Antinomien der Sozialen Arbeit könnte eingewandt werden, dass dadurch Entscheidungen eher blockiert als gefördert werden könnten. Ist es nicht überflüssig, über Alternativen weiter nachzudenken, wenn sie alle unvermeidliche Nachteile haben? Bestünde vielleicht die beste Entscheidung darin, einer Entscheidung möglichst aus dem Weg zu gehen? Jedoch liefe eine solche Enthaltsamkeit den professionsethischen Ansprüchen entgegen, sich der Verantwortung für das eigene Handeln (oder Unterlassen) zu stellen. Gerade wenn Widersprüche nicht praktisch aufzulösen sind, macht ein entsprechendes Problembewusstsein Entscheidungen letztlich umso besser.
Die antinomischen Anforderungen, die in diesem Buch erörtert werden, sind als solche überwiegend keine spezifisch ethischen Begriffe. Von ihnen, wie zum Beispiel von Hilfe und Kontrolle oder von Nähe und Distanz, ist in Praxis und Theorie sonst eher unter psychologischen, soziologischen, kommunikationstheoretischen, sozialhistorischen und anderen Aspekten die Rede. Demgegenüber geht es hier um die ethische Bedeutung dieser Begriffe und der von ihnen bezeichneten Handlungskonstellationen. Diese Bedeutung besteht im geforderten Maß der Achtung Anderer, der Berücksichtigung ihrer legitimen Interessen und ihres Wohlergehens, der Achtsamkeit und Fürsorge.
Die antinomische Struktur der Sozialen Arbeit wurde und wird in der Fachliteratur immer wieder festgestellt. Weniger Aufmerksamkeit wird jedoch im Allgemeinen darauf verwendet, wie diese Struktur von den Fachkräften erlebt wird und wie diese mit ihr umgehen. Um diesen Mangel ein Stück weit auszugleichen, wird in diesem Buch auf entsprechende empirische Materialien in Gestalt von Transkriptionen der Interviews mit Fachkräften zurückgegriffen. Anhand dieser Protokolle werden Bedingungen und Möglichkeiten des sozialberuflichen Handelns angesichts widersprüchlicher Anforderungen reflektiert.
Ein Auswahlkriterium für die Behandlung der Antinomien in diesem Buch war ihre Gewichtung in den Interviews. Diese wurden von Studierenden (in der Regel zu zweit) mit Praktizierenden der Sozialen Arbeit im Rahmen meiner Seminarveranstaltungen zur Praxisforschung der Sozialen Arbeit an der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, durchgeführt. Das Verfahren war an die Methodik des Narrativen Interviews angelehnt, wobei die Ausgangsfrage auf den persönlichen Umgang mit ethischen Problemen in der alltäglichen Praxis gerichtet war. Die transkribierten Interviews wurden dann in der Großgruppe der Seminarteilnehmenden besprochen. Im Zusammenhang des vorliegenden Buches werden die zitierten Interviews nicht als ganze hinsichtlich ihrer verschiedenen Bedeutungsebenen interpretiert, sondern nur auszugsweise zur praxisnahen Veranschaulichung der theoretischen Fragestellungen verwendet. Als unveröffentlichte Typoskripte werden sie nicht bibliographisch nachgewiesen. Sie sind selbstverständlich anonymisiert, die Namen der Interviewten wurden zufällig gewählt. Mit den Kursivierungen werden betonte Wörter wiedergegeben. Den interviewenden Studierenden wie auch den interviewten Fachkräften sei hiermit herzlich gedankt.
Über die Verwendung von weiblichen und männlichen Sprachformen in öffentlichen Diskursen einschließlich wissenschaftlichen Texten ist viel gestritten worden und wird weiterhin diskutiert. Einerseits sind Bezeichnungen wie »Sozialarbeiter« oder »Klient« Gattungsbegriffe. Sie haben, wie andere Wörter auch, ein grammatisches Geschlecht, das in der großen Mehrzahl ohne Bezug zum biologischen Geschlecht steht. Sie beziehen sich auf Menschen, die durch geschlechtsunabhängige Kriterien wie Beruf oder institutionelle Funktion gekennzeichnet sind. Von daher ließe sich die entsprechende traditionelle Redeweise rechtfertigen, die sich in vielen Fällen aufs männliche generische Geschlecht beschränkt.
Andererseits werden solche Bezeichnungen aber auch als Individualbegriffe verwendet, die in einem gegebenen Zusammenhang bestimmte Individuen mit Bezug auf ihre soziale Funktion bezeichnen. Demgemäß wäre bei der Verwendung der Begriffe das biologische Geschlecht zu berücksichtigen. Da aber Gattungs- und Individualbegriffe sich nur logisch, nicht aber von ihrem Erscheinungsbild her unterscheiden und da im allgemeinen Sprachgebrauch über logische Grenzen hinweg biologische Konnotationen wirkmächtig sind, hat man zur Vermeidung geschlechtsbezogener sozialer Diskriminierung Zeichen wie Binnen-I, Sternchen, Unterstriche, Schrägstriche, Klammern, Doppelpunkte eingeführt. So möchte man biologisch-geschlechts-neutrale Gattungsbegriffe erschaffen. Sie haben nur den Nachteil, stilistisch unschön oder nicht oder nur holpernd aussprechbar zu sein.
Bei der Bezeichnung von Personen durch Gattungsbegriffe verzichte ich deshalb auf eine einheitliche Verwendung der weiblichen oder männlichen Form und verwende stattdessen, sofern nicht neutrale Bezeichnungen möglich sind, zufällig die eine oder andere. Sofern damit allgemeine Aussagen über die Soziale Arbeit und ihre Fachkräfte gemacht werden, ist das jeweils andere Geschlecht mitgemeint. Stehen die Bezeichnungen dagegen als Individualbegriffe im Zusammenhang mit der Erörterung eines bestimmten Falls, dann richten sie sich nach dem biologischen Geschlecht der jeweiligen zitierten Fachkraft.
Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt am Main