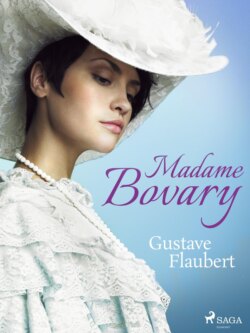Читать книгу Madame Bovary - Gustave Flaubert, Gustave Flaubert - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеSie hatte als junges Mädchen „Paul und Virginie“ gelesen und lange Zeit von der Bambushütte geträumt, von dem Neger Domingo und dem treuen Hund, besonders aber von der wunderbaren Freundschaft so eines guten kleinen Bruders, der einem von Bäumen, höher als Kirchtürme, rote Früchte herunterholte oder barfuß durch den Sand gelaufen kam und einem ein Vogelnest brachte.
Als sie dreizehn Jahre alt war, fuhr ihr Vater selbst mit ihr zur Stadt, um sie ins Kloster zu bringen. In dem Gasthof im Viertel Saint-Gervais, wo sie abstiegen, wurden ihnen beim Abendessen Teller vorgesetzt, die mit Bildern aus der Geschichte des Fräuleins de la Vallière bemalt waren. Die legendenhaften Darstellungen, die hier und da schon von Messerschnitten zerkratzt waren, verherrlichten alle die Religionen, die zarten Gefühle des Herzens und den Glanz des Hofes.
In der ersten Zeit langweilte sie sich im Kloster nicht im geringsten und fühlte sich wohl in Gesellschaft der guten Schwestern, die sie zuweilen, wenn sie ihr eine Freude machen wollten, mit in die Kapelle nahmen, zu der man vom Refektorium aus durch einen langen Gang gelangte. Sie spielte nur sehr wenig in den Freistunden, faßte den Katechismus gut auf, und bei schwierigen Fragen war immer sie es, die dem Herrn Vikar antwortete. So heranwachsend, ohne jemals aus der lauen Schulstubenluft herauszukommen, immer in Gesellschaft dieser blassen Frauen mit den Rosenkränzen und Kupferkreuzchen, verfiel sie allmählich in ein mystisches Schmachten, das von den Weihrauchdüften des Altars, der Kühle der Weihwasserbecken und dem Lichtschein der Kerzen ausging. Statt der Messe zuzuhören, versenkte sie sich in die Betrachtung der frommen, himmelblau umränderten Vignetten ihres Gebetbuches und verliebte sich in das kranke Lamm Gottes, in das von spitzen Pfeilen durchbohrte Herz Jesu und in den armen Heiland selbst, der unter der Last seines Kreuzes zusammenbricht. Um sich zu kasteien, versuchte sie einen ganzen Tag ohne Essen auszukommen und zerbrach sich den Kopf nach irgendeinem Gelübde, das sie ablegen könne.
Ging sie zur Beichte, so dachte sie sich recht viele kleine Sünden aus, um noch länger dort so verharren zu können, im Halbdunkel kniend, die Hände gefaltet, das Gesicht am Gitter, unter dem Geflüster des Priesters. All die Gleichnisse vom himmlischen Geliebten und Bräutigam und Gemahl und der ewigen Hochzeit, die in den Predigten immer wieder vorkamen, erweckten im Grunde ihrer Seele ungeahnte Schauer des Entzückens.
Allabendlich wurde im Arbeitssaal vor dem Gebet etwas Erbauliches vorgelesen, an den Wochentagen ein Abschnitt aus der biblischen Geschichte oder die „Disputationen“ des Abbé Frayssinous und sonntags zur Erholung Stellen aus Chateaubriands „Geist des Christentums“. Wie lauschte sie, als sie zum erstenmal die klangvolle Klage romantischer Schwermut vernahm, die allerenden aus Erde und Ewigkeit widerhallte! Hätte sie ihre Kindheit im Hinterstübchen eines Kramladens in irgendeinem Geschäftsviertel verbracht, so wäre sie vielleicht jener lyrischen Naturschwärmerei verfallen, die gewöhnlich nur auf dem Umweg über Bücher hervorgerufen wird. So aber kannte sie das Land zu gut; das Blöken der Herden, die Milchwirtschaft, Egge und Pflug waren ihr vertraut. An geruhsame Bilder gewöhnt, wandte sie sich ganz dem Gegenteil, dem Erregten und Erregenden zu. Sie liebte das Meer nur um seiner Stürme willen und das Grün nur dann, wenn es spärlich zwischen Ruinen sproß. Mehr empfindsam als künstlerisch veranlagt, mehr auf Gefühl bedacht als auf Betrachtung, mußte sie den Dingen irgend etwas Persönliches für sich abgewinnen können, und alles, was nicht unmittelbar ihrem Herzen Anregungen gab, verwarf sie als unnütz.
Ins Kloster kam alle Monate für acht Tage eine alte Jungfer, um die Wäsche auszubessern. Da sie als Angehörige einer alten, durch die Revolution ruinierten Adelsfamilie vom Erzbischof begönnert wurde, durfte sie im Refektorium mit am Tisch der ehrwürdigen Schwestern essen und pflegte nach Beendigung der Mahlzeit noch einen kleinen Schwatz mit ihnen zu halten, ehe sie wieder an ihre Arbeit ging. Oft geschah es auch, daß die Zöglinge heimlich aus dem Arbeitszimmer entschlüpften und sich zu ihr schlichen. Sie wußte allerlei galante Lieder aus dem vergangenen Jahrhundert auswendig, die sie ihnen mit halblauter Stimme vorsang, während sie die Nadel führte. Sie erzählte Geschichten, wußte stets Neuigkeiten, übernahm Besorgungen in der Stadt und lieh den größeren Mädchen heimlich Romane, von denen sie immer einen in ihrer Schürzentasche hatte und woraus das gute Fräulein in ihren Arbeitspausen selbst ganze Kapitel verschlang. Darin wimmelte es nur so von Liebschaften, Liebhabern, Geliebten, in einsamen Pavillons ohnmächtig niedersinkenden verfolgten Edeidamen. Auf jeder Poststation wurde mindestens ein Postillion ermordet, auf jeder Seite ein Pferd zuschanden geritten. Dunkle Wälder, Seelenkämpfe, Schwüre, Schluchzen, Tränen und Küsse, Gondelfahrten im Mondschein, Nachtigallen in den Büschen, Männer, stark wie Löwen und sanft wie Lämmer, unwahrscheinlich tugendhaft, stets tadellos gekleidet und elegisch wie Trauerweiden – und alles, was das Herz begehrte, war da. Ein halbes Jahr lang beschmutzte die fünfzehnjährige Emma ihre Hände mit dem Staub dieser alten Scharteken. Dann geriet sie an Walter Scott und berauschte sich nun an historischen Begebenheiten, träumte von alten Truhen, Waffensälen und Minnesängern. Am liebsten hätte sie auch auf so einer alten Ritterburg gelebt wie diese Schloßherrinnen mit den langen Miedern, die ihre Tage unter den Spitzbogengewölben damit verbrachten, daß sie immer nur, den Arm auf das Gemäuer, das Kinn in die Hand gestützt, dasaßen und ins Land hinausspähten, ob nicht aus der Ferne ein edler Ritter mit weißer Helmzier dahergesprengt käme auf schwarzem Roß. Besonders schwärmte sie zu jener Zeit für Maria Stuart, wie sie sich überhaupt für alle berühmten oder unglücklichen Frauen begeisterte. Jeanne d’Arc, Héloïse, Agnes Sorel, die schöne Ferronière und Clémence Isaure leuchteten ihr wie glänzende Kometen aus dem grenzenlosen Dunkel der Geschichte, aus dem ihr sonst nur noch hie und da, schwächer und gänzlich zusammenhanglos, einige Einzelheiten hervorschimmerten: Ludwig der Heilige unter seiner Eiche, der sterbende Chevalier de Bayard, ein paar Schreckensszenen aus der Zeit Ludwigs XI. oder aus der Bartholomäusnacht, der Helmbusch des Béarnesers und immer wieder jene den Hof des Sonnenkönigs verherrlichenden Bilder, die sie damals auf den bemalten Tellern gesehen hatte.
In den Liedern, die in der Musikstunde gesungen wurden, war von nichts anderem als von Madonnen und Engelchen mit goldenen Flügeln, von Lagunen, Gondolieri und dergleichen die Rede, aber hinter den albernen Texten und faden Melodien tat sich ihr lockend das Wunschbild einer Wirklichkeit voll edler und schöner Gefühle auf. Einige ihrer Mitschülerinnen brachten die Poesiealben mit ins Kloster, die sie zu Neujahr geschenkt bekommen hatten. Das war eine aufregende Sache, man mußte sie verstecken und heimlich im Schlafraum lesen. Mit behutsamen Fingern betastete Emma die schönen Atlaseinbände, und ihre Augen ruhten geblendet auf den Namen der unbekannten Autoren, die – meist Grafen oder Barone – ihre Eintragungen unterzeichnet hatten. Das Herz klopfte ihr, wenn sie gegen das Seidenpapier über den beigefügten Stahlstichen hauchte, daß es sich aufblähte und dann sacht auf die Seite sank. Da sah man denn auf hohem Balkon einen jungen Mann in kurzem spanischem Mantel, in seinen Armen ein Fräulein in weißem Gewand mit einem Täschchen am Gürtel; oder unbenannte Porträts blondgelockter englischer Ladies, die einen unter ihren runden Strohhüten hervor mit großen Unschuldsaugen anblickten. Manche sah man, wie sie, in schöne Equipagen hingegossen, durch ihre Parks spazierenfuhren; ein Windspiel sprang vor den trabenden Pferden her, die zwei kleine Grooms in weißen Hosen lenkten. Wieder andere saßen träumerisch auf Sofas, einen erbrochenen Brief in Händen, und schauten durch das geöffnete, von einem schwarzen Vorhang halb verhüllte Fenster in den Mond. Einige ganz Unschuldsvolle schnäbelten, eine Träne auf der Wange, durch das Gitter eines gotischen Käfigs mit einer Turteltaube oder zerzupften, den Kopf lächelnd auf die Schulter geneigt, mit spitzen, wie Schnabelschuhe nach oben gebogenen Fingern eine Margerite. Und auch ihr fehltet nicht, ihr Sultane mit den langen Pfeifen, unter Lauben im Arm von Bajaderen wonnig hingelagert, und ihr Giaurs, ihr türkischen Säbel und phrygischen Mützen und ihr vor allem, wesenlose Landschaften vielgepriesener Gegenden, die ihr uns alles friedlich beisammen zeigt: Palmen und Fichten, Tiger zur Rechten und Löwen zur Linken, am Horizont tatarische Minaretts, im Vordergrund römische Ruinen, dazu eine Gruppe kauernder Kamele, das Ganze eingerahmt von einem höchst säuberlichen Urwald und senkrecht durchschossen von einem riesengroßen Sonnenstrahl, der sich zitternd in einem See spiegelt, wo sich als weiße Tupfen schwimmende Schwäne vom stahlgrauen Hintergrund abheben. Und das abgeschirmte Licht der Lampe, die Emma zu Häupten an der Wand hing, fiel auf all diese Bilder einer fernen Welt, die so in der Stille des Schlafsaals an ihr vorüberzogen, während nur dann und wann das Rollen eines verspäteten Wagens vom Boulevard herüberdräng.
Als ihre Mutter starb, weinte sie in den ersten Tagen viel. Sie ließ sich eine Haarlocke der Verblichenen in Glas und Rahmen fassen und schrieb nach Bertaux einen Brief voll schwermütiger Betrachtungen über das Leben und bat ihren Vater darin, man möge sie später einmal in das gleiche Grab betten wie ihre Mutter. Der gute Mann dachte, sie sei krank, und fuhr gleich zu ihr. Emma aber fühlte sich innerlich hoch befriedigt, schon beim ersten großen Schmerz ihres Lebens den Idealzustand blasser Vergeistigung erreicht zu haben, zu dem sich die mittelmäßigen Seelen niemals erheben. Sie überließ sich nun ganz den Fluten der Vergänglichkeitsromantik Lamartines und vernahm im Geiste nur noch Harfenklänge über stillen Weihern, Gesänge sterbender Schwäne, das Rieseln fallender Blätter, das Himmelfahrtsseufzen jungfräulicher Seelen und die raunende Stimme des Ewigen in den Tälern. Schließlich wurde ihr das langweilig. Sie wollte es sich nicht eingestehen und hielt zunächst aus Gewohnheit, später aus Eitelkeit daran fest, bis sie eines Tages die überraschende Entdeckung machte, daß von dem ganzen Kummer nichts mehr zu spüren und ihr Gemüt so wolkenlos war wie ihre glatte Stirn.
Die guten Nonnen, die so sehr auf Emmas fromme Berufung gerechnet hatten, merkten zu ihrem größten Erstaunen, daß Fräulein Rouault ihrem Einfluß zu entschlüpfen drohte. Sie hätten sich nicht zu verwundern brauchen. Sie hatten ihr dermaßen mit Messen und Andachtsübungen und frommen Ermahnungen zugesetzt, ihr so oft gepredigt, wieviel Ehrfurcht man den Heiligen und Märtyrern schulde und was man alles zur Kasteiung des Leibes und für sein Seelenheil tun müsse, daß sie es nun einfach machte wie Pferde, die man zu fest am Zügel hält und die dann ganz plötzlich stehenbleiben, so daß ihnen die Kandare aus den Zähnen rutscht. Ihr bei aller Schwärmerei so auf die Wirklichkeit eingestelltes Wesen, das die Kirche nur um der Blumen, die Musik nur um der Liedertexte und die Bücher nur um der Gefühle willen, die sie in ihr erregten, so sehr geliebt hätte, lehnte sich gegen die Mysterien des Glaubens und noch mehr gegen die Klosterzucht auf, die ihrer Natur zuwider war. Als ihr Vater sie aus dem Kloster wieder herausnahm, sah man sie ohne Bedauern scheiden. Die Oberin fand sogar, sie habe es in der letzten Zeit an Ehrerbietung gegen die Schwesternschaft fehlen lassen.
Daheim gefiel sich Emma anfangs darin, das Gesinde zu kommandieren, wurde des Landlebens aber bald wieder überdrüssig und sehnte sich nach dem Kloster zurück. Zu der Zeit, als Charles zum erstenmal nach Bertaux kam, hielt sie sich für in jeder Beziehung enttäuscht und meinte, für sie gebe es nichts mehr hinzuzulernen und nichts mehr zu empfinden.
Dann aber hatte die Bangigkeit, die mit jedem neuen Zustand verbunden ist, oder vielleicht auch die Unruhe, die ihr die Gegenwart dieses Mannes verursachte, genügt, in ihr den Glauben zu erwecken, daß nun endlich jene wunderbare große Leidenschaft über sie gekommen sei, die ihr bisher immer nur als Riesenvogel mit rosenrotem Gefieder, in den strahlenden Himmeln der Poesie schwebend, erschienen war. Und jetzt, in ihrer Ehe, wollte ihr nicht in den Sinn, daß der gleichmäßige Friede, in dem sie dahinlebte, das Glück sei, von dem sie geträumt hatte.