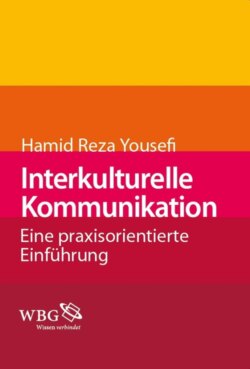Читать книгу Interkulturelle Kommunikation - Hamid Reza Yousefi - Страница 13
1.1.1 Frühe Ansätze
ОглавлениеTheoretische Ansätze zur Kommunikationsforschung sind aus vielerlei Disziplinen hervorgegangen. Hierzu gehören neben der Ethnologie und der Soziologie, die sich mit dem sozialen Verhalten und der Massenkommunikationsforschung beschäftigen, auch Kultur- und Sprachwissenschaften, Hermeneutik, Diskursanalyse oder Sprechakttheorie. Diese Bereiche analysieren die Bedeutung der Kommunikation in unterschiedlichen Diskursfeldern. Eine weitere Entwicklung, die ebenfalls zum Kommunikations- und Verstehensprozess beiträgt, ist der moderne Konstruktivismus, nach dem das menschliche Lernen und das Erleben vor allem durch kognitive und soziale Prozesse beeinflusst wird.
Einer der ersten Philosophen, die sich systematisch mit der Frage nach menschlicher Kommunikation beschäftigt haben, ist der Weltphilosoph Karl Jaspers (1883–1969). In den 1940er Jahren erhob Jaspers die Kommunikation zum zentralen Begriff seiner Philosophie. Er unterscheidet zwischen „Daseinskommunikation“ und „existentieller Kommunikation“. Während Erstere sich auf den Daseinskampf um Macht und Übermacht sowie den Zusammenschluss bestimmter Gemeinschaften bezieht, um gemeinsame Ziele zu erreichen, setzt Letztere auf die Macht des gemeinsamen Verstehens auf gleicher Augenhöhe. Hier entwickelt der Mensch seine eigene Existenz in Kommunikation mit anderen Menschen.3 Vernunft entfaltet sich am besten in der existenziellen Kommunikation, die Jaspers als „grenzenloser Kommunikationswille“ bezeichnet. Die zentrale Aufgabe der Philosophie sieht Jaspers in der Umsetzung eines solchen grenzenlosen Kommunikationswillens.
Merke:
Kommunikation in einem solchen Sinne macht sich bemerkbar, wenn uns nach Hans-Georg Gadamer (1900–2002) „im anderen etwas begegnet ist, was uns in unserer eigenen Welterfahrung so nicht begegnet war.“. Dialog hat „eine verwandelnde Kraft. Wo ein Gespräch gelungen ist, ist in uns etwas geblieben, das uns verändert hat.“4
Nach dem allmählichen Ende des kolonialen Zeitalters, das mit vielschichtigen Umwälzungen verbunden ist, werden nach dem Zweiten Weltkrieg im angelsächsischen Raum eine Reihe von Kommunikationstheorien entwickelt. Die Befreiung der ehemals beherrschten Völker erfordert ein neues Selbst- und Fremdverständnis, weil sich das Andere, das bislang Beherrschte, zunehmend mit eigenen Lösungsvorschlägen zu Wort meldet.
Die Forschungen zu jener Zeit zeigen zwei Ausrichtungen: den „Kulturellen Dialog“ und den „Kulturellen Kritizismus“. Grundlage des Kulturellen Dialogs ist die Erforschung der Bedingungen, unter denen Mitglieder verschiedener Kulturen, ohne unkorrigierbares Missverstehen, miteinander kommunizieren können. Dabei ist der Wille vorauszusetzen, überhaupt kommunizieren zu wollen. Der Kulturelle Kritizismus widmet sich Konflikt erzeugenden Elementen in Kulturen, um diese im Vorfeld von Begegnungen zu analysieren und Möglichkeiten zur Beseitigung von Dialogbarrieren aufzuzeigen.
Wenngleich beide Verfahren dazu geeignet sind, die Vorbedingungen für das Gelingen interkultureller Kommunikation zu verbessern, wird der Suche nach universellen Gemeinsamkeiten, insbesondere beim kulturellen Kritizismus, kaum Bedeutung beigemessen. Außerdem gehen beide Ausrichtungen von einem essentialistischen Kulturverständnis aus, das Kulturen als Gebilde ansieht, die a) in sich selbst homogen sind und b) geschlossene Einheiten darstellen, die einander nicht durchdringen und sich deswegen mit anderen Kulturen nicht vermischen können.
Edward Twitchell Hall (1914–2009) führt das Kompositum „Intercultural Communication“ in die Literatur ein. Bei seinen anthropologischen Analysen kommt er zu dem Ergebnis, dass Kultur im eigentlichen Wortsinn Kommunikation bedeutet. Dies hängt damit zusammen, dass menschliche Handlungen, gleichwie sie ausgedrückt sein mögen, stets an Bedeutungen gekoppelt sind, die er als „verborgene Signale“ bezeichnet.5 Nach diesem Muster wird Kommunikation umso verständlicher, je mehr wir diese Signale richtig interpretieren.
Ward Goodenough (*1919) zählt auch zur Gründergeneration der Kommunikationsforschenden, die eine essentialistische Betrachtungsweise pflegen.6 Im Jahre 1956 lenkt er den Blick darauf, dass Kultur in großen Teilen ein kognitives Faktum ist und der sprachliche Ausdruck durch Überzeugungen und Wertvorstellungen des Individuums wie auch des Kollektivs bestimmt wird. Goodenough lenkt den Blick von der ehemals reinen Betrachtung von Kunst- und Gebrauchsgegenständen auf die Bedeutung der Kommunikation. In jenem Jahr legt ein weiteres Autorenkollektiv unter Alfred Louis Kroeber (1876–1960) und Clyde Kluckhohn (1905–1960) Arbeiten über Werte in verschiedenen Kulturen vor.7 Sie tragen eine Reihe von Kulturdefinitionen zusammen, um die Mannigfaltigkeit der Formen von Verständnis zu demonstrieren. Danach gerät die Frage nach interkultureller Kommunikation für ein Vierteljahrhundert in den Hintergrund.
Im Jahr 1981 greift Thomas Kochmann das Thema der Kommunikationsforschung erneut auf und weist unterschiedliche Frage-Antwort-Sequenzen bei Schwarzen und Weißen als Grundform „interethnischer“ Missverständnisse nach. Hiermit erweitert er die Grenzen der Kommunikationsuntersuchung um den Aspekt der Kulturgebundenheit.8 In jener Zeit nimmt das Verständnis um den Kulturbegriff für die Kommunikationsforschung an Bedeutung zu.
Dabei wird das herrschende essentialistische Kulturverständnis in Frage gestellt. Kulturen werden nun als Phänomene angesehen, die a) nicht homogen, vielmehr auch in sich selbst heterogen sind und b) untereinander nicht wie Billardkugeln aufeinanderprallen, sondern von Durchlässigkeit gegenüber anderen Kulturen geprägt sind. Eine weitere Erkenntnis ist die Reziprozität der Kulturentstehung: Der Mensch als kulturstiftendes und kulturempfangendes Wesen prägt zwar die Kultur und die Gesellschaft, aber auch er selbst wird von beiden geprägt und bestimmt. So bleibt selbst die Befriedigung elementarster Bedürfnisse, außer unter ungewöhnlichen Umständen, immer im Bann der Regeln, die von Gebräuchen und Gewohnheiten diktiert werden.
Das Forschungsfeld der interkulturellen Kommunikation ist seit dieser Zeit konstitutiver Bestandteil einer Reihe wissenschaftlicher Disziplinen, allen voran die Medienwissenschaft, Psychologie und Anthropologie, hier insbesondere die kognitive Anthropologie. Die Kommunikationswissenschaften wirken in letzterer Disziplin expandierend insofern, als sie den anthropologischen Blick schärfen. Die Konstitution ethnischer Identität wird nun endgültig als ein sprachlicher Prozess aufgefasst.9
Edward Stuart schafft im Jahr 1973, mit der Zusammenführung einzelner Forschungsrichtungen, die theoretische Basis einer Disziplin der interkulturellen Kommunikation als eines interdisziplinären Forschungsfeldes.10 Er erhebt Kultur zu einem Schlüsselbegriff. Unter interkultureller Kommunikation wird nunmehr das Verhältnis zwischen Kultur und menschlicher Interaktion verstanden.
Im Iran wird 1977 das erste Iranische Zentrum für Studien der Kulturen gegründet, das bis heute fortbesteht.11 Zu den Aufgaben dieses Zentrums gehört die Förderung des Dialogs der Kulturen durch die Übersetzung von Werken der Philosophen im Weltkontext in die persische Sprache, wie auch die systematische Erforschung des Eurozentrismus in der Weltliteratur und insbesondere in der Wissenschaft.
Im gleichen Jahr entwickelt Munasu L.J. Duala-M’bedy (*1939) die Xenologie als eine wissenschaftliche Disziplin, um Einseitigkeiten in der Sichtweise der europäisch-westlichen Ethnologen zu überwinden. Er stellt sich die Aufgabe,
„unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten das Problem der geistigen Konfrontation mit Völkern zu untersuchen, die bis dato am Rande europäischer Geschichtsphilosophie behandelt worden sind und damit grundsätzlich eine menschlich derogative Sonderstellung entweder eingenommen haben oder noch nehmen. Das Thema […] ist also implizit die Kritik an einer Verzerrung des Menschenbildes, die […] seit der europäischen Renaissance zu einem Charakteristikum des europäischen Denkens geworden ist.“12
Für Duala-M’bedy gibt es „keinen Identitätsbezug für die Fremdheit, insofern ist das Fremde ein relativer Begriff.“13 In einer umfassenden Quellendokumentation zeigt er auf, dass das seit der Renaissance das aufkommende Menschenbild unter ethnologischen Gesichtspunkten zur Polarisierung der Welt in einerseits die „wilden und primitiven Naturvölker“ und andererseits die „kultiviert-zivilisierten Europäer“ gebraucht wurde. Duala-M’bedy ist der Ansicht, dass es „so etwas wie einen kategorischen Fremden in der Welt und in der Geschichte nicht gibt. […] Da es keinen Fremden per se gibt, wird Fremdheit erzeugt […], zum Fremden wird durch den geschichtlich erzielten Umstand des Milieudenkens gemacht.“14
Die systematische Einführung der Xenologie ändert den wissenschaftlichen Blick über Themenbereiche der interkulturellen Kommunikation, weil das Andere sich mit eigenen Lösungsvorschlägen zu Wort meldet.
John Condon und Fatih Yousef sind im Jahre 1975 bestrebt, die bestehenden Kulturtheorien zu erweitern.15 Sie gehen von der völligen Gleichwertigkeit aller Kulturen aus und verstehen unter Kultur ein allumfassendes System, das Menschen grundlegend prägt und beeinflusst. Dadurch, dass für die Autoren alles gleich richtig und gleich gut ist, verfahren sie stark relativierend.
Mit dem „Handbook of Intercultural Communication“ von Molefi Kete Asante (*1942) gewinnt die interkulturelle Kommunikation im Jahre 1979 eine neue Dimension. Die Maxime dieses Handbuches ist: „Lebe, was du predigst“16, und zielt darauf ab, zu einer Übereinstimmung von theoretischer und praktischer Lebensführung zu gelangen.
Abdoldjavad Falaturi (1926–1996) entwickelt im Laufe der 1980er Jahre das weltweit erste Forschungsprojekt: „Der Islam in den Schulbüchern der Bundesrepublik Deutschland“.17 Das zentrale Ziel Falaturis ist die Überwindung von Vorurteilen über den Islam in den deutschen Schulbüchern und die Praxis eines okzidentalisch-orientalischen Dialogs auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts. Er setzt sich für konfessionellen Religionsunterricht ein, da Vergleiche zu anderen Religionen erst mit der Kenntnis des eigenen Glaubens möglich seien.18 Heute gilt Falaturi als ein Begründer des interreligiösen Dialogs.