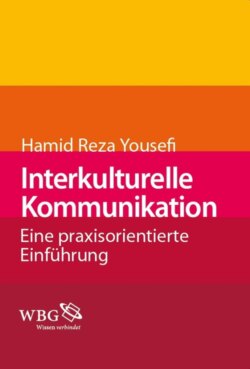Читать книгу Interkulturelle Kommunikation - Hamid Reza Yousefi - Страница 9
Aufbau der Studie
ОглавлениеDie Studie ist in sieben Kapiteln untergliedert, die aufeinander aufbauen und eine heterogene Einheit bilden. Ich gehe dabei wie folgt vor:
Im ersten Kapitel führe ich in die Geschichte und Gegenwart interkultureller Kommunikation ein. Dabei diskutiere ich zunächst die Kommunikationstheorien von Jürgen Habermas (*1929) und Friedemann Schulz von Thun (*1944). Es werden ihre Einseitigkeiten analysiert und gleichsam begründet, warum diese, insbesondere im Sinne einer Pädagogik der Interkulturalität, einer weiterführenden Kritik zu unterziehen sind.
Im zweiten Kapitel analysiere ich, kritisch weiterführend, einige moderne Theorien des Kulturbegriffs, wie normengebende, geschlossene, intellektualistische und symbolischstrukturelle, multikulturelle, transkulturelle und interkulturelle Konzepte. Es wird herausgearbeitet, dass die ersten sechs Orientierungen des Kulturbegriffes teilweise zu eng oder zu weit gefasst sind und zu einer transparenten Kommunikation in interkultureller Absicht nicht wirklich beizutragen vermögen; die ersten fünf Konzepte verfahren teilweise stufentheoretisch und kulturhierarchisch. Zur Positionierung der interkulturellen Orientierungen des Kulturbegriffs in der aktuellen Diskussion werden in einem weiteren Schritt die Ansätze der Trans- und Multikulturalität von Wolfgang Welsch (*1944), Charles Taylor (*1931) und Homi K. Bhabha (*1949) vorgestellt und mit der Disziplin der Interkulturalität in Beziehung gesetzt. Eine solche Analyse soll deutlich machen, wie diese miteinander in Beziehung stehen und wo Konvergenzen und Divergenzen sowie Schnittmengen zwischen den drei Theorien liegen. Aufbauend auf dem interkulturellem Konzept des Kulturbegriffs wird die Kulturtheorie von Dieter Senghaas (*1940) vorgestellt, die nicht nur von externen, sondern auch von internen Ausdifferenzierungen der Kulturen ausgeht.
Anschließend wird im dritten Kapitel das Thema Interkulturalität aufgegriffen und diese in ihrer Struktur als akademische Disziplin auf der Grundlage eines erweiterten Kulturbegriffs eingeführt. Zur Darstellung kommen Sinn und Funktion einer interkulturell orientierten Forschung. In einem weiteren Schritt wird zwischen drei methodischen Teilbereichen der Interkulturalität unterschieden: historischer, systematischer und vergleichender Interkulturalität. Die methodische Ausrichtung der Interkulturalität ist der pluralistischen Methode der Pädagogik der Interkulturalität ähnlich, die im zweiten Kapitel vorgestellt wird.
Im vierten Kapitel folgt die umfassende Erläuterung interkulturell-kontextueller Kommunikation und ihrer Dimensionen. Hierbei werden acht Korrelatbegriffe interkultureller Kommunikation vorgestellt. Es handelt sich neben der Frage nach dem Eigenen und dem Anderen auch um die Vorstellung von jeweils interkultureller Kompetenz, Semantik, Hermeneutik, Komparatistik, Toleranz und Ethik. Diese Begriffe stehen in allen Formen der interkulturellen Kommunikation auf einer spezifischen Weise miteinander in Wechselbeziehung. Hierbei werden auch die im zweiten Kapitel beschriebenen fünf Dimensionen einer Pädagogik der Interkulturalität einbezogen.
Die Chancen, aber auch die Probleme interkultureller Kommunikation sollen anhand zweier Familien – einer aus Deutschland und einer aus dem Iran – verdeutlicht werden. Die Mitglieder haben sich zum „Tausch“ bereit erklärt, so dass die deutsche Mutter mit Tochter zu dem iranischen Vater mit Sohn umzieht, während die iranische Mutter mit Tochter nach Deutschland kommt. Diese als Tauschfamilien gekennzeichneten Patchwork-Gruppen sprechen verschiedene Sprachen, gehören verschiedenen Kulturregionen und Religionen an und haben verschiedene Ausbildungen genossen.
Die Begegnung wird in lernender Absicht eröffnet und soll dazu führen, dass die Würde der Konvergenzen und Divergenzen anerkannt wird. Die Tauschfamilien sind nicht auf sich selbst zurückgeworfen, wenn es Unzulänglichkeiten gibt. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen, weil sie wissen, dass nicht immer allgemeinverbindliche Lösungen bereitstehen.
Darauf aufbauend wird im fünften Kapitel die Idee einer kontextuellen Pädagogik der Interkulturalität vorgestellt und die Zukunftsfrage dieser Disziplin umrissen. Kontextuell zu verfahren bedeutet, die Mannigfaltigkeit von Diskursfeldern kultursensitiv zu berücksichtigen. Zur Darstellung kommen unter jeweils kontextuellem Aspekt die Dimensionen von kulturpädagogischen, erwachsenenpädagogischen und sozialpädagogischen, berufspädagogischen sowie medienpädagogischen Positionen. Erläutert wird abschließend auch die pluralistische Methodenkomposition einer Pädagogik der Interkulturalität.
Im sechsten Kapitel komme ich auf die strukturellen Probleme der interkulturellen Kommunikation zu sprechen. Hierzu gehört die Debatte um Exklusivität und Inklusivität, die Rolle von Vorurteilen sowie die Frage nach der Problematik der ablehnenden Anerkennung. Abschließend erläutere ich einige Funktionen der Macht. Dabei wird gezeigt, dass Macht die bestimmende Achse der Kommunikation auf jedwedem Gebiet bildet. Hier werden unterschiedliche Machtfunktionen diskutiert, positive wie negative Arten. Auf diesem Wege kommt auch die Idee der „Geographisierung des Denkens“ am Beispiel der west-östlichen Vernunft zur Darstellung. Sie geht auf Richard Nisbett (*1941) zurück, der der Ansicht ist, dass rationales Denken europäisch-westlich und mystisch-holistisches Denken ausschließlich asiatisch sei.
Weil sich eine Reihe der Probleme interkultureller Kommunikation auf die Medienberichterstattung zurückführen lassen, wendet sich das Thema des siebten Kapitels der Beschreibung medialer Berichterstattung zu. Bei diesem Abriss wird von zwei Formen des Journalismus ausgegangen: dem Konflikt- und dem Friedensjournalismus. Während ersterer stark divergenzorientiert ist, sucht letzterer Konvergenzen und Divergenzen zugleich, um ein ausgewogenes Gesamtbild des Sachverhaltes zu gestalten. In einem zweiten Schritt wird kurz umrissen, wie der Iran in den deutschen Medien dargestellt wird und wie Deutschland in den iranischen Medien erscheint.