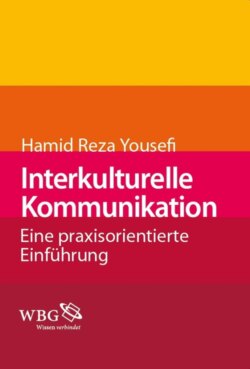Читать книгу Interkulturelle Kommunikation - Hamid Reza Yousefi - Страница 17
1.2 Zwischenbetrachtung
ОглавлениеBetrachten wir die Ansätze der interkulturellen Kommunikation der letzten 60 Jahre, wenn auch teilweise nur recht oberflächlich, so ist festzuhalten, dass Forschungen in enormer Bandbreite die Kenntnisse um die interkulturelle Kommunikation stark erweitert zu haben scheinen. Bei genauerer Durchsicht zeigt sich, dass viele dieser Theorien zwar vorgeben, „interkulturell“ zu verfahren, sie jedoch häufig eine Neuauflage einseitiger Abhandlungen sind, die bis in das Zeitalter der europäischen Aufklärung zurückreichen. Sie vernachlässigen insbesondere zwei Voraussetzungen, die nicht unberücksichtigt bleiben dürfen: einen offenen Kulturbegriff sowie ein offenes, enzyklisch-hermeneutisches Verständnis.
Merke:
In der Mehrzahl der beschriebenen Theorien geht es um die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung, ohne auch nur im Ansatz außereuropäisch-westliche Fragen und Antworten sowie deren Selbst- und Fremdwahrnehmung zu berücksichtigen. Werden diese Komponenten unberücksichtigt gelassen, so wird eine lange Tradition des Monologs unbeirrt fortgesetzt. Insofern wäre die Bezeichnung „interkulturell“ durchaus verzichtbar, weil dies auf eine hermeneutische Wende hinweist, der bisher nur von wenigen Forschenden ansatzweise Rechnung getragen wurde.
Die Darstellung der Ansätze dürfte, wenn auch nur ansatzweise, deutlich gemacht haben, dass jede Kommunikation eine Reihe von Komponenten aufweist, deren Marginalisierung oder Nichtberücksichtigung mit Folgen verbunden sein wird. Wollen wir diese Ansätze auf eine interkulturell ausgerichtete Kommunikationsform anwenden, so wird ersichtlich, dass diese in der Regel die europäisch-westlichen Denk- und Handlungsstrukturen vor Augen haben. Sie übersehen die Vielfalt der kulturellen Kontexte.
Eine Ausnahme von solchen einseitigen Denkstrukturen bilden vor allem Jaspers, Falaturi und Duala-M’bedy. In den Theorien dieser Denker liegt eine Zukunftsperspektive begründet, die für einen neuen Entwurf interkultureller Kommunikation weiterentwickelt werden kann.
Neben Jaspers’ existenziellem Kommunikationsmodell sei Martin Bubers Ich-Du-Dialog (1878–1965)46 und der hermeneutische Ansatz von Hans-Georg Gadamer47 genannt.
Zur Theorie von Schulz von Thun reicht es, darauf hinzuweisen, dass diese auf eine indirekte Kommunikation Anwendung finden kann, die keine ausdrückliche, sondern zweideutige Sprechakte enthält. Für eine Anwendbarkeit der Theorie von Schulz von Thun benötigen wir eine Reihe von weiteren interkulturell und interreligiös sensibilisierten Ohren bzw. Verstehensebenen. Von Bedeutung ist eine argumentative Hermeneutik, auf die ich noch im fünften Kapitel zu sprechen kommen werde. Es geht hier konkret darum, a) wie ich meine eigene Denkform betrachte, b) wie ich die anderen Denkformen sehe, c) wie die anderen Denkformen ihre eigene Denkform wahrnehmen und d) wie die anderen Denkformen meine Denkform beurteilen.
Merke:
In jeder ernstzunehmenden Kommunikationstheorie dürfen die Komponenten der Macht und der unergründlichen Lebensdynamik des Menschen nicht vernachlässigt werden. Theorien, die diese Komponenten nicht beachten oder marginalisieren, bezeichne ich als eine theoretische Form organisierter Verständigung, die schematisch verfährt.
Das kommunikative Modell von Habermas ist deshalb zu erweitern, weil darin die Komponenten der Macht und unergründlichen Lebensdynamik des Menschen keine Berücksichtigung finden. Ihm geht es hauptsächlich darum, einen idealtypisch „herrschaftsfreien Diskurs“ zu formulieren.
Auch bei der Beantwortung der Frage nach der Eingliederung des Anderen in die Aufnahmegesellschaft werden Integrations- und Desintegrationsprozesse kaum zusammengedacht. Hier könnten die fundierten Studien von Forschenden mit Migrationshintergrund in Lehre und Forschung zur vertiefenden Förderung der Verständigung und dadurch auch der interkulturellen Kommunikation beitragen. Ihnen liegen weniger verschiedene Denkstrukturen im Vergleich und im Verständnis der Völker zugrunde als vielmehr einige unterschiedlich aufeinander aufbauende Herausforderungen, die immer auf eigenen Sichtweisen beruhen. Auf diesem Feld ragt Auernheimers Auffassung ebenfalls als eine Ausnahme heraus, da er beabsichtigt, die vernachlässigte oder marginalisierte Stimme des Anderen aktiv hörbar zu machen.
Wir bedürfen einer verstehenden Darstellungsweise, in der das Andere nicht lediglich als ein Objekt der Forschung betrachtet wird. Wer das Andere in seiner Andersheit theoretisch wie praktisch objektivieren bzw. verdinglichen will, wird sich zwangsläufig von ihm distanzieren. Ziel einer verstehenden und lernenden Darstellungsweise wird stets bleiben, jede Form von Bevormundung des Anderen, theoretisch wie praktisch, zu vermeiden.
In der Vermittlungsform solcher theoretischer Ansätze, für den praktischen Umgang miteinander, liegt die Bedeutung einer Pädagogik der Interkulturalität, die uns im fünften Kapitel beschäftigen werden wird.
1 Im Rahmen anderer Studien habe ich das Konzept der interkulturellen Kommunikation ansatzweise vorgestellt und diskutiert, worauf hier grundsätzlich verwiesen sei. Vgl. Yousefi, Hamid Reza: Interkulturalität und Geschichte, 2010 und Interkulturalität (mit Ina Braun), 2011.
2 Vgl. hierzu Zager, Werner (Hrsg.): Die Macht der Religion, 2008.
3 Vgl. Jaspers, Karl: Vernunft und Existenz, 1987 S. 72 und Philosophie, Bd. I, II und III, 31956.
4 Gadamer, Hans-Georg: Die Unfähigkeit zum Gespräch, 1999 S. 207, 211, 213 und 215.
5 Vgl. Hall, Edward Twitchell: Verborgene Signale, 1985 S. 20.
6 Vgl. Goodenough, Ward E.: Componential analysis and the study of meaning, 1956.
7 Vgl. Kroeber, Alfred Louis und Clyde Kluckhohn: Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 1963.
8 Vgl. Kochman, Thomas: Black and White Styles in Conflict, 1981.
9 Vgl. hierzu Moosmüller, Alois: Kulturelle Differenz, 2009.
10 Vgl. Stewart, Edward: Outline of Intercultural Communication, 1973.
11 Die Bibliothek dieses Zentrums umfasste etwa 40.000 Bücher aus dem Bereich der Geistes- und Humanwissenschaften in verschiedenen Sprachen, darunter Französisch, Deutsch, Englisch, Arabisch, Hindi und Farsi. Vgl. Gächter, Afsaneh: Daryush Shayegan interkulturell gelesen, 2005.
12 Duala-M’bedy, Munasu L. J.: Xenologie, 1977 S. 13.
13 Duala-M’bedy, Bonny L. J.: Was ist die Wissenschaft von der Xenologie, 1992 S. 19.
14 Vgl. Duala-M’bedy, Munasu: Xenologie, 1977 S. 14 und 17.
15 Vgl. Condon, John und Fatih Yousef: Introduction to Intercultural Communication, 1975.
16 Vgl. Asante, Molefi Kete u.a.: Handbook of Intercultural Communication, 1979.
17 Vgl. Falaturi, Abdoldjavad (Hrsg.): Der Islam in den Schulbüchern der Bundesrepublik Deutschland, 1986–1990.
18 Vgl. Falaturi, Abdoldjavad: Der Islam im Dialog, 1979 S. 5.
19 Vgl. Auernheimer, Georg: Interkulturelle Jugendarbeit muß Kulturarbeit sein, 1992.
20 Vgl. Hamburger, Franz: Abschied von der Interkulturellen Pädagogik, 2009.
21 Vgl. Gudykunst, William B.: International and Intercultural Communication, 1976.
22 Vgl. Dijk, Teun A. van und Walter Kintsch: Strategies of Discourse Comprehension, 1983.
23 Vgl. die Ausführungen zur interkulturell-kontextuellen Medienpädagogik in Kapitel 2, 3 und 5.
24 Vgl. Rehbein, Jochen (Hrsg.): Interkulturelle Kommunikation, 1985.
25 Vgl. Rösch, Olga: Interkulturelle Kommunikation, 1999.
26 Vgl. Liedke, Martina u.a.: Interkulturelles Handeln lehren – ein diskursanalytisher Trainingsansatz, 2002 (148–179).
27 Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1, 1981 S. 395.
28 Fornet-Betancourt, Raúl: Philosophische Voraussetzungen des interkulturellen Dialogs, 1998 S. 47.
29 Vgl. Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1, 1981 S. 107.
30 Habermas, Jürgen: Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, 1984 S. 177.
31 Ebenda, S. 178.
32 Vgl. Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden, 1981.
33 Vgl. Friedli, Richard: Zwischen Himmel und Hölle, 1986 S. 97.
34 Vgl. Heitmeyer, Wilhelm: Was treibt die Gesellschaft auseinander? 1997.
35 Vgl. Thomas, Alexander u.a.: Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation, 2003.
36 Vgl. Hall, Stuart: Ideologie, Kultur, Medien, Neue Rechte, Rassismus, 1989.
37 Vgl. Bukow, Wolf-Dietrich: Feindbild: Minderheit, 1996.
38 Vgl. Einig, Mark: Modelle antirassistischer Erziehung, 2005.
39 Humboldt, Wilhelm von: Schriften zur Anthropologie und Geschichte, 1980 S. 239.
40 Vgl. Blankertz, Herwig: Die Geschichte der Pädagogik, 1992 S. 103.
41 Vgl. Humboldt, Wilhelm von: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1793), 1967.
42 Vgl. Auernheimer, Georg: Einführung in die Interkulturelle Erziehung, 1990 und Einführung in die Interkulturelle Pädagogik, 2007.
43 Vgl. Eirmbter-Stolbrink, Eva: Wilhelm von Humboldt interkulturell gelesen, 2005.
44 Vgl. Karakaşoğlu, Yasemin: Identität und die Rolle der Religion aus interkulturell-pädagogischer Perspektive, 2010.
45 Vgl. Nohl, Arnd-Michael: Konzepte interkultureller Pädagogik, 2006.
46 Vgl. Buber, Martin: Zwiesprache, 1978.
47 Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1972.