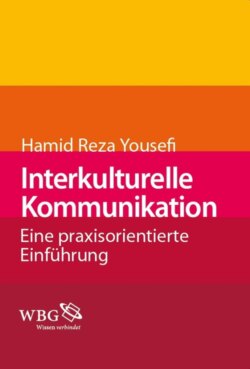Читать книгу Interkulturelle Kommunikation - Hamid Reza Yousefi - Страница 14
1.1.2 Neuere Konzepte
ОглавлениеIn den 1990er Jahren stellt sich die Forschungslage um die interkulturelle Kommunikation zwar breit gefächert, aber uneinheitlich dar. Neben der Entwicklung interkultureller Konzepte der Kommunikation wandeln sich zunehmend die bildungstheoretischen Ansätze zur Erziehung im multikulturellen Kontext.
In dieser Zeit entsteht zudem, als Reaktion auf die Einwanderung der Gastarbeiter, eine Art pädagogischer Ausländerpolitik. Ein bedeutender Vertreter ist Georg Auernheimer (*1939), der mit einer Reihe von Veröffentlichungen praktische Konzepte zur Integration der Einwanderer in Deutschland entwickelt.19 Die pädagogische Ausländerpolitik von Forschern wie Auernheimer weicht bald einer konzeptuellen Fassung interkulturell-pädagogischer Ansätze. Diese Fortentwicklung beruht auf der Tatsache, dass sich in jener Zeit das weltweite Migrationsverhalten verändert. Migration umfasst Wanderbewegungen aus politischen Gründen, aber auch die Pflege von Geschäftsbeziehungen im Weltkontext.
Unter „Immigration“ im vorliegenden Kontext soll der Aufenthalt einer Person oder auch einer Gruppe im Ausland verstanden werden, der es aufgrund seiner Beschaffenheit oder Länge erforderlich macht, sich mit der Aufnahmegesellschaft auseinanderzusetzen. Dies kann aus wirtschaftlichen Gründen, zur Aufnahme eines Studiums oder zur Gründung einer neuen Existenz geschehen.20 Um erfolgreich in einer Aufnahmegesellschaft bestehen zu können, werden zwar fundierte Kenntnisse von Kultur, Religion und Mentalität des Anderen benötigt, eine einigermaßen erfolgreiche Integration bedarf jedoch einer weiteren Fertigkeit: Es geht darum, eine neue Fremdwahrnehmung zu erwerben, die auf das immigrierte Individuum derart zurückwirkt, dass dieses auch zu einer neuen Selbstwahrnehmung gelangt.
Es ist das Verdienst von William B. Gudykunst (*1947) in seinem Werk „Intercultural Communication Theory. Current Perspectives“ (1983), verstreute Konzepte zu einem konsistenten theoretischen Rahmen zusammengefügt zu haben.21
Teun van Dijk (*1943) und Walter Kintsch (*1932) problematisieren im Jahre 1983 das „Diskursverständnis“.22 Die These der beiden Wissenschaftler beruht auf der Erkenntnis, dass sich interkulturelle Kommunikation aus einem kollektiven Gedächtnis speist, das unterschiedlichen Begebenheiten eine überragende Bedeutung beimisst, je nach den politischen Wünschen des Diskurspartners, der sie in Umlauf bringt. So entwickeln sich aus Stereotypen und Vorurteilen Diskurse, wie die Vorstellung, andere Völker seien kriminell und ähnliches, die sich erheblich auf die interkulturelle Kommunikation auswirken.23
Zu jener Zeit entstehen in Deutschland Konzepte, die darauf ausgerichtet sind, den Umgang mit Konfliktsituationen und die Kulturgebundenheit von Entscheidungs- und Problemlösungsstrategien zu thematisieren. Zu nennen ist Jochen Rehbeins Studie „Interkulturelle Kommunikation“ aus dem Jahre 1985.24 Sein Anliegen ist es, durch diskursanalytische Interpretation zusammenhängender Kommunikationsabschnitte die Zwischenräume zwischen sprachlichen Gruppen bewusst zu machen, Diskriminierungspraktiken gegenüber sprachlichen Minderheiten aufzudecken und Bedingungen für eine mehrsprachige Verständigung zu skizzieren. Ferner lehren einige kulturwissenschaftliche Institute und Technische Fachhochschulen sowie private Einrichtungen in München, Hamburg, Hildesheim, Passau oder in Wildau Theorien und Praxisformen interkultureller Kommunikation. Häufig geht es darum, zu zeigen, wie und unter welchen Voraussetzungen interkulturelle Geschäftsbeziehungen funktionieren. Olga Rösch bringt bspw. in Wildau eine wissenschaftliche Reihe über Forschungsfragen zur interkulturellen Kommunikation heraus.25
Eine Reihe von weiteren Theorien wird entwickelt, um Hindernisse in der Kommunikation zu beheben. Diskurs- und sprachliche Äußerungsformen lassen sich unter verschiedenen Aspekten aus unterschiedlichen Perspektiven heraus thematisieren.26 Zu nennen sind vor allem die Theorien von Jürgen Habermas und Friedemann Schulz von Thun. Während Habermas von einer idealen Gesprächssituation ausgeht, ist Schulz von Thun bemüht, eine Theorie des Dekodierungsprozesses zu formulieren.