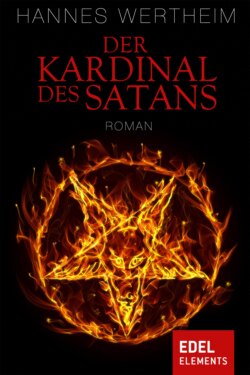Читать книгу Der Kardinal des Satans - Hannes Wertheim - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
Оглавление»Vita brevis, ars longa - Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang.«
Hippokrates 3./4. Jh. v. Chr.
Scoferino saß zu dieser Stunde in seiner schäbigen Dachkammer in einer Gasse des Hortaccio. Durch die dünnen Wände scholl das Geschrei der Fischweiber und Messerschleifer bis zu ihm herauf. Brütende Hitze lag in der staubigen Stube, in der es nach Leinöl und Kreide roch.
Scoferino saß zusammengesunken auf einem kleinen Schemel, die Hände vor sein Gesicht geschlagen. Die Melancholie hatte ihn wieder einmal fest in ihren Klauen. So gelähmt fühlte er sich, dass er manchmal befürchtete, sogar das Atmen zu vergessen. Sein Blick fiel auf ein unvollendetes Bild von der Kreuzabnahme. Alle Figuren waren skizziert, der Gekreuzigte halb ausgeführt, und nach dem Geschmack der Zeit hatte er seine Wunden auf das Deutlichste mit Blut und eiternden Schwären ausgemalt. Doch es waren nicht die beträchtlichen Leiden Christi, die Scoferino noch tiefer in seine schwarze Gefühlslage versinken ließen. Es waren die Umrisse des unvollendeten Madonnengesichts.
»Ich werde dich nie mehr malen können«, jammerte er nun laut, als spräche er mit dem Bild. »Nie mehr. Oh, warum diese Strafe. Warum?« Wieder schlug er die feinnervigen Hände vor sein zuckendes Gesicht. Man hatte ihm das Kostbarste geraubt, was er je besessen hatte. Sein Modell. Noch einmal wanderten seine düsteren Gedanken zu der letzten Begegnung mit Marietta. Am Morgen vor drei Tagen war es gewesen. Die Nacht hatte er durchgemalt und sich bei Sonnenaufgang nach seiner wunderschönen Geliebten gesehnt. Er brauchte die Inspiration, er wollte noch einmal das Antlitz sehen, das ihn zu seiner höchsten Fertigkeit beflügelte.
Merkwürdig freundlich hatte ihn die Metze Veronica empfangen. »Guter Scoferino, auf Euch geht nun all unsere Hoffnung, bitte verzeiht, dass ich jemals unfreundlich gegen Euch war. Bedenkt, dass nicht nur Marietta Euch verbunden ist, sondern wir alle es sind.« Mit solchem und anderem Geschwätz hatte sie ihm den Weg in die Wohnkammern gewiesen, doch der Sessel am Fenster war leer.
»Wo ist sie?«, hatte er gefragt, und Veronica hatte stumm auf die Schlafkammer gewiesen.
»Oh, mein faules, süßes Liebchen«, hatte er gescherzt und die Tür aufgestoßen. Zugleich war er zurückgeprallt. Das war nicht Marietta, die ihm vom Bett aus entgegenblickte. Nicht die Marietta, die er liebte, verehrte, anbetete, zu seiner Frau nehmen wollte.
Die Frau, die ihm entgegenblickte mit flehenden, tränennassen Augen, hatte ein entsetzlich entstelltes Gesicht. Eine blutige Wunde klaffte auf ihrer linken Wange, kreuzweise Schnitte, die bereits leichten Schorf ansetzten und grässlich anzuschauen waren. Scoferino spürte, wie er in Gedanken an dieses schreckliche Bild wieder erbleichte. Übelkeit würgte ihn, genau wie an jenem Morgen. Er hatte nicht sprechen können, hatte geschwiegen, als die Gestalt mit der zerschnittenen Fratze mit der sanften Stimme Mariettas seinen Namen geflüstert hatte. »Scoferino«, immer wieder, »Scoferino.« Und damit war ihm zur entsetzlichen Gewissheit geworden, was seine nach Schönheit gierenden Augen nicht wahrhaben wollten.
Die Entstellte war Marietta. Und vor dieser Marietta war er geflohen. Noch immer gellte ihr verzweifelter Schrei in seinen Ohren. »Scoferino!«
»Herr, warum hast Du sie mir genommen. Warum hast Du so viel schöne Vollkommenheit zerstört?« Tränen flössen über seine Wangen, der lähmende Schmerz löste sich. Scoferino griff zum Pinsel, seine tief empfundene Verzweiflung drängte nach Ausdruck.
Ein heftiges Pochen an der Kammertür hinderte ihn am Beginn seines Werks. Ärgerlich wollte er es überhören, als eine angenehme Frauenstimme seinen Namen rief. Er riss die Tür auf und starrte in das Gesicht einer hässlichen Alten mit erstaunlich hellen, klaren Augen. Neben ihr stand ein dralles, junges Mädchen, das er glaubte zu kennen. Ihm fiel nicht ein, dass es die Wäscherin Mariettas war. »Was wollt Ihr?«, fragte er barsch und enttäuscht, dass die schöne Stimme zu einem so schäbigen Gesicht gehörte. Hässlichkeit war ihm zuwider.
»Wir kommen, um etwas über Marietta zu erfahren«, sagte Märthe sanft.
»Was habt Ihr mit ihr zu schaffen?«
Beatrice trat vor. »Ihr erinnert Euch vielleicht nicht an mich, aber ich bin die Wäscherin Beatrice, und ich sorge mich um Eure ..., um sie.«
Scoferino seufzte. »Sie wird nicht umkommen, hat mir der Mönch versichert.«
Märthe stutzte. »Nicht umkommen?«
»Er sagte, die Wunden seien grässlich, aber nicht tödlich.«
Beatrice meinte, das Herz müsse ihr zerspringen. »Redet endlich, wir wissen ja nichts von den Wunden, wo ist sie, was ist ihr geschehen?«
Nun war es an Scoferino, fragend dreinzublicken. »Verschwunden? Vor drei Tagen habe ich sie noch gesehen, in ihrem Haus, ihrem Bett ...« In Erinnerung an das grässliche Bild brach er ab.
Märthe drängte den verwirrten Künstler nun in seine Kammer, drückte ihn auf seinen Schemel und begann mit knappen Fragen. »Welche Wunden hat man Marietta zugefügt?«
Der gebieterische Ton brachte Ordnung in die Gedanken des Malers. »Es war ein sfregio. Die Narbenstrafe, Ihr wisst schon. Kein ungewöhnliches Schicksal für eine, eine Kurtisane.« Das letzte Wort gebrauchte er mit Widerwillen.
»Und niemand weiß, wer ihr diese Wunden zugefügt hat?«
»Nein.«
»Nun gut. Ihr spracht von einem Mönch, der Euch Auskunft gab. Wer war das?«
»Er fand Marietta in der Nacht, als man sie angegriffen hatte, und schaffte sie in ihr Haus. Er hielt dort Wache und versorgte wohl die Wunden. Sie schien in guten Händen.«
Beatrice hielt die Gelassenheit, mit der der Maler nun sprach, nicht länger aus. »Ihr wollt sagen, Ihr habt Euch nicht um Marietta gekümmert, seid einfach fortgegangen, habt sie ihrem Schicksal überlassen? Was seid Ihr für ein Mensch, was, wenn sie nun tot ist, wie Veronica?«
Scoferino verfiel wieder in Verwirrung. »Wieso verschwunden? Wieso Veronica tot? Die alte Metze war lebendig wie eh, als ich sie sah. Wovon sprecht Ihr? O Gott, all dieses Elend, dieses Leid, womit nur, womit habe ich es verdient?«
Beatrice schnappte nach Luft, das Herz tat ihr weh bei all der kalten Grausamkeit seiner Seele. Sie begriff mit dem untrüglichen Instinkt des Gossenkindes, dass dieser Maler aus vornehmem Haus eine selbstsüchtige Kreatur war. Mochten seine pompösen Bilder auch vom Himmelreich künden, er war ein niederträchtiges Geschöpf. »Ihr habt die verwundete Marietta allein und schutzlos zurückgelassen«, begann sie mit zornbebender Stimme, »obwohl mit einem weiteren Angriff zu rechnen war.«
»Aber, aber«, stammelte der Maler mit dem weichen Jünglingsgesicht und dem zarten, goldenen Flaum auf seinen weißen Wangen, »dieser Mönch war doch da. Und Marietta steht hoch in der Gunst irgendeines hohen Kardinals und ...«
Nun unterbrach Märthe ihn mit schneidender Stimme. »Beschreibt den Mönch.«
»Es war ein Dominikaner in weißer Kutte und mit schwarzem Skapulier. Er sprach das Italienisch mit hartem Akzent, so als stamme er aus dem Norden, von jenseits der Alpen.«
Märthes Züge waren auf das Höchste angespannt. »Wie sah sein Gesicht aus?«
Scoferino überlegte. Seine Zwiesprache mit dem Mönch war knapp genug gewesen, er hatte ihn nur im trüben Licht der Diele kurz gesehen, dennoch hatten sich seinem geübten Auge einige wesentliche Züge eingeprägt. »Er hatte ein hohlwangiges, vogelartiges Gesicht mit dünner, gekrümmter Nase. Würde ich den Judas malen, ich könnte mir kein trefflicheres Vorbild dafür denken.« Schon entfalteten sich in seinen Gedanken die ersten hauchzarten Skizzen. Judas, ja, das war ein Motiv, das seiner Seelenverfassung zusagte, ein düsteres, schweres, Unheil verkündendes Bild. Schon schweiften seine Gedanken wieder ab von dem Unglück seiner entstellten Geliebten. Beatrice bemerkte es mit Verachtung, am liebsten hätte sie den eigensüchtigen Mann von seinem Schemel getreten.
»Habt Ihr nach seinem Namen gefragt«, begann nun wieder Märthe.
»Er nannte sich Claudius, wenn ich mich recht erinnere.« Märthe erbleichte und schwieg.
Beatrice mäßigte ihren Zorn und presste eine weitere Frage hervor. »Ihr wisst nicht, wo Marietta nun sein könnte?«
Scoferino zuckte hilflos mit den Schultern. »Nein, ich, ich kann es mir nicht denken. Vielleicht hat sie jener mir unbekannte Gönner zu sich geholt. Er ist Marietta auf seltsame Weise zugetan, wie sie mir erklärte, obwohl er nicht ...« Er unterbrach sich. Wusste er denn wirklich, dass Marietta dem reichen Manne nicht zu Willen war? Musste er ihren Worten wirklich trauen? Beim Gedanken an eine mögliche Untreue und Unaufrichtigkeit seiner Muse entspannte er sich, ein Gefühl der Erleichterung hellte ihm die Seele auf.
Märthe hatte sich inzwischen gefasst. »Scoferino, habt Ihr einen Verdacht, einen wie geringen auch immer, wer Marietta Leid zugefügt haben könnte?«
Der Maler starrte gedankenverloren auf das Bild vor sich, betrachtete die alten Weiber und das verschiedene Volk zu Füßen des Kreuzes, den Blick auf das leere Madonnengesicht mied er.
»Gibt es jemanden«, so fuhr Märthe fort, »der Eure Beziehung zu Marietta eifersüchtig beobachtete?«
Scoferino schüttelte den Kopf. »Der Unbekannte war Mariettas einziger Gönner, ihm verriet sie nichts, da bin ich sicher. Und wenn, dann hätte der hohe Mann wohl eher mich als sie gestraft.«
»Gibt es jemand, der Euch Übles will? Hat einer einen Zorn auf Euch? Ein ehemaliger Freund, ein Verwandter?«
Der Künstler zuckte jäh zusammen, stöhnend vergrub er schließlich seinen Kopf in den Händen.
»Wer ist es? Wer?«, drängte Beatrice.
»Meine Eltern«, kam es verzweifelt von Scoferino. »O Herr, bitte verzeih mir, dass ich es sage. Aber ja, meine Eltern sind so voll Hass, weil sie ...«Er brach ab.
»Sie billigen Eure Beziehung zu einer Kurtisane nicht«, stellte Märthe nüchtern fest, »hat Euch das bislang gehindert, Marietta zu lieben?«
»Nein«, sagte Scoferino fest.
»Eine schöne Liebe«, giftete nun wieder Beatrice, »die erlischt, wenn das Idol ein paar Narben empfängt. Wie großherzig Ihr seid, wie empfindsam.«
»Was willst du?«, schrie Scoferino, »was weißt du davon.« Wild sprang er auf und riss ein Tuch von einer Leinwand weg. Es war, als fiele ein Bündel Lichtstrahlen in die Kammer, so golden und hell strahlten die Farben. Marietta lächelte als Madonna in all ihrer Glorie von der Leinwand herab. Märthe schaute sie bewundernd und voll Ehrfurcht an. Sie schlug gar ein Kreuz. Nein, das war keine vergängliche Schönheit, das war eine Schönheit, die einen Funken Göttlichkeit und Seele in sich trug. »Eine Erwählte«, flüsterte Märthe.
Nun begriff sie, warum Beatrice die Marietta vergötterte. Wer wagte es, wer war so verworfen, ein solches Gesicht zu zerstören?
Beatrices Augen schwammen in Tränen, als sie das Bildnis betrachtete. Scoferino sah es mit Befriedigung. »Weißt du nun, was es mir bedeutet, dass einer diese Schönheit auf immer zerstört hat? Kannst du meine Trauer nun begreifen? Es ist mehr als der Kummer eines verzweifelten Liebhabers. Ich habe Marietta zu einer Ewigkeit verholfen, ich habe sie erhöht, habe ihre Schönheit der Vergänglichkeit entrissen.«
Beatrices Gesicht verhärtete sich wieder.
»Ich begreife nur, dass Ihr nie einen Blick in ihre Seele getan habt. Ihr seid ein gotteslästerlicher Mensch. Komm Märthe, die Luft in dieser Kammer verursacht mir Übelkeit.«
Und zu Scoferino gewandt, setzte sie hinzu: »Möge der Herr Euch den Lohn geben, den Ihr verdient.«
Der bargello hatte seine Männer mühsam zusammengesucht. Die meisten fand er tatsächlich in einem der zahlreichen Gasthäuser längs des Campo dei Fiori, wo sie prahlend und saufend ihre Zeit verbrachten. Der Fund des Frauenkopfes hatte ihnen reichlich Zuhörer verschafft, und gegen einen Krug Wein ließen sie sich herab, die Entstellungen des Opfers immer blutiger und farbiger zu schildern. »Alle Zähne hatte man ihr einzeln ausgerissen, der Kopf war nicht sauber abgekehlt, und so hing noch ein Stück der Wirbelsäule heraus. Die Haare ihrer Perücke waren rot wie Blut.«
»Da hat der Teufel selbst Hand angelegt, das schwöre ich.«
Der Haftrichter des Governatore di Roma hatte das eilends ausgestellte mandatum ad capiendum in seiner ledernen Amtstasche verstaut und auch seine gewaltige Geldbörse. Eine Rodiconda konnte man bei der Überbringung des Haftbefehls ordentlich zur Kasse bitten. Jeder Beklagte hatte sein Scherflein für die Unterbringung und Verpflegung im Kerker zu zahlen, und La Luparella würde sich gewiss sogleich für mehrere Kammern statt einer billigen Zelle entscheiden, was einige Karlini einbringen würde. Nach dem Verhör beim Kardinal Falvini würde man sie sofort ins Gefängnis am Tor di Nona verbringen.
So setzte sich der Trupp schließlich in Bewegung, ritt am östlichen Tiberufer bis zur Höhe des Ponte Sisto und überquerte dort den Fluss, der in der späten Nachmittagssonne glasigblau schimmerte. Die letzten Wäscherinnen am Brunnenbecken strichen sich die feuchten Haarsträhnen aus der Stirn.
»Seht die sbirri, was für ein prächtiger Aufzug. Ich weiß nicht, wen ich mehr bewundere, die Männer oder ihre Maultiere.« Das Gelächter der Frauen klang schwach zu den Reitern herüber. Drohend blickte sich einer um, und die Frauen beeilten sich, die Köpfe tief über ihre Arbeit zu beugen.
»Saukerle«, murmelten einige dabei ihren Leintüchern zu.
Den berittenen Ordnungshütern kam ein flinker Mann auf Sandalen zuvor. Am anderen Ufer des Tibers, wo an den Hängen des Gianicolo zahlreiche Villen vom Reichtum der Bewohner kündeten, ließ sich der Dominikaner Claudius als Gesandter des Kardinals della Guarde bei Rodiconda melden. Mit einiger Verwunderung gab die Kurtisane ihrer Zofe Befehl, den Mann vorzulassen. Einen della Guarde beleidigte man nicht, auch nicht seinen Boten.
Sie zog ihren pelzgefütterten Hausmantel enger über ihre Blößen. Nicht aus Schamgefühl, sondern weil sie einem so schäbigen Kirchendiener, wie ein Mönch es gemeinhin war, nicht kostenlos den Genuss ihrer Reize verschaffen wollte. Und um den niederen Gast nicht auf falsche Gedanken zu bringen, setzte sie sich an ihr Klavichord und begann, sich in eine Fingerübung zu vertiefen. Eifrig liefen ihre schlanken Finger über die Tasten. Ein Pfau im Garten stieß einen gequälten Brunftschrei aus. »Du verachtest wohl meine Musik«, sagte Rodiconda mit amüsiertem Lächeln.
»Oh, keinesfalls.« Die Stimme riss sie so plötzlich herum, dass sich ihr Mantel nun doch öffnete und den zarten Schimmer ihres Dekolletés enthüllte. Ärgerlich herrschte die Stolze den Mönch im weißen Habit an. »Wie kannst du es wagen, mich so zu überfallen? Ich werde dich hinauswerfen lassen.«
Sie griff nach einem bestickten Glockenzug. Claudius rührte sich nicht, um seinen dürren Mund spielte ein beinahe mitleidiges Lächeln. »Es ist gut, dass Ihr Eure Dienerschaft zu Hilfe ruft. Sagt ihnen, sie sollen die Wachen am Portal verdoppeln und zwei Maultiere für uns am Gartentor bereitstellen. Ach ja, und Eure Kammerzofe soll Euch rasch ankleiden. Ich empfehle Euch die Männerkleidung, die Ihr so liebt. Hosen, Wams, eine Schaube und ein Barett, das groß genug ist, um Eure Lockenpracht zu verbergen.«
Rodiconda zog energisch an dem Glockenstrang, die Tür flog auf, und ein bewaffneter Höfling lief in den Saal.
Der vogelgesichtige Mönch hob die Arme und streckte ihm die geöffneten Handflächen entgegen. Doch er lachte dabei. »Werft diesen schäbigen Hundsfott raus!«, schrie Rodiconda auf das Äußerste erbost. Der Mönch wirbelte herum. »Davon rate ich ab. Ich und der Kardinal sind die Einzigen, die Euch vor einer Verhaftung bewahren können. Der neue Kardinalkämmerer Falvini hat sie bereits angeordnet.«
Rodiconda wich zurück, tastete nach dem Klavichord, um sich abzustützen. Der Wächter hielt ratlos inne und blickte sie an. »Es ist gut«, presste La Luparella mühsam hervor, »geht und besorgt alles, was der Mönch will.« Schnell und präzise gab Claudius seine Anweisungen. Als der Wächter den Raum verlassen hatte, fragte die Kurtisane. »Was soll das? Was hat der Kardinal gegen mich vorzubringen, und wer seid Ihr?«
»Euer ergebener Diener«, Claudius deutete spöttisch den Kratzfuß eines Höflings an. Rodiconda schleuderte ihm wütend einige Notenblätter vor die Füße.
»Treibt keine Spiele mit mir. Was wollt Ihr?«
»Euch beschützen vor dem Zorn eines mächtigen Mannes, der Euch des Mordes beschuldigt.«
»Mord?« Rodiconda lachte kalt. »Der hässliche Montefiscone starb an Schlagfuß, meine Spitzel und ganz Rom wissen es.«
»Nicht den bedauernswerten alten Mann sollt Ihr getötet haben.«
»Wen dann?«, fragte Rodiconda, und ihre Augen verengten sich zu leuchtenden Schlitzen.
»Die kleine Hure Marietta.«
»O Gott«, stöhnte Rodiconda, »Falvini wagt es tatsächlich.«
Aus ihrer Stimme sprach kältester Hass. »Wo wollt ihr mich hinbringen?«
»Das lasst meine Sorge sein. Der Ort ist sicher, das soll Euch genügen.«
»Ich warne Euch noch einmal, spielt keine Spiele mit der Wölfin.« Die goldenen Sprenkel in ihren dunklen Augen glühten.
»Mäßigt Euch, gute Frau«, sagte Claudius warnend, »ich diene dem Kardinal della Guarde. Ich denke, der Name ist Bürgschaft genug für meine lauteren Absichten.« Die Rodiconda lachte grell. »O ja, nun begreife ich. Der Kardinal della Guarde. Wer garantiert mir, dass Ihr nicht ein elender Schwindler seid, dass Ihr nicht ein schmutziges Komplott gegen mich geschmiedet habt? Della Guarde ist ein Mann mit vertrockneten Schenkeln und verknöchertem Geist. Er hasst mich so sehr wie er Falvini hasst.«
Der Wächter stürmte wieder herein. »Es ist wahr, die sbirri reiten die Hügelstraße herauf, die Staubwolken sprechen für einen großen Trupp, Ihr müsst fliehen!«
Rodiconda raffte ihren Mantel und eilte zu einem der Fenster, die auf die Straße hinausgingen. Sie öffnete es und beugte sich weit vor. Die Sonne stand bereits tief über dem Westufer des Tibers. Begleitet von langen Schatten ritt eine Gruppe von zehn oder zwanzig Männern von rechts die Anhöhe herauf, an ihrem Ziel und ihrer Absicht bestand kein Zweifel. Rodiconda erkannte die blitzenden Eisenhelme und begriff, dass ihr keine Zeit blieb, länger zu zögern oder die genauen Absichten des seltsamen Mönches zu erforschen.
»Gut. Ich folge Euch«, sagte sie zu ihm gewandt, »aber ich warne Euch. Auch wenn Ihr mich nun in einer Notlage findet, meine Mittel sind nicht erschöpft und meine Freunde zahlreich.«
Der Dominikaner lächelte abfällig. »Wohl dem, der solche Freunde hat wie den Kardinal Falvini«, sagte er gehässig.
Die Wölfin warf ihm einen hasserfüllten Blick zu. Sie wusste, dass der Kerl ein Betrüger sein musste, doch sie ahnte nicht, dass er es gewesen war, der ihr Amulett in die Schlafkammer Mariettas praktiziert hatte.
Stumm wiegte Marietta ihr Kind. Der Knabe griff mit den Händchen nach ihrem Gesicht, doch seine Mutter wich ihm aus. Jedes Mal wenn er die Leinenverbände an ihrem Gesicht berührte, durchfuhr sie ein Schmerz. Das Kind erhob ein bitteres Geschrei. »Mein Liebstes, wirst du mich auch hassen, wenn du verständig sein wirst und deine Augen offen für die Welt?«, flüsterte die Kurtisane mit zitternder Stimme. Die Erinnerung an Scoferinos entsetztes Gesicht sorgte für einen reißenden Schmerz. Wieder füllten sich ihre Augen mit Tränen. Energisch wischte sie sie fort.
»Nein. Ich bin ein dummes Weib. Es war nur der Schock. Bei allen Heiligen, wie entsetzt war ich selbst, als ich mich zum ersten Mal im Spiegel sah.« Der Knabe auf ihrem Schoß beruhigte sich beim Klang der ihm vertrauten Stimme und stieß fröhliche Laute aus. »Er wird uns wieder lieben, mein Kind, mein süßer Prospero, ich verspreche es dir. Sein Gemüt, diese Empfindsamkeit vertrugen den Anblick nicht. Ja, er wird uns wieder lieben.«
Von diesem Gedanken ermutigt, stand sie auf und trat an das vergitterte Fenster der engen Zelle. Ein magerer Lichtstrahl malte einen dünnen Streif auf den kalten Ziegelboden. »Herr, gib mir die Kraft und die Geduld zu warten.« Sie wagte nicht, den Mönch in ihr Gebet mit einzuschließen. Sie dachte jedoch an seine süßen Versprechungen. »Ich werde dir deine Schönheit zurückgeben, meine Tochter, und verlange nur einen geringen Dankesbeweis dafür. Vertraue mir, ich verstehe mich auf die Heilkunst. Und es ist Gottes Wille, dass du schön bist.« Bereitwillig war Marietta ihm schließlich gefolgt, denn Scoferinos Liebe erschien ihr als das Kostbarste, was sie je erfahren hatte, und sie wollte sie mit aller Macht wiedergewinnen.
Warum aber, warum nur misstraute sie dem großzügigen Mönch so sehr? Warum graute ihr bei dem Gedanken, wie er ihre famiglia versorgen und betreuen würde? Nur weil der arme Dominikaner mit einem so wenig liebenswerten Gesicht geschlagen war, musste er kein schlechter Mensch sein. Auch ihr Antlitz war nun entstellt, und dennoch nahm er sich ihrer an. Und das, obgleich es im Kloster der Reuerinnen Vorschrift war, nur schöne, junge Kurtisanen aufzunehmen. Auf diese Weise wusste man zu verhindern, dass eine alternde Dienerin der Venus nur auf Grund ihrer schwindenden Verdienstmöglichkeiten den Schleier nahm.
Marietta kannte das Gesetz genau.
Vielleicht schlug in der Brust des Beichtvaters also tatsächlich ein mitfühlendes, wahrhaft christliches Herz. »Gott segne ihn«, flüsterte Marietta. Der Sonnenstrahl zu ihren Füßen verschwand mit einem Schlag. Marietta musste sich zwingen, es nicht als böses Omen zu nehmen. »Es wird Nacht, mein Liebster, fürchte dich nicht«, raunte sie ihrem Kind ins Ohr.
Märthe hängte einen kleinen Kupferkessel in den Haken über der Feuerstelle und drehte mit einer Winde die Kette herab. Die Flammen begannen gierig den Boden des Topfes zu lecken. Märthe goss eine Kelle Öl hinein, legte einige Knochen und Gemüse in den Topf, nahm dann ein Bündel trockener Kräuter, zupfte sie auseinander und warf sie dazu. Beatrice saß am groben Tisch der winzigen Küche und zerstampfte einige Körner und merkwürdige Samen. »Was soll das werden, Märthe? Ein Zaubertrank?«, fragte sie argwöhnisch.
Die Alte lächelte verschmitzt. »Warte ab, warte ab, mein liebes Kind.« Ein aromatischer Duft entstieg nun dem Kessel mit dem Kräutersud. Beatrice erkannte das Aroma von Estragon und beruhigte sich, das roch nicht nach Teufelswerk.
»Verzeiht, aber Ihr werdet mir ein wenig unheimlich, Märthe«, sagte sie zaghaft, »all Eure Andeutungen, Eure Bemerkungen über das Zweite Gesicht. Vergebt mir meine Offenheit, aber Ihr solltet Euch vorsehen, darüber mit zu vielen Menschen zu sprechen.«
Märthe lachte leise, dann zog sie einen dreibeinigen Schemel zum Tisch und setzte sich der jungen Wäscherin gegenüber, um einige Zwiebeln zu zerteilen.
»Du bist ein liebes Mädchen, Beatrice. Ich kann dir doch vertrauen?«
Das Mädchen errötete leicht und warf einen flüchtigen Blick auf die Alte. »Ja«, sagte sie dann, »aber bitte erklärt mir die Sache mit diesem Mönch, der Euer Bruder und ein Teufel sein soll.«
Märthe seufzte. »Es ist eine lange Geschichte. Hast du je von den Bauernkriegen gehört, die im letzten Jahr in Deutschland wüteten?« Beatrice seufzte, warum war die sonst so besonnene Märthe nur so sprunghaft in ihren Gedanken, seit der vermaledeite Mönch ihre Gedanken gekreuzt hatte. Märthe fuhr ungerührt fort. »Nun, eine große Anzahl aufrechter Prediger und Christen begannen einen Kampf für eine Umkehr im Glauben, gegen die willkürliche Ablasspolitik des Papstes und die Verderbtheit Roms. Die Bauern folgten ihnen, da sie große Not litten und die Abgaben an Kirche und Landesfürsten sie hart drückten. Es war ein blutiger Kampf, den die Bauern mit Sensen und Dreschflegeln ausfochten und Gottvertrauen. Aber sie unterlagen. Es war ein schreckliches, großes Sterben.«
Beatrice zuckte die Schultern. »Auch wir Römer kennen die Sündhaftigkeit einiger Kirchendiener, aber wir vertrauen auf Gottes Strafgericht. Na ja, und einige halten sich schadlos, indem sie nach dem Tod eines Kirchenfürsten seinen Palast plündern. Aber das echte Kriegshandwerk überlassen wir den mächtigen Männern. Es ist schiere Dummheit, sich als gemeiner Mann gegen die Macht der Kirche aufzulehnen. Man sollte damit zufrieden sein, ihre Herrlichkeit zu bewundern, und die ist gewaltig.«
»So herrlich, liebes Kind, erschien den deutschen Bauern die Kirche nicht. Du vergisst, in Deutschland lebt man fern von Rom und seiner tröstlichen Prächtigkeit. Den Ärmsten war es leid, dafür zu zahlen.«
»Ihr meint, sie wollten nicht mehr recht glauben, was sie ohnehin nie zu Gesicht bekommen, nie mit eigenen Augen sehen. Die sieben Hauptkirchen, das Grab Petri, die glanzvollen Messen und Prozessionen.«
Märthe nickte. »Ich wusste, du bist klug, Beatrice, was du gerade gesagt hast, ist aber sogar weise.«
Beatrice schaute verwundert auf. »Wieso das?«
»Nun, du erkennst, dass die Menschen leicht an dem zweifeln, was sie nicht sehen können. Und diese Fähigkeit zum Zweifel ist ein Geschenk Gottes. Du besitzt es, schließlich zweifelst auch du an der Existenz von Spukgestalten und Dämonen.«
»An die Ihr glaubt?«
Märthe schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nur an das Böse im Menschen. Claudius, der geheimnisvolle Mönch, ist nichts als ein gieriger, machthungriger, selbstbegeisterter Mann, der sich die Mächtigen zu Nutze macht und gerade der Seite zuneigt, die schnelles Fortkommen verspricht. Rom ist der ideale Ort für einen Mann wie ihn, hier, wo Schmeichelei und Intrigen den Weg nach oben öffnen. Intrigen spann er auch im Bauernkrieg, ging einmal in der Maske des Rebellen und schlug sich im nächsten Moment auf die Seite der Fürsten. In beiden Gewändern unternahm er die niederträchtigsten Verbrechen. Er verfügt über gewisse Talente. So hat er in Köln im vergangenen Jahr eine schreckliche Pestilenz verbreitet.«
»Schon wieder sprecht Ihr von unmöglichen Zaubereien! Die Pest wird durch ungünstige Winde verbreitet, das weiß ein jeder.« Beatrice hob drohend den Mörser.
»Lass gut sein, mein Kind. Der Mönch ist und bleibt ein Vertreter Satans.«
Beatrice bekreuzigte sich, den Namen des Höllenfürsten sprach man nicht einfach so aus. Märthe schüttelte amüsiert den Kopf. »Du bist also doch ein wenig abergläubisch. Aber keine Angst, den Spuk, den Claudius gemeinhin treibt, nenn auch ich Humpelwerk und Puppensünden. Gefährlich macht ihn sein kalt berechnender Verstand.«
»Aber was hat das mit Marietta zu tun?«
»Wenn ich es nur wüsste. Wo Claudius die Hand im Spiel hat, geht es um mehr als eine einfache Bluttat. Gott hat meine Schritte nicht zufällig hierher gelenkt. Damals zu Köln bin ich vor meinem Bruder geflohen, in der Gewissheit, dass er seine gerechte Strafe aus anderer Hand empfangen würde. Doch ich habe mich getäuscht. Der Herr will, dass ich diese Aufgabe erledige, obwohl es mich in schreckliche Gewissensnot stürzt.«
Beatrice ließ den Holzmörser fallen und stöhnte. »Oh, Märthe. Ich werde aus Euch nicht klug. Im einen Moment verwerft Ihr all die Teufelsbübereien Eures Bruders als hohles Geschwätz, und dann gebt Ihr Euch selbst als Seherin. Willst du in dem Brei, den ich hier bereite, etwa die Zukunft lesen, soll ich dir einige Fischmägen besorgen, aus denen du unser Schicksal deuten willst? Oder fütterst du damit deine fliegenden Boten?«
Märthe lachte. »Ein Gutes hat deine Wut, mein Kind, endlich gibst du alle Förmlichkeit auf und wählst die direkte Anrede.«
»Verzeiht, gute Frau«, erschrocken schlug sich die Wäscherin die Hand vor den Mund.
»Lass gut sein und sei mir als Gast in meinem Hause willkommen. Ich kann deine Hilfe brauchen, und deine famiglia wird froh sein, wenn sie ein Maul weniger zu stopfen hat.«
Beatrice blickte verlegen zu Boden. »Aber ich kann dir doch das Kostgeld nicht zahlen«, sagte sie.
»Das brauchst du nicht. Gib deinen Verdienst weiter deinem Vater. Auch ich werde dir Lohn zahlen, denn glaub nicht, dass ich keine Arbeit für dich hätte.«
»Was soll ich tun?«, fragte erfreut die Wäscherin.
Märthe nahm Beatrice die Breischüssel aus der Hand, ging zum Kupferkessel und goss eine Kelle des duftenden Suds darüber. Sie kehrte zum Tisch zurück und stellte die Schüssel ab. »Nimm dir einen Löffel und iss.« Beatrice tauchte den Holzlöffel in den Brei, nahm einen Bissen und verdrehte genüsslich die Augen. »Mmmh, das ist gut«, murmelte sie mit vollem Mund. »Aber was tun wir als Nächstes, Märthe, die Zeit drängt.«
»Es wird bereits Nacht, mein Kind.«
»Nun gut, aber wie steht es mit morgen?«
»Ich weiß es nicht. Lass uns abwarten.«
»Warten? Worauf? Auf ein Wunder?«
»Nein, auf meinen fliegenden Boten. Einen weißen Raben.«