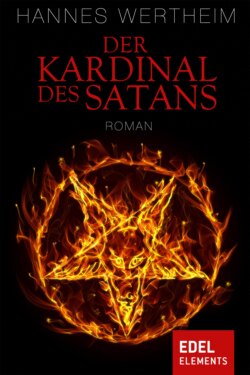Читать книгу Der Kardinal des Satans - Hannes Wertheim - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
Оглавление»Das ist die römische Kirche, das Haupt der Welt? Das ist ein Schweinestall!«
Ponto Cosentino, »Romytipion«, 1524
Die brennende Augustsonne hatte den feuchten Böden der Wein- und Gemüsegärten längs des Tibers einen dichten Dunst entzogen und ihn wie einen Schleier über die Stadt gelegt. Die Schwüle lag am Abend noch wie ein schlecht gewrungenes Leintuch drückend in der schmalen Gasse. Eng gedrängt standen hier – unweit der Kardinalsund Kaufmannspaläste der prächtigen Via Giulia – die einfachen Häuser von Handwerkern und kleinen Händlern. Nur wenige von ihnen verschwendeten ihre sorgsam zusammengehaltenen Karlini für Türfackeln. Deshalb herrschte in dem Gässchen, als die Glocke von San Andrea de Valle die elfte Stunde schlug, bereits tiefe Finsternis.
Erschöpft von der Hitze öffnete Marietta die Holzläden vor den beiden Fenstern ihrer Wohnkammern.
Sie sog, in der Hoffnung auf Abkühlung, die Nachtluft ein und wurde mit dem faulig aufsteigenden Geruch von Gemüse- und Fischabfällen belohnt. Die Tage, da sie selbst noch an der Via Giulia mit Blick auf den Tiber residiert, ja nachgerade Hof gehalten und ihre Gemächer mit Ambra und Zibet parfümiert hatte, waren lange vorbei. Konnte sie sich vor acht Jahren noch eine Wohnung zu einer Jahresmiete von 200 Scudi leisten, so fiel es ihr heute schon schwer, die 5 Scudi für ihre bescheidene Behausung an der Händlergasse aufzubringen. Die Sorgen um ihre famiglia – sechs gefräßige Verwandte und Dienstboten hatte sie zu füttern – waren oft quälend. An die eigene Zukunft wagte Marietta mit ihren immerhin schon 32 Jahren kaum zu denken. So vieles hing ab von der Gunst des wankelmütigen und unberechenbaren Kardinals.
Seufzend rückte sie einen kleinen Sessel in die Nähe der Fenster, streifte ihre abgeschabten Samtpantoffeln, die vom Glanz vergangener Tage berichteten, von den Füßen, öffnete die Schnürungen ihres gestickten Mieders und lehnte sich träge zurück. Heute würde der Kardinal sie gewiss nicht mehr zu sich rufen. Das ermüdende Warten hatte zwar ein Ende, aber in ihrer Kasse gähnte einmal mehr ein tiefes Loch.
Nun, die kleine Wäscherin Beatrice würde noch etwas auf ihren Lohn warten müssen, sie war ein sanftes Ding und würde nicht maulen. Marietta lächelte bei dem Gedanken an das muntere, rotwangige Mädchen, das sie so oft aus trübseliger Stimmung gerissen hatte. Die Wäscherin hing mit seltsamer Zuneigung an ihr. Nein, es ging nicht an. Beatrice musste und sollte morgen bezahlt werden.
Sie, Marietta, würde zur Vesper eben nur etwas Gerstenbrei servieren, dann sollte das Geld reichen und noch langen bis Seine Eminenz wieder ihre Dienste beanspruchte.
Sie fuhr sich mit der Hand über die feuchte Stirn, so als wolle sie die emporsteigenden Bilder von dem Purpurträger verwischen, der gierig die Hände nach ihr ausstreckte und lustvoll in ihr Mieder gleiten ließ. Es waren kalte, grausame Hände, deren Berührung sie jedes Mal zittern ließ. Und doch, der allseits gefürchtete Mann schien ihr wohlgesonnen, sein Blick verlor an Kälte, wenn er sich ihrer bediente und sie dabei betrachtete. Ausgerechnet sie, deren Geschäfte ansonsten so schlecht standen. So schlecht, dass sie nicht mehr daran denken wollte und den schützenden Mantel des Schlafes herbeisehnte.
Gerade wollten Marietta die Augen zufallen, als schlurfende Schritte auf dem Gang Besuch ankündigten. Entweder war es der Hausdiener, der vor dem Zubettgehen nach Aufträgen für seine Einkäufe auf dem Campo dei Fiori fragen wollte, oder die lästige Veronica. Marietta runzelte die Stirn.
Warum hatte sie sich je auf dieses Weib eingelassen, war ihren Einflüsterungen erlegen? Eine alte, habgierige Kupplerin war sie, und eine Plage überdies. Und doch fühlte sie sich immer noch in ihrer Schuld, und Veronica ließ keinen Tag verstreichen, ohne sie diese Schuld spüren zu lassen, sie zu verletzen und zu beleidigen.
Ohne zu klopfen, stieß nun tatsächlich die Alte die Tür zur Kammer auf. Eine unordentliche Gestalt mit schmutzigem Rock und gebeugtem Rücken. Allein auf ihrem Kopf herrschte künstliche Ordnung: Eine feuerrot gefärbte Perücke aus Pferdehaar türmte sich, durchflochten von falschen Perlen aus gelblichem Wachs, auf ihrem kahlen Schädel. Niemand hätte in den verhärmten, bitteren Zügen der Alten die einst gefeierte Hure Isabella la Luna wiedererkannt, die im ersten Jahrzehnt des goldenen Zeitalters, es war um 1507 gewesen, für eine der Schönsten ihrer Zunft gegolten und Verehrer unter den höchsten Vertretern der Kurie und der Kaufmannschaft gehabt hatte. Das Alter war bei Gott ein Fluch.
Noch weniger hätte einer, der vor zwanzig Sommern verzückt ihrem viel gepriesenen Gesang und Lautenspiel gelauscht hatte, ihre nun greinende Stimme mit der stolzen Isabella in Verbindung gebracht. Ihr schlecht sitzendes, aus Hartholz geschnitztes Gebiss begleitete die jämmerliche Stimme mit beharrlichem Klappern. »Was für ein Unsinn, die Fenster zu öffnen«, schimpfte sie und schlurfte, die Pantoffeln Mariettas beiseite tretend, durch den Raum. Unwillig richtete Marietta sich auf. »Lass sie offen, es ist so stickig in dieser Nacht, ich brauche Abkühlung.«
Die Witwe achtete nicht auf den Einwurf und schlug polternd die Läden zu. »Du weißt selbst, welches Gesindel sich des Nachts herumtreibt. Erst gestern berichtete mir der Pescatore, man habe ihm eine Brandfackel in die Stube geworfen. Überall fliegen Steine, kein Haus ist sicher vor Übergriffen. Schon gar nicht das Haus einer käuflichen Frau. Der junge Capezza und seine Horde haben eine sfida gegen die Pomponelli ausgerufen. Sie schlagen sich in der Gasse und machen Jagd auf das Dirnenhaus am Ponte Sisto und alle leichten Mädchen. Erst gestern schwamm der Leichnam einer Unbekannten im Tiber. Sie sollen sogar bei der vornehmen Saltarella eingedrungen sein, obwohl sie die Gunst des Kaufmanns Zoppino genießt. Und du? Zwei Diener hast du, taub der eine, lahm der andere, doch du öffnest den Mördern die Fenster. Glaubst du, sie machen Halt vor einer wie dir?«
Die Alte mühte sich um ein höhnisches Gelächter, das mehr zu einem Rasseln geriet, untermalt vom rhythmischen Klappern ihres Gebisses.
»Ob es die offenen Fenster sind oder der nicht mehr frische Fisch zu Mittag, du wirst immer die gleiche Melodie anstimmen. Ich bin nichts wert, habe dich verraten und um dein Glück gebracht, nicht wahr?«, gab Marietta gereizt zurück. Die Linien um ihren vollen, weich geschwungenen Mund verschärften sich und verrieten bei allem noch bewahrten Liebreiz ihrer Züge das Herannahen des Alters.
Veronica schnaubte. »Welche Melodie soll ich dir auch sonst singen? Dein Leichtsinn, deine Unvernunft, dein verstocktes Wesen haben uns alle ins Elend gebracht. In einer schäbigen Gasse zwischen Lumpen und kleinen Händlern müssen wir leben, nur weil du einer unsinnigen Laune folgst.«
»Man nennt diese Laune gemeinhin Liebe, Veronica. Sie befällt einen Menschen, ohne dass er sich ihrer erwehren kann. Nenn es eine Krankheit, ein Fieber, aber niemals eine Laune. Launen sind flüchtig. Ich habe die Liebe gewiss nicht erwartet, aber ich umarme sie nun in Freuden, denn sie ist köstlicher als alles Geld.« Marietta beugte sich vor und angelte nach einem der Pantoffeln. Veronica stieß ihn – erstaunlich gewandt – noch weiter unter den Sessel. Es waren solche kleinen Gemeinheiten, mit denen sie ihrer ohnmächtigen Wut Ausdruck zu verleihen pflegte.
»Liebe«, brummte sie dabei unwillig, »Liebe. Eine Narrheit nenn ich das. Sprich mir nicht von Liebe. Die Welt ist nicht dafür gemacht, und schon gar nicht du, Tochter einer Fischerhure und eines armseligen, geilen Diakons oder eines betrunkenen Münzschabers. Du solltest wissen, was dir gebührt und wo du hingehörst.«
»In ein Bordell oder das Prostibulum am Ponte Sisto vielleicht?«, fragte Marietta spitz, griff unter den Sessel und holte den Pantoffel hervor.
»Ja, dort wärest du gewiss gelandet, als schäbige puttana, wenn ich dich nicht aus dem Kloster der heiligen Maria Maddalena geholt, an Kindes statt angenommen und wie meine eigene Tochter gekleidet und genährt hätte.«
Ungeduldig schlug Marietta mit dem Pantoffel gegen die Sessellehne, so als wolle sie das Klappern des Gebisses und die immergleiche Litanei übertönen. Veronica ließ sich nicht beirren. »Alle meine Künste habe ich dich gelehrt, deine Haut mit Eselsmilch und reinem Salz in Samt verwandelt, dich den stolzen Gang gelehrt, deine Sprache verfeinert, dich im Gesang unterwiesen. Du warst schön wie ein Engel, du hättest die größte deiner Zunft werden können. Die erste Dienerin der Venus, die Königin von Rom. Wenn ich nur daran denke, was ich an dich verschwendet habe, statt mir eine schmiegsamere Schülerin zu nehmen, die weiß, was sich gehört.«
Marietta nahm nun den Pantoffel in die Rechte, verneigte sich spöttisch vor der Schuhspitze und begann einen Dialog mit dem schäbigen Schuhwerk. »Oh, Euer Heiligkeit, darf ich heute Nacht Eure Dienerin sein? Wollen wir mit den Füßen musizieren? Liebt Ihr die Prälatenspeise, wollen wir den Kranich machen, die Kirche im Glockenturm, oder soll ich mich als Knabe kleiden? Schätzt Ihr die verkehrte Venus oder doch das Argument von vorn? Wie, ich soll Euch nur herzhaft küssen? Auf den nackten Hintern? Auf Euren was? Oh, Monsignore, was seid Ihr für ein Schelm! Dies tatenlustige, saftgeschwollene Ding ist doch kein Bischofsstab.« Affektiert drückte sie einen Kuss auf die Pantoffelspitze, dann schleuderte sie den Schuh wie angewidert von sich.
»Und das nennst du Kunst? Widerwärtig nenne ich es, diese gezierte Geilheit. Und du willst meine Mutter gewesen sein? Eine Mutter, die eine kaum Sechzehnjährige an einen alten Bock verschachert? Sie mit schlüpfrigen Reden verführt und gleich dreimal ihre Jungfernschaft verkauft? Du hast mich zu Unzucht und Lüge erzogen. Ich bin dir bei Gott nichts schuldig.«
»Ich hätte es wissen müssen«, zischte Veronica und trat mit kalt funkelnden Augen ganz nah an Marietta heran, »an dir klebt immer noch der Geruch des Fischerviertels. Alle Verfeinerung war umsonst, alle Vornehmheit liegt dir fern. Worüber du so abfällig spottest, das sind die großen Künste der Verführung. Du hättest eine Dame sein können. Reicher als jede Honesta, verehrter als jede Patrizierin. ›Terra da donna‹ nennt man Rom, die Erde der Frauen, und das ist wahr. Hier, wo die Männer so in der Überzahl sind, dass selbst die schäbigste Wäscherin noch einen Gönner findet, und sei es nur ein armseliger Brevenschreiber, den der Zölibat arg ankommt, hättest du die Kaiserin sein können.
Aber du hast deinen Gönnern, darunter die vornehmsten Herren der Stadt, auf dem Höhepunkt deiner Laufbahn die Tür gewiesen, um deine Schenkel für einen Habenichts und Halunken mit wirrem Verstand zu öffnen, der dir nicht einen schäbigen Bajocco einbringt, t’un cervello digallina.«
Marietta ertrug die Schelte gegen sich selbst mit Demut, doch die Schmähung des Geliebten als Habenichts und Spatzenhirn weckte ihren leidenschaftlichsten Zorn.
»Scoferino ist ein begnadeter Künstler, und du weißt es. Er wird einst zu den größten Malern unserer Zeit zählen, größer vielleicht als Raffael, dem man immerhin den Kardinalshut angetragen hat. Und Scoferino macht mich jetzt schon reich mit seiner Liebe. Ich bange nicht, dass er eines Tages auch die von dir so angeschmachteten Dukaten einheimsen wird, also benimm dich, wie es einer ehrwürdigen Witwe gebührt, sonst verlierst du deinen künftigen Anteil.«
Doch so leicht war Veronica nicht zum Schweigen zu bringen, schon gar nicht mit versprochenen Dukaten. »Lieber heute das Ei als morgen die Henne. Du sprichst von Geld, das ich nicht klimpern hören kann. Das ist weniger wert als Eselsdreck.« Erregt ordnete sie die von Honigwasser steifen Pferdehaarsträhnen, als gälte es, vor einem Bankett beim Papst letzte Hand an sich zu legen. Dann streckte sie den Rücken, so gut es ging, und hob das Haupt, so hoch es die Perückenpracht zuließ.
»Dein so genannter Maler, dieser Schmierpinsel, hat dir mit einem ganz anderen Werkzeug den Kopf verdreht«, sie machte eine obszöne Geste in Richtung ihres Schoßes, »ich weiß es wohl. Wie viel verliebte Dirnen hab ich schon erlebt, die, weil einer es ihnen recht besorgte, alle Vorsicht, alle Fertigkeit und allen Verstand verloren. Die Kerle genossen es sehr, sich mit einer stöhnenden Nymphe im Bett zu wälzen, prahlten noch herum, was für verteufelt gute Liebhaber sie seien, dass selbst eine käufliche Frau in Liebe zu ihnen entbrenne. Solange es ihnen gefiel. Danach stießen sie die dummen Huren von sich, in den tiefsten Schmutz und spuckten darauf. Marietta, warum bist du so blind!«
Ein seltener Ton von Mitleid mischte sich in die Worte, doch schnell fing sich die Alte wieder und schloss im Ton der Verachtung. »Ich hielt dich für klüger, nur weil du schöner als die meisten warst. Hätte ich dich nur nie gesehen! Diavolo, was ist nur dran an dir, dass du die Menschen so für dich einnimmst?«
»Frag dich selbst, ich weiß es nicht. Du hast mich unter allen anderen Waisenmädchen ausgesucht, vergiss das nicht«, erwiderte Marietta, machte eine Pause und setzte spöttisch
»Mutter« hinzu. Der Schrei eines Kindes in der Nebenkammer unterbrach den heftigen Disput. Eine verschlafene Magd klapperte wenig später die Stiegen zu den Wohnkammern Mariettas herauf, gähnend öffnete sie die Tür und strebte schlaftrunken auf die Tür der Kinderkammer zu, wobei sie gleichzeitig den Ausschnitt ihres Nachthemdes weitete und nach ihren Brüsten tastete.
»Lass nur«, Marietta hielt sie in sanftem Ton zurück, »ich werde ihn heute selbst säugen.« Die Amme gähnte nur herzhaft, wobei ihre Augen sich wieder halb schlossen, zog den Ausschnitt zurecht und drehte sich um. Sie ließ sich nur allzu gern von der Arbeit abhalten, ihre Nachtruhe war kurz genug.
»Halt!« Veronica rief sie noch zurück. »Marietta, du willst dich doch nicht noch um deine letzten Verdienste bringen? Lass die Amme ihren Dienst tun, sie wird gut dafür bezahlt. Du brauchst deine Milch für Wichtigeres.«
»Geh«, befahl Marietta ungerührt der Magd, wandte sich zum Nebenzimmer, trat ein und kehrte mit dem schreienden Säugling auf dem Arm zurück. »Das wirst du nicht tun«, zeterte aufgeregt die Witwe und wollte Marietta den Knaben entreißen. »Was, wenn der Kardinal nach dir und deiner Milch verlangt?«
Die junge Mutter schaute sie mit kalter Verachtung an. »O doch, ich werde es tun, denn es ist nur recht, dass eine Mutter ihr Kind nährt statt eines grausamen, kranken Wüstlings mit merkwürdigem Geschmack.«
Sie lockerte ihr Hemd und legte zärtlich den Knaben an, der sogleich das Ziel seiner Wünsche fand und in wenigen Augenblicken selig beschäftigt war. »Madonna mia«, stöhnte die Alte, »was liegt dir am Geschmack deiner Kunden, solange sie dafür zahlen. Den Bastard da«, sie deutete auf das Kind, »könntest du ebenso gut von einer Ziege säugen lassen, er würde den Unterschied kaum merken.« Sie ließ sich auf den Sessel beim Fenster fallen. Er war neben einem einfach gezimmerten Hockschemel die einzige Sitzgelegenheit in der bescheidenen Kammer und gebührte der Hausherrin.
Veronica, die ihre eigenen Verdienste und alle Kuppelpelze längst verschwendet hatte, schon seit Jahren nur von den Einkünften und der Gunst Mariettas lebte, betrachtete nicht nur in diesem Haus jedes Möbelstück und jeden Diener als ihren Besitz, sondern war zudem beleidigt, dass sie sich mit so viel Schäbigkeit zufrieden geben musste. Marietta hingegen behielt die Alte aus bloßer Gewohnheit bei sich, und weil es ihr nie gelungen war, sich ganz aus den Schuldgefühlen der Alten gegenüber zu lösen. Bei aller Niederträchtigkeit ihres Gewerbes hatte Veronica sie tatsächlich vor Schlimmerem bewahrt, dem Elend einer Bordellhure etwa oder dem harten Leben einer Wäscherin oder Dienstmagd, die den Nachstellungen ihrer Herrschaft oft kostenlos nachgeben musste und darum doch nicht mehr als einen schäbigen Scudi im Monat verdiente.
Und sie, Marietta, war jung gewesen, begierig auf die Welt, nachdem sie fünfzehn Jahre in der Enge des Konvertitenklosters aufgewachsen war und man ihr beständig von ihrer sündigen Herkunft gepredigt hatte, von ihrer Schamlosigkeit, zu der sie doch nie Gelegenheit gehabt hatte, und von ihrer armseligen Zukunft, da ihr niemand eine noch so geringe Mitgift stiften wollte.
Ja, damals war ihr Veronica, noch nicht verwüstet von Alter, Habgier und Ausschweifung, wie eine wunderschöne Göttin erschienen, die auf die Erde hinabgestiegen war, um sie, Marietta, in den Himmel zu entführen.
Vielleicht speiste sich ihr letzter Rest von Dankbarkeit gegen Veronica auch aus der Tatsache, dass sie nur durch die ihr angediehene Bildung Scoferino kennen gelernt hatte. Den schönen, empfindsamen Scoferino, der sie erst als Kunde besucht hatte und nun als seine donna mirąbile verehrte, sie liebte und all den herrlichen Madonnen, die er malte, ihr Gesicht verlieh. Zärtlich blickte Marietta auf den gemeinsamen Sohn hinab. Schon vermeinte sie in den Grübchen das Lächeln des Geliebten wiederzuerkennen, im Schwung der seidigen blonden Wimpern den Augenaufschlag Scoferinos, und in ihren Ohren klang dessen wunderbares Versprechen. »Eines Tages werde ich dich heiraten, Marietta, mein Engel, mein Licht, mein Leben. Ich werde dich heiraten, weil meine Kunst ohne dich nichts ist.« Ach, wie süß war dieser Gedanke. Allein, zum gemeinsamen Glück fehlten 300 Scudi. So viel – es war die geringste denkbare Summe – war nötig, um einen gemeinsamen Hausstand zu gründen und die famiglia Mariettas weiter zu versorgen.
Scoferino war mittellos, seine wohlbetuchten Eltern versagten jede Unterstützung, seit er vor drei Jahren sein Verhältnis mit der um neun Jahre älteren Kurtisane Marietta begonnen und schon wenig später öffentlich gemacht hatte. Sie zürnten umso heftiger, als er seine Heiratsabsichten kundgetan hatte, und sie hatten sogar mit Gewalt gegen ihn oder seinen Bettschatz gedroht. Doch Scoferino hatte sich unbeeindruckt gezeigt und eine armselige Kammer im Hurenviertel Hortaccio angemietet, um seine Malerei zu betreiben, wenn er nicht bei seiner Liebsten weilte.
Herrlicher, stolzer, wundervoller, begabter Scoferino, dachte Marietta seufzend, sie konnte außer ihm keinen Mann mehr in ihrem Bett ertragen, es war unmöglich.
»Du bist eine Närrin«, unterbrach noch einmal Veronica die Gedanken der jungen Mutter, die Scoferino in diesem Moment gewiss zum Vorbild für ein weiteres Madonnenbild genommen hätte, eines der glücklichen und heiteren Art, die uns das Leben als köstliches Geschenk erscheinen lassen. Marietta betrachtete zärtlich das apfelförmige Muttermal auf einem der Schenkel ihres Sohnes, das sie ihm vererbt hatte. Prospero, so hieß der Knabe, war das Wertvollste, was sie je besessen hatte.
Veronica sah nichts von dem, sie sah nur eine zwar schöne, aber alternde Dienerin der Venus, die gerade eben dabei war, ihr letztes Kapital für ein Kind der Schande zu vergeuden.
»Was nun, wenn der Kardinal dich heute noch bestellt? Wie willst du seiner Lust dienen und seine Begierden stillen? Ausgedörrt wie ein verwelktes Rebblatt wirst du zu ihm kommen und damit deinen letzten Gönner verlieren.«
»Er wird mich schon nicht bestellen«, murmelte Marietta sanft, um ihren Sohn nicht zu erschrecken. Der schien nun satt, ließ das Köpfchen zurücksinken und rieb sich die Äuglein. Marietta drückte ihm einen Kuss auf die zarte Stirn und hob ihn sanft an die Schultern, um ihm den Rücken zu klopfen. Sie summte gedankenverloren ein Lied und war dem Glück so nahe, wie sie es nur eben sein konnte.
Ein dumpfer Schlag riss die beiden Frauen hoch. Es war ein Stein, der gegen die Läden schlug, bald folgte ein weiterer. Aufgeregt stürzte Veronica zum Fenster. Das war ihr Signal. »Haltet ein«, rief sie heiser in die Gasse hinein, ordnete noch einmal ihre Frisur und ging mit der Würde der erfahrenen Kupplerin daran, die Läden zu entriegeln. Die Verhandlungen in den Häusern der Kurtisanen wurden stets von der Kupplerin – der Mutter oder einer alten Witwe – geführt, und Veronica hielt darauf, dass – egal wie tief ihr Schützling gesunken war –, sie doch nicht so tief stand wie eine gewöhnliche puttana, die schutzlos und auf offener Straße mit ihrem Kunden einig werden musste. Solche Maßnahmen drückten den Preis. Eine gute Kurtisane hatte eine Kupplerin, hatte Wächter und Dienerschaft und suchte sich die Kunden – zumindest dem Schein nach – selber und aus freien Stücken aus.
Kopfschüttelnd betrachtete Marietta, nachdem sie in der Nebenkammer ihr Kind auf sein Schlafbrett zurückgelegt und die Bänder über seinem kleinen Körper festgezogen hatte, das Treiben der Alten, die, um einen gurrenden Ton bemüht, den möglichen Bewerbern schmeichelte. Noch immer tat sie, als sei Mariettas Haus in der Händlergasse ein vornehmer Treffpunkt für die Edlen der Stadt, als gäbe es hier immer noch eine Ware, die süßer und verbotener lockte als der Paradiesapfel selbst. Diese Umsicht hatte beinahe etwas Rührendes, denn die gewesene Isabella la Luna war nicht nur von Habgier getrieben, sie trauerte tatsächlich den vergangenen goldenen Tagen des Kurtisanentums nach. Es waren die einzigen goldenen Tage ihres Lebens gewesen. Damals, als die Kurtisanen Roms tatsächlich verehrt wurden wie die cortigiane, die Hofdamen der Fürstenhäuser.
Marietta aber gab sich keiner solchen Täuschung hin. Der Frühling ihres Gewerbes war entlaubt. Das Geschäft war hart, die Konkurrenz inzwischen mächtig und bei weitem jünger. Der Ruf Roms als einer Stadt der Sünde lockte längst Abenteurerinnen und Glücksritterinnen, Hoffnungslose und Armselige aus aller Welt. Geflohene Ehefrauen ebenso wie mittellose Jungfrauen, die einem Leben als Bettlerin oder armselige Nonne mit dem Spinnrocken entgehen wollten.
Mit fünfzehn Jahren begannen die schönsten Mädchen aus allen Ländern Europas in der ewigen Stadt ihr Gewerbe. Auf die 5000 schätzte man ihre Zahl, auf jeden zehnten Einwohner Roms kam eine Hure. Darunter die hellhäutigen, hoch gewachsenen Mädchen aus der Lombardei mit ihren rötlich schimmernden Locken oder flachsblonde und in Italien heiß begehrte, üppige Flamenweiber, sogar schlanke gazellenartige Wesen aus dem Lande des Nils oder mandeläugige, dunkle Spanierinnen, von denen es hieß, sie seien in der Sünde der fleischlichen Lust so kunstfertig wie die iberischen Vertreter der Heiligen Inquisition in der grausamen Tortur menschlicher Leiber kenntnisreich.
In Rom konnte ein jeder Mann, egal welchen Alters, Standes oder welcher Herkunft und egal, wie schmal sein Geldbeutel war, seine natürlichen Triebe befriedigen. Derbe Spötter nannten daher Rom nicht mehr caput mundi, Kopf der Welt, sondern cauda mundi, Schwanz der Welt, und scheuten sich nicht, solche – »libelli famosi« genannten Schmähungen mit Ochsenblut an Kirchenwände zu schmieren. Der Zölibat und die Gelübde der Keuschheit förderten das Geschäft, statt es zu behindern. Doch wer sollte angesichts der Fülle sündigen Angebots in der Ewigen Stadt sein Begehren noch auf sie, Marietta, eine Frau von 32 Jahren richten?
»Es sind Boten des Kardinals«, raunte Veronica nun aufgeregt und mit gedämpfter Stimme ins Zimmer. »Seine Eminenz wünscht dich heute Nacht noch bei sich. Es heißt, er habe bei seinem Maskenfest einen weiteren Schwächeanfall erlitten. Er verlangt dringend nach dir und verspricht zwanzig Scudi.« Die Zahl kam schrill, und Marietta konnte es der Alten nicht verdenken. Zwanzig Scudi! Mehr konnte auch die jüngste, vornehmste Kurtisane für eine Nacht, die schwierigsten Liebesdienste und ungewöhnlichsten Praktiken kaum verlangen. Selbst dann nicht, wenn damit ein Weg durch das nächtliche, hochgefährliche Rom verbunden war. Aufgeregt schnürte sie ihr Mieder zurecht, während die Alte die Boten anwies, vor der Tür zu warten.
Dann schloss Veronica die Läden und wandte sich mit einem Ausdruck triumphaler Verachtung zu Marietta hin. »Da hast du es. Der Kardinal verlangt nach dir, und du hast deine Milch an deinen Bastard verschwendet. Deine Brüste sind trocken, welche Freude willst du ihm nun gewähren? Glaub nicht, dass du ihn mit deiner Venusgrotte locken kannst. Da hat er die Rodiconda für, und die würde es dir bitter vergelten, wenn du dem Kardinal die Schenkel öffnest. Was willst du nun tun?«
»Ich werde zu ihm gehen, vielleicht kann er warten, bis mir die Milch wieder fließt.« Sie hoffte darauf, den grausamen Purpurträger ein weiteres Mal zu verzaubern, auch wenn sie nicht wusste, was ihr diese Macht über den gefürchteten Mann verlieh.
Veronica schüttelte den Kopf. »Einen Kardinal warten lassen. Und ausgerechnet Falvini. Was bildest du dir ein? Warum machst du ihm nicht gleich Mitteilung, du würdest ihm zu gegebenem Anlass eine Audienz gewähren?«
»Er ist mir geneigter, als du glauben magst«, warf Marietta zaghaft ein.
Doch die Alte schüttelte ungläubig das Haupt. »Du bist wahrhaft ein törichtes Weib. Rechne nie mit der Zuneigung eines solchen Mannes. Hättest du einen anderen Liebhaber, einen, der ihm ebenbürtig wäre, so könntest du die Karte der Eifersucht spielen. Aber so? So bist du schutzlos seiner Launenhaftigkeit unterworfen. Muss ich dir die Frauen aufzählen, die an seinen Tisch geladen und wegen eines zu lauten Lachens, einer zu vorwitzigen Bemerkung nie mehr von der Tafel aufstanden?«
Marietta zuckte zusammen, sie kannte die Geschichten wohl. Unter Roms Kurtisanen war eine Einladung des Kardinals ebenso begehrt wie gefürchtet. Einige munkelten, der Purpurträger habe Freude daran, Frauen zu quälen und zu töten. Andere behaupteten, es sei Rodiconda, seine langjährige Konkubine, die jede Rivalin – zur Freude des Kardinals – in die Hölle schickte, bevor sie dem Kirchenfürsten den Himmel auf Erden bereiten könne.
Veronica sah mit Befriedigung das ängstliche Flackern in den hellen grünen Augen Mariettas, die Scoferino »Smaragde des Himmels« nannte. Ihren Triumph genießend, leckte sich die Alte ihre schmalen, vertrockneten Lippen, dann sagte sie mit einem Ausdruck äußerster Resignation: »Ich weiß nicht, warum ich so gutmütig bin, dir immer wieder zu helfen. Komm.« Gemeinsam stiegen sie die hölzerne Treppe hinab, die in eine schäbige Diele führte, deren Boden mit angeschlagenen Steinziegeln gefliest war. Veronica trat nach einer Ratte, die mit ihrem weichen, dicken Leib an einer der Wände entlangglitt, und verschwand in der rückwärtig liegenden Küche.
Bald kam sie mit einem kleinen, nassen Schwämmchen zurück. »Hier, klemm es dir unter deine Brust, es ist mit Ziegenmilch getränkt, der gierige, schwache Bock wird den Unterschied kaum merken, du drückst einfach darauf, wenn er sein Spiel beginnt, und er wird es seufzend schlecken. Verzieh deine Miene in Schmerz und behaupte, du seist wund von seinen leidenschaftlichen Spielen. Er liebt es, wenn Frauen unter ihm Schmerzen leiden.«
»Aber Veronica, er drängt mich jedes Mal mehr, mich auszuziehen. Er sagt, er will mich dabei nackt sehen«, bemerkte Marietta zweifelnd.
»Nackt? Seit wann das? Ich denke, er will, dass du ihm nur die Amme spielst und zaudernd wie eine Madonna deine Brust gibst?« Marietta bekreuzigte sich bei der lästerlichen Bemerkung der Alten, griff dann den Schwamm und schob ihn vorsichtig in ihr Mieder. Milch sickerte durch den Stoff und verbreitete einen stechenden Geruch, der mit dem süßen Mandelduft ihrer Milch wenig gemein hatte. Dann antwortete sie der neugierigen Veronica harmlos.
»Nun, zuletzt bedrängte er mich immer wieder, mich ganz zu entkleiden und in sein Bett zu kommen. Ich wollte es nicht leiden, wiewohl er bislang nie anders Hand an mich legte, als sei ich seine späte Amme.«
»Du fantasierst, du wähnst dich größer, als du bist. Sein Bett pflegt er mit der Rodiconda zu teilen, sie ist bei weitem klüger, schöner und begehrter als du. Träum nicht einmal davon, dass der Kardinal die Venus in dir sieht.«
Marietta lag nicht daran, hierüber mit Veronica zu streiten. Was bedeutete ihr auch die Lust oder etwa eine besondere Zuneigung des Kardinals? Was kümmerte es sie, was er in ihr sah. Sie lockte nur das einfach verdiente Geld für eine Arbeit, bei der sie ihren Liebsten nicht hinterging, indem sie sich nicht ganz einem anderen schenken musste. Das würde sie gewiss nie mehr tun. Sie griff sich eine fröhliche Nymphen-Maske aus der Dielentruhe und streifte sie übers Gesicht, warf einen Kapuzenmantel über, entriegelte die Tür und eilte durch den Torbogen auf die finstere Gasse.
Zwei Männer erwarteten sie dort mit einem Tragsessel. Beide trugen außerdem Eisenstangen im Gürtel, um damit nächtliche Angreifer abzuwehren. Die Sänfte war mit purpurnem Samt überdacht und ein mit Schnitzereien und Goldlack verziertes Prunkstück. Für Marietta bestand kein Zweifel daran, dass es ein Tragsessel des hohen Amtsträgers war.
Verwundert über solch eine Aufmerksamkeit, die sonst nur den vornehmeren Kurtisanen zuteil wurde, schob Marietta die Brokatvorhänge beiseite und kletterte auf den mit Samt gepolsterten Holzsitz. Sie schob die Vorhänge wieder zusammen und lehnte sich zurück, während die Träger anhoben und schwankend ihren Weg begannen. Sie tasteten sich mit vorsichtigen Schritten durch die holprige, dunkle Gasse, eifrig darauf bedacht, nicht über einen Stein oder einen Haufen Unrat zu stolpern.
Als sie die Via Giulia erreichten, die an vielen Stellen gepflastert und durch die Nachtlaternen einiger Paläste wenigstens spärlich beleuchtet war, beschleunigten sie ihre Schritte. Sie fürchteten die Verwicklung in eine der nicht enden wollenden sfides. Diese zum Spaß von mutwilligen, kampfdurstigen jungen Edelleuten ausgerufenen Straßenfehden um erfundene Ehrenhändel konnten leicht zu blutigen Handgemengen führen. Wenn Rom aus seinem Schlaf erwachte, lagen nicht selten fünf bis sieben Leichen im eigenen Blut und im Staub der Straßen, Opfer einer willkürlichen Mordgier und der duldsamen Nachlässigkeit der Ordnungshüter.
Die Träger verfielen nun in einen Laufschritt, ihre Fracht war angenehm leicht. Schnell passierten sie das Haus Nummer 85, in dem der große Maler Raffael seine Geliebten prachtvoll untergebracht hatte, und den gewaltigen Palast des Goldschmiedes Benvenuto Cellini, der seine Einkünfte vor allem dem Papst und dessen Vorliebe für goldene Kunstwerke verdankte. Doch die umsichtige Eile der Träger war umsonst. In Höhe des Palazzo Ghiotti sprangen vier Vermummte aus einem Haustor. Gegen die spitzen Degen der Angreifer hatten die beiden Träger mit ihren Eisenstangen keine Chance. Sie ließen den Tragsessel fallen und stoben davon. Für eine Kurtisane – und sei sie noch so schön und ein Liebchen des Kardinals Falvini – wollten sie ihr Leben nicht opfern. Schließlich waren sie nur Mietknechte und gehörten nicht zum Haushalt des Purpurträgers, sodass sie vor seinem Zorn nicht zittern mussten. Vor Furcht gelähmt drückte sich Marietta tiefer in das Rückenpolster, zog die Maske dicht vors Gesicht und schloss die Augen. Grob riss einer der Angreifer schon den Vorhang beiseite. Marietta schlug ein hastiges Kreuz und empfahl Gott ihre Seele.