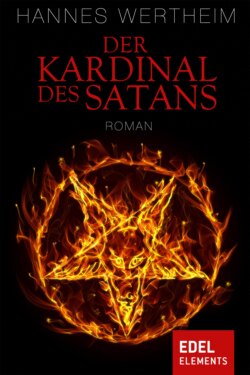Читать книгу Der Kardinal des Satans - Hannes Wertheim - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
Оглавление»Nihil humani a me alienum puto – Mir ist nichts Menschliches fremd«
Leitspruch der Humanisten
Der Kardinal della Forsa schob keuchend seine gehörnte Maske über die schweißglänzende Stirn. Seine beleibte Statur ließ das enge Satanskostüm aus schwarzen und roten Seidenrauten in hohem Maße lächerlich erscheinen und erlaubte ihm nicht, lange an den modischen Springtänzen teilzunehmen, zu denen die Kurtisanen die Festgäste in den Innenhof lockten. Atemlos und erhitzt nahm della Forsa wieder an der langen Tafel im Wandelgang des weitläufigen cortile Platz, verlangte nach Wein und wandte sich seinem Tischnachbarn, einem Mailänder Gesandten, zu. Über den Lärm der Lauten- und Trommelschläger, der Pfeifer, Drehorgel und Zimbelspieler hinweg, pries er die Freuden des Festes. »Oh, fürwahr, der Falvini versteht es, einen einfachen Diener der Kirche angemessen zu unterhalten«, rief er, und sein Lob kam aus tiefstem Herzen, da er sich mit seinem bescheidenen Einkommen von 1000 Scudi zu den paupera cardinali, den armen Purpurträgern, rechnen musste. Er griff sich eine kandierte Feige, biss so herzhaft hinein, dass der Saft herablief und sein leichenblass geschminktes Gesicht hässlich verschmierte. Mit vollem Mund fuhr er fort. »Habt Ihr je solche Köstlichkeiten gesehen? Ein jedes Mal übertrifft er sich selbst. Geröstete Papageienzungen, bei allen Heiligen, so etwas habe ich mein Lebtag zuvor nicht gegessen, obwohl ich bei den päpstlichen Jagden schon manchen Singvogel erlegt und verspeist habe. Falvini verdient jedes Lob, das man ihm spendet. Er ist ein großer Mann. Was wird er uns wohl zum Abschluss servieren?«
Der vornehme Mailänder, der mehr aus politischen Erwägungen denn des Vergnügens wegen am Bankett des Kardinals Falvini teilnahm, zuckte interesselos die Schultern. Sein Blick schweifte zum Gastgeber. Mit gerunzelter Stirn betrachtete er Falvini, der mit einem Lorbeerkranz auf dem Haupt und in eine faltenreiche Tunika gekleidet den heidnischen Gott des Lichtes, Apoll, darstellte. An der Stirnseite des Wandelgangs thronte er unter einem purpurnen Baldachin über allen Gästen. Was für ein Frevel, der Mann vollzog seine Apotheose selbst und im Diesseits. Er inszenierte sich als Gott.
Della Forsa erschien das mürrische, abweisende Schweigen und die finstere Miene seines Tischnachbarn als der größere Frevel, schließlich galt es, die flüchtigen, irdischen Freuden ausführlich zu genießen. Gerade dann, wenn sie umsonst waren.
»Tempi passati, mein Lieber, umarmt dieses flüchtige Leben. Es gereicht Euch nicht zur Schande«, mahnte er in einer Anwallung christlicher Nachdenklichkeit, »habt Ihr nicht die Skelette in der Vorhalle gesehen? Der Falvini versteht es, den heitersten Freuden den ernsten, würdigen Ton aufrechter Ermahnung an die Seite zu stellen.« Damit verneigte er sich in Richtung des verkleideten Gastgebers, der davon freilich nichts bemerkte, sondern damit beschäftigt war, einigen der Tänzerinnen zum Scherz seine vergoldeten Sandalen zum Kuss darzubieten.
Zufrieden mit seiner würdigen Argumentationsführung griff der feiste Kirchenmann della Forsa nach einem mit Ingwer und spanischem Pfeffer gewürzten Kuchen, der die Manneskraft der Gäste steigern und für die den Tafelfreuden folgenden erotischen Vergnügungen präparieren sollte. Und der Kardinal langte tüchtig zu, da seine Tanzpartnerin, eine verteufelt hübsche, muntere Neapolitanerin, ihm bereits süße Versprechungen zugeraunt hatte. Gewiss waren einige Kammern im Palazzo für die sündigen Konklaves, wie man die Liebesspiele zwischen Kurialen und Kurtisanen nannte, vorbereitet. Della Forsa rieb in Vorfreude die Hände aneinander und unter dem Tisch auch die Schenkel. Er rechnete es dem spanischen Pfeffer zu, dass seine Lenden bereits mächtig und lustvoll brannten. Genüsslich spitzte er die Lippen und deutete seiner Auserwählten, die eine ausgelassene Galliarde tanzte, leidenschaftliche und schamlose Küsse an. Es war eine Lust zu leben. Wozu Buße tun, bevor man gesündigt hatte? »Ist sie nicht Venus selbst?«, fragte er entzückt den Mailänder. Der schwieg eisern. Della Forsa seufzte.
Die Skelette hatten doch genug getan, um ihn an seine eigene Vergänglichkeit und die Eitelkeit alles Irdischen zu gemahnen, was wollte dieser norditalienische Sauertopf? Es waren die sterblichen Überreste einiger vor langer Zeit verstorbener Ordensbrüder, die in der Vorhalle mit Golddrähten zu makabren Tanzfiguren zusammengefügt und in der Ordnung einer Pavane aufgestellt worden waren. Auf ihren Schädeln trugen sie die Barette einfacher Diakone und nachgemachte Kardinalsmützen. »Hodie mihi, eras tibi – heute mir, morgen dir« hatte in blutroten Lettern auf einer weißen Fahne gestanden, die eines der Gerippe in seinen Knochenfingern trug. Der Hausherr verstand sich auf feine Ironie und geistreiche Anspielungen, die sogar Seine Heiligkeit selbst, der ansonsten für mürrisch geltende Papst Klemens VII., schätzte.
Mit Schaudern und Kreuze schlagend waren Falvinis Gäste zur achten Stunde an dem Totentanz vorbeigeschritten. Die maskierten Gesichter demütig gesenkt, waren sie in den prachtvoll geschmückten Innenhof des Palazzo getreten, um sich sogleich der süßen Freude des Vergessens hinzugeben.
Plätschernde Springbrunnen sorgten für angenehme Kühlung, hoch sprangen Fontänen aus versilberten Fischmäulern und den zarten Brüsten heidnischer Nymphenfiguren und sprühten weiße Gischt in den pastellfarbenen Abendhimmel. Der betörende Duft von Kamelien lag in der Luft, und der marmorne Boden des Hofes war mit Blüten und Laub bestreut. In den Ecken standen Eisenpfannen, in denen Myrrhe und Weihrauch brannten und köstliche Wohlgerüche in den Abendhimmel schickten.
Goldene Knaben, putti genannt, bildeten lebende Statuen, die lodernde Fackeln trugen. An Seilen ließ man einige gar von der Galerie im ersten Stockwerk über den Köpfen der Tanzenden schweben, auf ihren Rücken waren Flügel aus reinen Gänsedaunen befestigt.
Ja, Kardinal Falvini verstand es, ein Bankett zu veranstalten, so gut wie die reichen Bankiers und Kaufleute der Ewigen Stadt, die immer geneigt waren, die Prachtentfaltung der Kurie in den Schatten zu stellen. Weshalb der Papst Feste wie die des Kardinals förderte. Der Heilige Vater konnte es sich nicht leisten, Zweifel an der Machtfülle seines Kirchenstaates und seiner Vertreter aufkommen zu lassen, nach dem immer mehr Feinde die gierigen Hände ausstreckten. Sie galt es mit Pomp und Prächtigkeit zu blenden.
Der mailändische Gesandte griff nun nach einem der für ihn reservierten Mundtücher und tupfte sich zierlich einen unsichtbaren Tropfen Wein aus dem Mundwinkel. Es war mehr eine symbolische Geste denn eine erforderliche Reinigung. Ihm behagte dieses verschwenderische Fest immer weniger. Ihn quälten die Sorgen um die Zukunft seines Stadtstaates, der schon lange von den spanisch-kaiserlichen Truppen besetzt war. Die stolzen Mailänder mussten es mit ohnmächtigem Zorn erdulden, dass die Iberer sie wie Sklaven behandelten, ihre Privathäuser beschlagnahmten. Die Soldateska missbrauchte, in der für sie typischen Grausamkeit, die Töchter der Stadt und mordete willkürlich jeden, der ihr Missfallen erregte.
Angesichts dieser bedrohlichen Zustände ärgerte ihn das schwankende Verhalten des Papstes, der zwar am 22. Mai des Jahres 1526 mit Frankreich, Venedig und Mailand eine Liga gegen Spanien und Kaiser Karl V. geschlossen hatte, sich nun aber unfähig und unwillig zeigte, gegen die Besatzer im Norden Italiens vorzugehen. Dabei, so dachte der Mailänder, war es hohe Zeit, das Joch der Fremdherrschaften in ganz Italien abzuschütteln. Zu lange schon trugen Ausländer ihre Machtkämpfe in der Lombardei oder im Königtum Neapel aus, und nun drohte der endgültige, vernichtende Kampf zwischen dem französischen König Franz und Kaiser Karl V. auf italienischem Boden.
»So ernst, so bekümmert, lasst mich Eure Stirn küssen«, riss ihn die scherzende Stimme einer Dirne aus seinen düsteren Gedanken. Della Forsa zwinkerte ihm spitzbübisch zu. »Verschwinde«, blaffte der Mailänder roh, das Mädchen tanzte achselzuckend davon.
»Ich kann Euch wirklich nicht begreifen«, sagte nun – einigermaßen beleidigt – della Forsa, »was ist mit Euch?«
»Ich sorge mich ernsthaft um unser Vaterland, Euer Eminenz«, gab der Gesandte so würdevoll wie möglich zurück. »Die Lage ist ernst. Wir sind auf das Ärgste bedroht durch die Iberer. Doch der zaghafte Papst tut nicht mehr, als die Spanier durch unkluge Akte zu beleidigen und ihren Zorn zu schüren. Am 20. Juni ist der spanische Botschafter von Rom ausgeritten, hinter ihm saß – verkehrt herum – sein Hofnarr und schnitt den Römern böse Grimassen.«
Della Forsa lachte feist. »O ja, das war ein Bubenstück. Aber Klemens, so hieß es, hat es amüsiert.« Der Mailänder verfiel erneut in dumpfes Brüten. Er war sich, wie andere Politiker, sicher, dass die Narreteien des spanischen Botschafters nur ein Vorgeschmack auf eine blutige Rache der stolzen Iberer waren.
Die meisten Kardinäle Roms waren so blind gegen die wirkliche Gefahr wie ihr Papst. Sie prassten und feierten, als sei ihre Macht unantastbar und ewiglich. Andere hingegen spannen gefährliche Intrigen gegen den Heiligen Vater selbst. Dem Mailänder war daran gelegen, herauszufinden, wer auf französischer und wer auf spanischer Seite stand, von wem man Unterstützung gegen die Besatzer und von wem niederträchtige Feindseligkeit zu erwarten hatte.
Beim Anblick des falschen Apolls Falvini, der nun einen Narren künstliche Feuerblitze in die Menge schießen ließ, verdüsterte sich seine Miene weiter. Falvini gehörte zu den mächtigsten Kardinälen des Kirchenstaates und zu den undurchsichtigsten.
»Mir scheint, Euch hat man sauren Wein gegeben«, dröhnte della Forsa, warf den silbernen Becher des Gesandten in den Innenhof, wo ihn ein Höfling des Kardinals als unerwartetes Trinkgeld rasch in seinen Gewändern verschwinden ließ. Della Forsa reichte dem Mailänder großzügig den eigenen Becher.
»Hier, trinkt den, er ist köstlich und rein wie die Schenkel einer Jungfrau.« Verächtlich schob sein Tischnachbar den Becher beiseite. Mit ironischem Ton hob er an: »Eure Eminenz sind zu gütig, doch empfiehlt es sich in diesen Tagen gewiss nicht, einen fremden Becher an den Mund zu führen«.
»Ach, Narrengeschwätz«, erwiderte der Kardinal leicht beleidigt, »um dieses gewisse weiße Pulver wird viel zu viel Aufhebens gemacht. Die Zeiten der Borgias sind vorbei, und wer sich aus der großen Politik heraushält, dem werden sein Wein und sein Brot nicht sauer aufstoßen. Seht mich an. Seit gut fünfzehn Jahren bekleide ich mein Amt und habe mir meine blühende Gesundheit bewahrt. Der Papst selbst lobte letzthin meine außerordentliche Konstitution. Wie Ihr wisst, neigt er selbst zur Kränklichkeit, was freilich seiner strahlenden Erscheinung keinen Abbruch tut.«
»Ihr hattet ein Zwiegespräch mit dem Papst?«, fragte aufgeregt der Mailänder, »was hat der Heilige Vater noch gesagt, über die Situation, die Schwierigkeit der Lage?«
»Nun, er bemerkte, dass diese heißen Monate für beleibte Leute unheilvoll seien.«
»Mehr sagte er nicht?«, fragte der Gesandte erneut.
»Nein, er hatte danach eine dringende Beratung mit den Ingenieuren seiner Wasserspiele. Er ist ein großer Mann, ein Freund der Künste. Ich bewundere ihn sehr und bin immer seiner Meinung.«
Der Mailänder neigte stumm sein Haupt, nannte den feisten Prälaten insgeheim jedoch einen korrupten Schwätzer. War der Papst wirklich so gewissenlos, sich mit Wasserspielen statt mit der Politik und den Bedrohungen durch fremde Söldnerheere auseinander zusetzen? Der Gesandte sehnte sich nach anderen Tischgenossen. Aufmerksam ließ er seinen Blick an der Tafel entlangschweifen. An die fünfzig Gäste waren versammelt. Darunter sechs weitere Kardinäle, von denen die meisten als Franzosenfreunde, also Papstgetreue und Feinde Spaniens, galten, daneben einige Gelehrte, unbedeutende Brevenschreiber, Sekretäre der apostolischen Kammer und eine Reihe junger Edelleute aus guter Familie, mit deren Namen man sich in Rom gern schmückte.
Fast alle gaben sich ausgelassen den Festfreuden hin, die einen hatten sich bereits eines der Liebesmädchen auf den Schoß gezogen. Seltsame Paarungen kamen dabei zu Stande. So ließ ein Edelmann in der Maske eines Stieres seine Hände gerade in das Mieder einer Eule gleiten, während nebenan Cupido der Venus selbst seine Aufwartung machte.
Der Mailänder erhob sich, verbeugte sich gegen den heftig kauenden della Forsa und schlängelte sich durch das Gewimmel der umhereilenden Diener, Narren, Tänzer und Mundschenke zu den Plätzen zweier Kardinäle, die sich einigermaßen würdig betrugen und sich in ernstes Schweigen hüllten. Der eine war der schon achtzigjährige Kardinal von Montefiscone, den man gern zu Tisch lud, da nach seinem Ableben einige Pfründen und Ämter frei werden würden, nach denen sich mancher Purpurträger die Finger leckte. Gunstbezeugungen gegen den Greis, so hofften sie, könnten auf sein Testament Einfluss haben.
Doch trotz einer Neigung zu Gicht und apoplektischer Veranlagung tat der Kardinal auch seinen großzügigsten Gastgebern nicht den Gefallen und starb, sondern aß zum Ärger aller reichlich, sprach dem Wein zu und erfreute sich bester Gesundheit. Neben ihm saß der hagere Kardinal della Guarde, ein ehemaliger Dominikanerabt, den man aufgrund seiner christlichen Strenge und seiner spanischen Herkunft argwöhnisch betrachtete. Er galt als geborener Intrigant und Intimfeind des pompösen Falvini, weshalb dieser sich bemühte, den weit ärmeren della Guarde mit ausgewählter Herzlichkeit zu bewirten, um ihn zu demütigen und seinen möglichen Intrigen direkt auf die Schliche zu kommen.
Der Mailänder beugte vor den beiden Eminenzen das Knie. Der ältere der beiden machte eine einladende Geste, und bald saß der Gesandte zwischen ihnen. Mit Befriedigung bemerkte er, dass der asketische della Guarde Wasser zu sich nahm, das ihm die Diener direkt aus dem Springbrunnen holen mussten. Anders als der feiste della Forsa schien er die Gefahr des »gewissen Pulvers« – eine grobe Arsenmischung mit unberechenbarer Wirkung – nicht zu unterschätzen.
»Wir hören, es steht schlecht in Mailand«, erkundigte er sich nun bei dem Gesandten. Der nickte grimmig, dann begann er mit gedämpfter Stimme und sich vorsichtig umsehend zu reden. »Ja. Und nicht nur in Mailand steht es schlecht. Uns allen droht die ewige Knechtschaft unter fremden Herrschern, wenn wir uns nicht endlich entschließen, ihnen mannhaft entgegenzutreten. Ganz Italien gleicht einer Mandel zwischen den gewaltigen Backen eines Nussknackers. Es lebt in tödlicher Umklammerung zwischen den kaiserlichen Interessen Karls und denen des französischen Königs, die ihre Kämpfe hier ausfechten werden. Ich fürchte, Italien wird dabei vernichtet.«
Er machte eine Pause und wartete auf eine Bemerkung, die verraten würde, ob die beiden Kardinäle einer der beiden fremden Kriegsparteien zuneigten und nun Partei ergreifen würden. Doch der gelehrte Dominikaner war zu klug, um zu antworten, und sein Tischnachbar zu taub. Eben der fragte nun mit der leicht greinenden Stimme des Alters: »Ihr kommt aus Mailand?« Der Gesandte nickte geduldig. Und tatsächlich ließ sich der geistliche Oberhirte von Montefiscone zu einer weiteren Bemerkung herab. »Mailand. Ja, ja stolzes Mailand ...« Gespannt spitzte der Gesandte die Ohren. Würde sich der Kirchenfürst zu seiner geknechteten Heimatstadt bekennen, könnte er hier jemanden finden, der den Papst zu einem raschen Feldzug gegen die Spanier drängen würde?
»Mailand«, sagte der alte Mann noch einmal und schien gleich darauf in einen Schlaf zu verfallen, wiewohl seine Augen weiterhin offen waren, dann, sich plötzlich wieder aufrichtend, sagte er fest und klar: »Eure Metzger verstehen sich auf gute Würste, da oben in Mailand.« Der ehemalige Dominikanerabt unterdrückte mit Mühe ein dürres Lächeln der Verachtung, der Gesandte sah ihn mit leichter Verzweiflung an. Dann wagte er eine offene Frage an ihn.
»Euer Eminenz, was meint Ihr, wie steht der Papst zur Liga? Ist er bereit, einen Angriff auf die Spanier zu machen, wenn König Franz seine zugesagte Hilfe, das Geld und die Truppen, endlich schickt?«
Der Kardinal della Guarde betrachtete den Mailänder fast mitleidig. Er war ein vorsichtiger Mann, der nicht einmal seinem Diario seine innersten Gedanken anvertraute, aus Angst, einer seiner Höflinge könne das Tagebuch lesen. Wie konnte dieser Mailänder glauben, er würde ihm eine offene oder unüberlegte Antwort geben?
Er hob sein Haupt, auf dem ordnungsgemäß der Kardinalshut und keine Narrenkappe saß, und antwortete trocken. »Mein lieber Mann, was der Papst will, weiß nur der Papst allein. So viel allerdings kann ich Euch sagen: Das Volk Roms nennt ihn spöttisch ›Signore volio, non volio‹, den Papst, der will und nicht will. Das macht jede Prophezeiung, seine Politik betreffend, höchst schwierig, wie Ihr Euch denken könnt.« Unter dem scharfen Blick des Dominikaners wurde dem Mailänder heiß und kalt, doch er wagte einen weiteren Vorstoß, diesmal die ihm bekannte schwache Stelle des Dominikanerabtes nutzend.
»Man sagt, der Kardinal Falvini sei zurzeit einer der engsten Berater des Heiligen Vaters. Was meint Ihr, wird er mir Auskunft geben können?« Mit Befriedigung bemerkte der Mailänder, dass della Guarde erbleichte und das Fleisch seiner ohnehin schon hohlen Wangen weiter einsog.
Kein Zweifel, dieser Mann hasste Falvini mit aller Leidenschaft. Mit der Leidenschaft eines Rivalen, denn beide Männer galten als cardinali papąbile, und beide waren begierig darauf, nicht nur als papstfähig zu gelten, sondern den Stuhl Petri eines Tages auch zu besteigen. Beide schwankten angesichts des sinkenden Sterns des gegenwärtigen Papstes, ob es nicht besser war, ihn zu stürzen statt zu stützen. Beide überlegten insgeheim, ob es von Vorteil sei, sich mit den Spaniern zu verbünden, um den wankelmütigen Klemens zu entmachten, der den Kaiser der Christenheit durch seinen Pakt mit Frankreich so nachhaltig erzürnt hatte. Es ist das Wesen von Rivalen, vieles miteinander gemein zu haben, was ihren Hass gegeneinander natürlicherweise anspornt.
»Der Papst«, brachte der Dominikaner, nachdem er sich gefangen hatte, mühsam hervor, »hat viele Berater und eine Reihe von Hofschranzen, die sich als solche bezeichnen. Wohl dem, der zwischen beiden zu unterscheiden weiß.« Ein Diener brachte ihm einen frischen Becher Wasser, auf dem einige Rosenblätter schwammen. Della Guarde betrachtete ihn schweigend und tauchte seinen Kardinalsring hinein, so als wolle er das Wasser aus dem Brunnen seines Feindes rituell reinigen.
Der Mailänder verlegte sich nach kurzem Überlegen auf die Schmeichelei. »Nun, man sagt, Ihr seid ihm einer der liebsten, aufrichtigsten Berater, da Ihr für unbestechlich geltet und als ein Meister der humanistischen Wissenschaft.« Doch mit eben diesem Lob lag er falsch. Nichts verabscheute der Dominikaner, ein aufrechter Vertreter der Inquisition, ein Freund des spanischen Stiefels und der eisernen Jungfrau mehr, als die törichte italienische Bildungsmanie, die der Medici-Papst Klemens so förderte und die Falvini so glanzvoll zur Schau stellte. Erregt setzte der Dominikaner sich auf und schob dabei das samtene Kissen von seinem Schemel.
»Man hat Euch falsch informiert. Mir liegt nichts an dieser heidnischen Schwärmerei, diesem Mummenschanz und Götzendienst«, bemerkte er barsch und wollte eben fortfahren, als ein lauter Glockenschlag eine weitere Belustigung für die Festgäste ankündigte. Der mächtige Mann fuhr herum, sein gestreckter Rücken erklärte das Gespräch für beendet. Der Mailänder entfernte sich und verzichtete darauf, dem Rücken des Purpurträgers seine Hochachtung zu erweisen.
Der Kardinal von Montefiscone, der den Dialog der beiden für ein Nickerchen genutzt hatte, richtete sich kurz auf und griff nach seinem Trinkbecher. Allein, er war nicht nur taub, er war auch kurzsichtig, und so kam es, dass er Wasser statt Wein trank, sich über den dünnen Geschmack nicht wenig wunderte und schließlich ganz in sich zusammensackte.
Der ehemalige Dominikanerabt achtete nicht weiter auf den Greis, sein Zorn kühlte sich nur mühsam ab. War es richtig, was der Mailänder sagte, galt Falvini inzwischen tatsächlich als liebster Berater des Papstes? Dieser nichtsnutzige Aufsteiger, dieser Blender und prunksüchtige Pfau, den er selbst für nichts als seine kalt berechnende Grausamkeit zu bewundern wusste? Der Dominkaner griff verärgert nach seinem Trinkbecher und bemerkte, dass der Herr von Montefiscone ihn geleert hatte. Unwirsch warf er einen Blick auf den Schlafenden. Er stutzte und entschied sich, sofort seine Kutsche rufen zu lassen. Weitere Vergnügungen lockten ihn nicht mehr.
Della Forsa hingegen kam nun ganz auf seine Kosten. Ungeniert klatschte er in seine feisten Hände und quiekte vor Vergnügen, als sei er eine epikuräische Sau, wie der humanistisch versierte mailändische Gesandte später an seine Stadtherren schreiben sollte.
»O wie entzückend, o wie wahrhaft entzückend. Die Cäsaren können nicht ausgelassener gefeiert haben«, jubelte della Forsa, und die Seidenhörner seiner Maske wippten fröhlich auf seinem Kopf.
Die Flügeltüren der Vorhalle wurden aufgestoßen, und sechs Sarasine erschienen mit einer riesigen Trage auf ihren Schultern. Bewundernde Rufe übertönten die Musik.
Sechs schwarze Diener, das war der Höhepunkt des Luxus. Jeder Patrizier schätzte sich glücklich, zwei solcher Sklaven in seinem Hause zu beschäftigen, und jede reiche Kurtisane achtete darauf, wenigstens eine Mohrin in ihre famiglia aufzunehmen. Aber sechs, das war schier unfassbar. Die dunkelhäutigen Männer waren in veilchenblaue Seidenwesten und samtene Pluderhosen gekleidet, ihre kräftigen Arme glänzten von Mandelöl, in ihren goldenen Turbanen wippten stolz Reiherfedern, die jedem Heerführer zur Ehre gereicht hätten. Mit gemessenen Schritten trugen sie ihre Last.
Die tanzenden Kurtisanen traten zur Seite und gaben den Blick auf einen antiken, mit kostbaren Steinmetzarbeiten verzierten Sarkophag frei, der wie ein Altar in der Mitte des Hofes aufgestellt war und ein weiteres Indiz für den Reichtum und die Vornehmheit des Hausherrn ablegte. Ein jeder, der in dieser Zeit eines kostbaren Zeugnisses der römischen Vergangenheit teilhaftig wurde, galt als glücklich, ja als Günstling Gottes. Die Antike war das Vorbild der Zeit.
Die Päpste selbst gaben sich deshalb Beinamen wie Mars oder Pallas Athene, zogen bei Prozessionen unter Triumphbögen her. Sie ließen die lange vernachlässigten Ruinen des heidnischen Kaiserreichs registrieren und endlich vor Bauplünderern schützen. Die Verehrung für alle Kunstwerke der Cäsarenzeit, für Statuen, Grabmäler, Sarkophage oder Vasen löste hysterische Begeisterung aus und wuchs mit der Entdeckung alter Schriften des Cicero oder des Epikur ins Unermessliche.
Doch was Falvini nun seinen Gästen bot, das war ein Höhepunkt, den keiner von ihnen jemals erlebt hatte. Wäre der Dominikaner della Guarde nur ein wenig länger geblieben, so hätten seine Verachtung und sein Hass gegen Falvini eine neue Stufe der Vollkommenheit erreicht. Doch der Kardinal della Guarde floh, floh vor dem maulbeerfarbenen, aufgedunsenen Gesicht seines Amtsbruders Montefiscone. Die Zunge war ihm schwarz aus dem Mund vorgequollen, so als habe er dem unbarmherzigen Sensenmann noch eine Grimasse schneiden wollen. Der spanische Dominkanerabt hatte keinen Zweifel. Dieser unwürdige Tod war ihm selbst bestimmt und gewiss nicht natürlich gewesen.
»Ich muss Falvini beseitigen«, zischte della Guarde. Während seine Kutschpferde anzogen, widmete sich der Dominkaner einem kurzen Gebet, in dem er alle Mächte des Himmels um Hilfe anflehte. Er konnte nicht ahnen, dass Hilfe bereits in Sicht war, denn die Wege des Herrn sind in der Tat unergründlich.