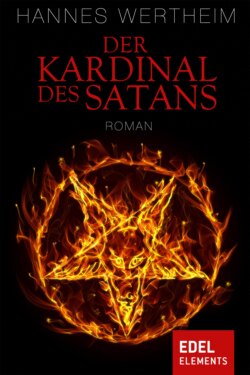Читать книгу Der Kardinal des Satans - Hannes Wertheim - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. 1.
Оглавление»Merk, Welt ist je Welt gewesen. Nämlich des Teufels Reich, ein Stall voller Buben, und hat jede Welt ihre Gottlosen und offenen Sünder.«
Sebastian Franck, »Das Narrenschiff«, 1533
Die junge Beatrice zog wütend einen Klumpen Wäsche aus dem großen gemauerten Wasserbecken am Tiberufer. Mit Schwung goss sie aus einem Holzeimer die Lauge aus Knochenasche und bleichendem Salz darüber. Die Sonne stach ihr in den Rücken, Schweiß stand ihr bereits auf der Stirn und lief ihr aus den Achseln herunter. Mit einer gewaltigen Holzkeule begann sie eines der Leintücher tüchtig zu klopfen und zu walken. Um sie herum sangen die anderen Wäscherinnen ausgelassen ihre üblichen Liedchen um Liebeslust und Liebesleid. Nur Beatrice brummte ausgiebig vor sich hin.
»Prügelst du deinen untreuen Schatz«, rief scherzend eine der anderen Wäscherinnen herüber, die in einem großen Holzbottich einen Block Ziegentalgseife auflöste.
Beatrice warf ihr einen zornigen Blick zu, der schlecht zu ihrem hübschen, pausbäckigen Gesicht passen wollte. »Ach«, begann sie schließlich, denn sie gehörte nicht zu den schweigsamen Naturen, »es ist doch immer das gleiche Elend. Die armen Leut zahlen pünktlich für die Dienste, die man ihnen tut, und die reichen lassen dich auf jeden Bajocco warten. Und dann tun sie beleidigt, wenn unsereins zu ihren Wohnungen geht und seinen Lohn verlangt. Oder sie lassen sich verleugnen. Es ist nicht gerecht, eine ehrliche Magd wie mich zum Betteln zu zwingen und zu betrügen.«
Das Leintuch empfing weitere harte Klapse, sodass das Wasser nur so hervorspritzte. Lachend tauchte Beatrices Nachbarin am Becken ihre hohle Hand ins Wasser und schleuderte es auf die hitzige junge Frau. »Lass das«, rief Beatrice schrill, begann aber ebenfalls mit Wasser zu spritzen. Bald waren die Hemden der beiden pflichtvergessenen Mädchen so nass, dass sich deutlich ihre hübschen Brüste darunter abzeichneten.
Eine Gruppe von jungen Diakonen, die – nicht durch Zufall – den Pfad in der Nähe des Waschbeckens gewählt hatten, blieben stehen, um ein Gebet unter den wilden Trauerweiden zu sprechen. Kichernd zeigten die Wäscherinnen zu den scheinheiligen Kirchenmännern hinüber, deren Gesichter sich flammrot färbten.
»Gebt den Priestern Ehefrauen, damit sie nicht nach Huren schielen, und den Mönchen Huren, damit sie nicht die Mädchen jagen«, rief eine der Wäscherinnen einen beliebten Spottvers hinüber. Die Diakone hoben eilig ihre Gewänder an und setzten ihren Weg in Richtung der Engelsbrücke fort, verfolgt vom Gelächter der Frauen.
»Was meinst du, Beatrice«, fragte nun ihre Nachbarin am Bassin, »es lohnt sich bestimmt, einigen dieser geistlichen Herrn zu Willen zu sein. Da regnet es Karlini statt kleine Kupfermünzen, und wir könnten uns in zwei Jahren ein wirkliches Kleid leisten. Ein Kleid wie eine wahre Kurtisane es trägt, aus Samt und Brokat, bestickt mit maurischen Blumen und Rosen.« Sie griff sich eines der noch schmutzigen, trockenen Bettlaken, schlang es wie eine Toga um sich und stolzierte vor Beatrice stolz wie ein Pfau auf und ab. Die schüttelte den Kopf.
»Du bist verrückt, Fiorentina. Dich würde höchstens ein armseliger deutscher Pilger in den Ginsterbusch zerren, der zahlt dann mit Hosenknöpfen, die er als Dukaten ausgibt, und du bist schön angeschmiert.«
Fiorentina hob mit gespielter Empörung die Augenbrauen, »Hosenknöpfe? Für wie dumm hältst du mich? Ich kenne die Hosenknöpfe aller Nationen – schließlich wasche ich sie jeden Tag.«
»Und doch lohnt es sich für Mädchen wie uns nicht, vom Weg abzukommen. Uns fehlt es an Schönheit und Bildung, Anmut, und schau dir nur unsere Hände an.« Sie streckte ihre von Lauge und Salz rissigen, geröteten Hände vor. »Wem sollen wir damit Vergnügen bereiten?«
»Aber doch nicht mit den Händen, das ist wider die Natur, sagt der Priester: Du sollst deine Saat nicht auf den Boden vergießen», neckte Fiorentina schlüpfrig.
Beatrice hob drohend die Holzkeule, beide lachten, dann machten sie sich wieder ans Werk, denn die Sonne hatte bereits ihren Mittagslauf begonnen. Bald würde sie senkrecht über dem Tiber stehen und so heiß brennen, dass an weitere Arbeit nicht zu denken war, bis sie im Westen schließlich an Kraft verlieren würde.
»Aber mal ehrlich, Beatrice«, fuhr Fiorentina fort, »glaubst du nicht, dass eine Kurtisane die köstlichste Freiheit genießt, die eine Frau hier unten erwarten kann. Sie hat Ansehen, eigenes Geld, kann ausgehen wie es ihr passt. Was ist dagegen eine reiche Bürgersfrau. Sie wird gegängelt, vielleicht gegen ihren Willen einem alten Greis vermählt oder ins Kloster verbannt. Schon mit zwölf Jahren darf keine Tochter aus gutem Haus mehr auf die Straße. Pfui, was ein Leben, da lob ich mir die Dienerinnen der Venus.«
»Fiorentina, du malst deine Bilder mal wieder mit dem Pastell der Blütenträume. Sei doch einfach froh, dass dir niemand den Gang in die freie Natur verbietet.«
»Oh, oh, oh, zum Waschen freilich, oder um das Wasser vom Brunnen zu schleppen, das Holz zu spalten oder die Fischabfälle vom Coppellenmarkt für eine stinkende Fastenspeise zu sammeln. Nennst du das Freiheit? Eine Kurtisane hingegen fährt in einer stolzen Kutsche. Sie isst frische Drosselpasteten und gemästetes Lamm.«
Vor ihr klatschte ein nasses Leintuch auf den steinernen Beckenrand. Beatrices Miene war wieder zornig. »Ich hätt wohl auch gern ein aufregendes Leben. Aber hör mir auf mit deinem albernen Kurtisanengeschwätz. Eine von ihnen ist es ja, die mir seit mehr als zwei Wochen schon Geld schuldet. Ich war so dumm wie du, für sie zu schwärmen. Für ihr milchweißes Madonnengesicht, die schönen Lippen, den weichen Leib.« Beatrice spuckte aus. »So viel ist es wert, dieses unschuldige Geschöpf, bah, hätte ich nur eines ihrer Spitzenhemden ein wenig ausgelaugt, einen Saum zerrissen oder ein Leintuch durch Ochsenblut geschleift.«
»Na, na, mein Kind«, meldete sich nun hinter ihr eine angenehme, melodische Stimme. Beatrice wirbelte herum, ein Lächeln vertrieb alle Zornesfalten aus ihrem Gesicht. »Märthe!«
Die alte Frau verzog ihr runzliges Gesicht zu einem amüsierten Schmunzeln. Die fröhliche, ungestüme Beatrice gehörte zu ihren Lieblingen, der sie all ihr Leinzeug, die Verbände, Wundtücher und Bettlaken zur Wäsche gab, die sie als Kräuter- und Heilfrau des Viertels reichlich verwendete. Obwohl Märthe erst vor einem halben Jahr von Deutschland her nach Rom gekommen war, verehrte man sie und vertraute ihren Fähigkeiten, zumal sie das Italienische mit großer Anmut sprach. »Was macht dich so wütend?«, fragte sie nun die kleine Wäscherin.
Beatrice verzog den Mund. »Ach, es geht ums liebe Geld«.
Märthe zückte ihren Beutel, der vom Gürtel ihres Kleides herabbaumelte, und kramte zwei Karlini hervor. »Hier meine Tochter, ich kann dir aushelfen, wenn du versprichst, diesen Stapel Leinzeug noch heute zu waschen.« Sie reichte Beatrice einen Sack mit Wäsche.
»O nein, Märthe, das geht nicht an. Ihr seid mir nichts schuldig. Wenn Ihr meinen Vater nicht vom römischen Fieber geheilt hättet, stünde es noch elender um mich und...«
»Du lägest seufzend in den Ginsterbüschen«, warf Fiorentina kichernd ein.
»Chiudi il becco! Halt dein Maul«, befahl Beatrice ihr grob, sie mochte es nicht leiden, dass die Freundin ihre losen Reden vor Märthe führte, die im Viertel fast wie eine Heilige verehrt wurde.
Doch Märthe war eine Heilige, der nichts Menschliches fremd war. »Nun sag schon, mein liebes Kind, worüber bist du so erbost, dass du sogar deine Freundin mit Schelte überziehst?«
»Oh, es ist nur, dass mir die Marietta aus der Händlergasse vierzig Karlini schuldet für vier Monate, die ich nun schon für sie wasche. Immer wieder kommt einer ihrer Diener, ein altes, taubes Hinkebein, hierher, um mich zu vertrösten. Und seit drei Tagen befindet es die Dame nicht einmal mehr nötig, den zu schicken. Deshalb sind wir nun mit der Miete im Rückstand, und der Wirt droht, uns aus der Kammer zu jagen. Aber Ihr wisst, wie schwach Vater noch ist. Das darf nicht sein. Und deshalb bin ich zornig, denn die vierzig Karlini sind unsere ganze Jahresmiete.«
Märthe zog die Stirn kraus, auch sie verabscheute die Saumseligkeit der reichen Kunden. Jeder einfache Flickschuster, der hier seine Leinhemden und Beinkleider reinigen ließ, bezahlte pünktlicher als die vornehmen Herrschaften. »Aber warum, kleine Beatrice, hast du so lange dieses Spiel mit dir treiben lassen. Ich kenne dich als gewitztes Wesen, das sich nicht leicht an der Nase herumführen lässt. Und vierzig Karlini sind eine wahrlich stolze Summe.«
Wie ertappt senkte Beatrice die Augen. »Es ist, es war... Also die Signora Marietta schien, schien mir etwas Besonderes zu sein. Sie hat so eine Art, dass man sie für eine donna sancta halten kann. Sicher, sie ist eine Kurtisane, aber keine der hochmütigen Sorte, die unsereinem Ohrfeigen verpasst, wenn wir sie nicht ordentlich grüßen. Sie hat auch selber ihre liebe Not, die Familie zu versorgen, und dann hat sie den süßen kleinen Knaben. Ich mochte sie wirklich gut leiden. Sie hat immer nach Vater gefragt und mir manchmal sogar einen Krug Pinienhonig oder Kräuterwein für ihn mitgegeben, und daher ...«
Beatrice kam nicht weiter, vom Flussufer drang lautes Geschrei herüber. Eine der Wäscherinnen, die zu dem kiesbedeckten Ufer hinabgestiegen war, um einige Leintücher zum Trocknen auszubreiten, schrie, als würde sie von einer Horde reitender Dämonen verfolgt. Stolpernd und unablässig kreischend zwängte sie sich durch das Ginstergebüsch nach oben.
»Holt die sbirri, holt die sbirri«, verlangte sie nach den öffentlichen Ordnungshütern des Governatore di Roma.
Am Becken angelangt, sank sie keuchend und erschöpft in die Knie. Jemand drückte ihr ein feuchtes Tuch auf die Stirn, doch sie schlug nach den Händen, die ihr helfen wollten, und brach in so heftiges Schluchzen aus, dass sie schließlich von Krämpfen geschüttelt wurde und ernsthaft Gefahr lief, zu ersticken. So trat Märthe beherzt hervor, holte aus und verabreichte der Flennerin eine kräftige Ohrfeige. Fiorentina kicherte, die Weinende war so empört und schockiert, dass sie das Weinen darüber vergaß und endlich einmal ausreichend nach Luft schnappte.
»Was«, so begann Märthe nun mit gebieterischer Stimme, die alle zum Schweigen brachte, »hat dich, gute Frau, so in Aufruhr versetzt?«
»Die, die Fratze eines Flussdämons. Eines scheußlichen, grinsenden, schwarzgesichtigen Dämons mit schrecklich geblähten Backen. Der faulige Pesthauch der Hölle entstieg seinem Mund, darin sah ich noch Wasser brodeln und ...«
Märthe hob die Hand. »Es genügt, gute Frau, ich werde selber nachsehen.« Damit schritt sie über die Wiese zur Uferböschung und kletterte sie erstaunlich behände, von den ehrfürchtigen Blicken der Wäscherinnen und des zusammengelaufenen Volkes verfolgt, hinab. Sie fand, was sie vermutet hatte: den hässlich zugerichteten, vom Wasser aufgedunsenen Kopf einer Leiche. Er war vom Rumpf abgetrennt und hatte sich im Geäst des Ufergestrüpps verfangen. Ein Knäuel von Haaren war im Gebüsch hängen geblieben und ließ den Kopf auf dem Wasser tanzen. Es war der Kopf einer Frau.
Beatrice, bekannt für ihren Übermut, sprang nun den Hügel hinab. Sie gehörte nicht zu den übermäßig abergläubischen Naturen und wusste, dass mancher Dämon nur der eigenen Seele entstieg oder aus einem geleerten Weinkrug. Neugierig trat sie hinter Märthe und prallte zurück. Mit Entsetzen betrachtete sie den grausigen Fund, eine Welle von Übelkeit überkam sie, und sie erbrach das magere Frühstück, das sie am Morgen genossen hatte. Märthe klopfte ihren Rücken. Hustend und immer noch würgend, brachte Beatrice schließlich hervor: »Ich kenne sie, Märthe. O Gott, ich kenne sie. Madonna mia. Was für ein Unglück.«
Man hatte dem toten Montefiscone ordnungsgemäß die Messen gelesen, seinen Leichnam nahe Sankt Peter begraben. Sein Herz und seine Eingeweide wurden jedoch – einem neuen Brauch folgend – in seiner Titelkirche beigesetzt. Darüber lag nun eine polychrome, marmorne Platte von beträchtlichem Wert. Gespendet hatte sie Kardinal Falvini, der die Nachfolge in den meisten der vakant gewordenen Ämter des Verstorbenen bereits angetreten hatte. Nur wenige verstanden die feine Ironie der lateinischen Grabinschrift: »Ehre, wem Ehre gebührt. Er starb einen Tod, der seiner Würde entsprach.«
Kardinal Falvini hatte sich bereits die wertvollsten Stücke des Erbes gesichert und den schäbigen Palazzo des Montefiscone von Wachen umstellen lassen, um die üblichen größeren Plünderungen durch Roms Straßenvolk zu unterbinden. Nun stand er wieder einmal vor einem Spiegel und betrachtete sich im neuen hermelingesäumten Festgewand des ersten Kardinalkämmerers. Ein Amt, das ihn zum mächtigsten Mann der apostolischen Kammer machte. Der Papst hatte sich mit der Ernennung beeilt. Nun überwachte der Purpurträger das Hauptschatzamt, die allgemeine Buchhaltung, das Büro des Abbreviators. Zudem hatte er den Vorsitz der Ernährungs-präfektur, war verantwortlich für Straßen- und Uferpflege, die Münze, Gefängnisse, Zoll, Wasserversorgung, die Archive und – was wichtiger war – die Waffenkammern. Auch der oberste Herr der sbirri war ihm verpflichtet und hatte ihm Bericht über die Verbrechen in der Stadt zu geben.
Falvini bewunderte gerade den roten Koffer, der zu den Insignien seiner neuen Machtposition zählte. Er malte sich aus, wie er nun bei Prozessionen feierlich auf einem weißen Araber und in der ersten Riege der Kardinäle durch die vom Volk gesäumten Straßen reiten würde. Ein Klopfen riss ihn aus seinen schwelgerischen Träumen. Der Bargello di Roma, höchster Polizeioffizier des römischen Gerichts, trat ein. Er zog seinen federgeschmückten Eisenhut und verneigte sich vor Falvini. Dann trat er zurück, um darauf zu warten, dass sein oberster Herr das Wort an ihn richtete. Verstohlen zählte er derweil die enorme Anzahl von Spiegeln in dem privaten Studierzimmer. Es waren genau dreizehn Stück. Der abergläubische Waffenmann war versucht, eilig ein Kreuz zu schlagen. Doch nun fiel der Blick Falvinis auf ihn.
»Und, was habt Ihr herausgefunden?«
»Hoher Herr, sie ist verschwunden.«
»Du Tor, das weiß ich. Ich selbst habe sie vor drei Tagen schon rufen lassen und ebenso viel erfahren. Warum habt Ihr nicht wenigstens ihre alte Metze Veronica hergeschleift?«
Der bargello fuhr unbeirrt fort. »Auch sie ist verschwunden. Das ganze Haus an der Händlergasse ist verwaist. Nur einen tauben, halb blöden Diener fanden wir vor. Er behauptet, dass eine Schar von Dämonen das Haus des Nachts heimgesucht und alle Bewohner entführt hat.« Er trug diese Vermutung mit einiger ehrfürchtiger Überzeugung vor. Dämonen wurden häufig der niederträchtigsten, grausamsten Verbrechen beschuldigt. Vor allem jener Verbrechen, bei der alle noch so hartnäckige Aufklärungsarbeit umsonst blieb und kein anderer Täter dingfest gemacht werden konnte.
»Soso, Dämonen«, wiederholte Falvini mit leisem Spott, der an den braven Ordnungshüter jedoch verschwendet war. »Hört, guter Mann, ich habe guten Grund zu der Annahme, dass in diesem Fall nicht der Teufel die Hand im Spiel hat. Mir liegt daran, dass Ihr die Frau Marietta rasch findet. Durchkämmt alle Straßen. Hort Ihr?«
Der Purpurträger hatte sich in immer größere Aufregung hineingesteigert. Dem bargello wurde mulmig bei so viel Eifer.
»Euer Eminenz mögen verzeihen, aber ich weiß nicht, ob ich meine Leute zu einer solchen Arbeit entbehren kann. Ihr wisst, ich befehlige nur einundvierzig sbirri, lediglich sechs sind beritten, und Rom ist groß. Außerdem ist die Dirn... die Frau erst den dritten Tag verschwunden. Vielleicht hat sie sich nur auf einen Ausflug gemacht. Die Sonne ist heiß, viele Kurti... Frauen ziehen sich auf die Weingüter zurück.«
»Ich dachte, sie sei ein Raub der Dämonen? Habt Ihr je von Dämonen gehört, die Kutschfahrten mit Kurtisanen unternehmen?«
»Oh, ich weiß nicht, Herr, aber man hört so einiges von den Foppereien und Ausschweifungen der Teufelsdiener.« Der Mann mit dem Eisenhut war ratlos. Warum quälte ihn sein neuer Herr mit diesem unsinnigen Auftrag? Montefiscone war ein angenehmerer, weil nahezu unsichtbarer Dienstherr gewesen. Eine Hure, jawohl bekräftigte der bargello insgeheim, eine liederliche Hure war verschwunden. Was hatte er damit groß zu schaffen? Falvini seufzte ungeduldig.
»Habt Ihr auch die Schlafkammer der Frau«, er scheute sich, Marietta eine Dirne zu nennen, »durchsucht?«
»Ja, Euer Eminenz, und dabei fanden wir blutverschmierte Tücher. Wir haben sie einem Exorzisten vorgelegt, und er meint, dass ihnen ein leichter Schwefelgeruch entsteigt, was eine sichere Spur für das Wirken Satans ist.« Mit kindlichem Stolz lächelte er dem Kirchenfürsten zu.
Der Kardinal nickte entnervt, aber kaum überzeugt. Es war eine Qual, mit solch tumben, korrupten, unfähigen Ordnungshütern geschlagen zu sein. Ihnen fehlte die entscheidende Fähigkeit zum Zweifel, die das Gehirn erst zu seinen größten Leistungen anspornte. Dafür waren sie mit einer gehörigen Portion Faulheit gesegnet, die sie die Verbrecher am liebsten in Wirtshäusern suchen ließ.
»Fandet Ihr noch etwas in der Kammer?«
»Nichts von Bedeutung. Einige Kleidungsstücke, ein Gesangbuch, Windeln, wertlosen Schmuck, wie einen einfachen Goldreif, eine Glasperlenschnur, ein Wolfskopfamulett, einen ...«
Der Kardinal fuhr herum. »Ein Wolfskopf sagt Ihr?«
»Ja, aber nur aus einfachstem Silber geschmiedet.«
»Schickt sofort den Haftrichter und sechs Eurer kräftigsten Männer in den Borgo. In der Via della Monti steht der Palazzo der Rodiconda, verhaftet sie und bringt sie hierher zu einem ersten Verhör.«
Der Mann im Eisenhut zögerte. Warum sollte er sich so aus heiterem Himmel mit der Verhaftung einer anderen Kurtisane belasten? Einer, die zudem großzügige Bestechungsgelder zu zahlen pflegte. Und überhaupt. Unten am Tiber hatte man gegen Mittag gerade einen Frauenkopf gefunden, dessen Beschreibung so abenteuerlich klang, dass er ihn sich gerne einmal angeschaut hätte. Sosehr er das Dämonische fürchtete, sosehr zog es ihn auch an und bereitete ihm köstliche Gefühlsschauer.
Der Kardinal, erzürnt über die Zögerlichkeit des Mannes und von furchtsamer Unruhe ergriffen, erhob nun schrill die Stimme.
»Ich sagte, verhaftet die Rodiconda. Sputet Euch, Kerl, sonst ist der Vogel ausgeflogen. Und geht unter starken Waffen, das Haus ist gut bewacht.«
»Aber unter welchem Vorwurf soll der Haftrichter sie denn festnehmen?«
»Sie ist eine schamlose Person. Sie hat mehrere Morde begangen. Ach, was rede ich, geht endlich und bringt mir die Rodiconda. Geht, oder es wird Euch übel bekommen.« Der Ton war nicht misszuverstehen, und unter eiligen Verbeugungen stürmte der Angesprochene aus dem Saal, verneigte sich in seiner Verwirrung sogar vor Almansor und stürmte dann mit klirrender Rüstung die Treppe hinab.
»Was meinst du, Almansor, habe ich La Luparella unterschätzt?«, fragte müde der Kardinal. Sein Gesicht war bleich, sein Magen meldete sich mit einem Zucken und Brennen, doch gemeiner, heller als dieser Schmerz, war der Gedanke an Marietta. Marietta, deren Augen für immer vom Tod geschlossen waren. Das konnte, das durfte nicht sein. Die wahren Teufel, das spürte Falvini deutlich, saßen in der eignen Seele, sie hießen Versuchung, Verlangen und Schmerz. Bislang war es ihm immer gelungen, den Dämon der Sehnsucht in sich zu besiegen. Doch nun, da ihm ein grausames Schicksal den Zugriff auf Marietta versagte, kam er gegen sein Verlangen nicht mehr an.
Es war einer der wenigen, kostbaren Momente, in denen der hohe Kirchendiener sich zu einem inbrünstigen, aufrichtigen, christlichen Gebet hingerissen fühlte. Mit fliegenden Rockschößen eilte er aus dem studiėlo, wies seinen Kammerdiener an, die Hauskapelle aufzuschließen, und kniete sich wenige Augenblicke später vor ein Marienbildnis hin, das er demütig anbetete. Seine Gedanken streiften kurz die Legende vom heiligen Bernhard von Clairvaux, dem großen Gründer des Zisterzienserordens. War ihm bei der Anbetung einer Marienfigur in einer Kapelle bei Chatillon nicht jenes erstaunliche Milchwunder zuteil geworden? Die hölzerne Jungfrau, so berichtete die Legende, hatte dem Asketen ihren Busen enthüllt, und ein Strahl Milch war herausgesprudelt.
War es denn angesichts solcher Mysterien wirklich so verworfen, so irr, dass nun er, beinahe vierhundert Jahre später, sich nach der Milch und den weichen Brüsten einer madonnengleichen Frau sehnte?
Gewiss war dies ein Fingerzeig Gottes und er, der damit nie gerechnet hatte, doch zu wirklicher Heiligkeit berufen. Er sah, was andere nicht sahen. Ein fantastischer Gedanke ergriff Besitz von ihm. Vielleicht war er, gerade er, der große Sünder Falvini, dazu berufen, ein Heiliger zu werden. Waren nicht beinahe alle Heiligen zunächst große Sünder gewesen? Der Kardinal malte sich aus, wie dereinst die Gläubigen zu seinem Bilde beten, ihn um Heilung bitten und ihm Kerzen und Blumen als Opfer darbringen würden. Bilder, die ihn mit tiefem Glück erfüllten. Immer wenn er seine Augen dem mild lächelnden Antlitz zuwandte, war es ihm, als lächele ihm Marietta entgegen.
Schließlich hielt es Falvini nicht mehr auf seinen Knien, er sprang auf, trat an das Bildnis heran und drückte seinen Mund wie zum Kuss auf den der heiligen Maria, so als wolle er der Statue sein Leben einhauchen. Kaum hatten seine Lippen den rauen Firniss berührt, als er, über seinen eigenen Unverstand entsetzt, zurückwich.
Die Madonna lächelte. War er vom Teufel besessen oder dem Allmächtigen nah?
Märthe drückte fest die Hand Beatrices, die immer noch kleine Schluchzer ausstieß. Gemeinsam stolperten sie durch die engen Gassen des Bankenviertels, wo in geheimen Kellern die Münzschaber und Tonsoren, Gold- und Silbermünzen heimlich abfeilten und dabei den Galgen riskierten. Hier lagen auch die Häuser der jüdischen Geldverleiher. »Beatrice«, sagte Märthe sanft, »fasse dich. Du musst mir zeigen, wo das Haus der Marietta ist.«
»Dort, wir müssen dort entlang«, schniefte Beatrice und wies auf einen kleinen steinernen Platz, auf dem munter ein Brunnen plätscherte, während die Häuser in tiefer Stille lagen. Man hielt Siesta, und nur in den kühlen Kellergewölben gingen einige Handwerker ihrem Geschäft nach.
Märthe zog Beatrice über den Platz. »Und nun?«
»Da hinein und rechts um die Ecke ist die Händlergasse, das Haus mit dem ockerfarbenenen Putz hat sie gemietet. Oh, Märthe, wartet. Ich fürchte mich.«
Die Alte blieb stehen. »Liebes Kind, es ist heller Tag, man wird uns nichts tun.«
»Aber, aber der Kopf, er war so grässlich zugerichtet.«
»Ein Schwerthieb, sonst nichts, den Rest haben der sumpfige Tiber und die schwüle Witterung besorgt, und mir scheint, dass die bedauernswerte Frau auch zu Lebzeiten keine größere Schönheit als ich war.« Beatrice musste wider Willen über Märthe lächeln, die so unbekümmert über ihre eigene Hässlichkeit sprach.
»Nein, liebe Märthe, bei allem was recht ist. So hässlich wie die Veronica seid Ihr nicht.«
»Umso mehr wundert es mich, dass einer eine alte Kupplerin ermordet«, sagte die Alte grimmig. »Komm, wir müssen mit ihrer Herrin sprechen.«
Zögernd setzte Beatrice sich wieder in Bewegung. »Was kann sie mit einer solchen Tat zu tun haben? Ich sage Euch, Märthe, auch wenn ich heute schlecht von ihr sprach, sie ist eine außergewöhnliche Frau. Wie ich stammt sie aus der Gosse, und doch habe ich nie eine schönere gesehen.«
Märthe heftete ihren Blick auf den Boden, um geschickt dem Schmutz und Kot auszuweichen. »Schönheit ist ein trügerisches und vergängliches Gut«, sagte sie grimmig, »verwechsele sie nie mit einem guten Herzen.«
Sie erreichten die Ecke, an der die Händlergasse begann. Vorsichtig bogen sie hinein. Aufgeregt zerrte Beatrice an Märthes Arm. »Seht, da stehen sbirri vor dem Haus Mariettas. Ich will mit ihnen nichts zu schaffen haben, lasst uns gehen«, flehte sie. Doch die Alte setzte ihren Weg unbeirrt fort, sie passierten die einfachen Laden und Kellergewölbe, in denen Knoblauchketten, getrocknete Tomaten, einfache Gewürze, Talg, Werg und andere einfache Dinge des täglichen Gebrauchs angeboten wurden. Auf den steinernen Stufen der schäbigen Häuser lagen träge die Katzen, während eilige Mäuse die Siesta der Jäger zu Beutezügen nutzten.
»Was wollt Ihr den Männern sagen?«, fragte flüsternd Beatrice, als sie nur noch wenige Schritte von den Wächtern entfernt waren.
»Ganz einfach, dass die Herrin dir ordentlich Geld schuldet. Dein hübsches Gesicht wird sie schon zu einer Antwort bewegen.« Und bevor Beatrice protestieren konnte, stellte sich Märthe frech vor die Männer hin.
»Seid gegrüßt«, sagte sie mit schmeichelnder Stimme. Und auch diesmal verfehlte der schöne Ton nicht seine Wirkung. Die sbirri spuckten zwar aus, wandten sich aber den beiden Frauen zu.
»Verzeiht, dass wir Euch in Eurer Arbeit stören. Wir kommen hierher, weil meine Tochter«, Beatrice schluckte, »meine Tochter eine größere Summe Geldes von der Hausherrin zu bekommen hat.« Die sbirri lehnten sich bequem auf ihre Lanzen. Märthe fuhr fort. »Ihr wisst, wie schwer es unsereins hat, wenn es um das Eintreiben von Schulden geht, so gering sie auch sein mögen, und meine Tochter ist ein fleißiges Mädchen, das eifrig seine Mitgift zusammenspart.« Beatrice schlug die Augen nieder, ein tiefes Rot überzog ihre vollen Wangen. Einer der sbirri betrachtete sie mit unverhohlener Lust.
»Was ist die Arbeit Eurer Tochter, Frau?«
»Sie ist eine der Wäscherinnen vom Ponte-Sisto. Sicher wisst Ihr, wie hart die Arbeit der Mädchen dort ist.«
Der sbirro, selbst ein Kind aus armen Verhältnissen, verstand. »Und wie viel schuldet man dir?«, fragte er nun direkt das Mädchen.
»Vierzig Karlini«, flüsterte Beatrice und tat so, als wage sie es kaum, dem großartigen Mann ins Gesicht zu blicken. Die Schmeichelei tat ihre Wirkung. Der Mann kratzte sich den Schädel und spuckte wieder in den Staub.
»Sind wirklich saumselig, diese Dämchen. Bilden sich ein, weil sie Hure irgendeines hohen Herrn sind, könnten sie dem Gesetz entkommen.«
»Ihr wollt mich also zu ihr vorlassen?«, fragte Beatrice mit dem beglückten Lächeln eines Kindes, das zum ersten Mal das Santo Bambino in der Krippe sieht. Der sbirro war beinahe gerührt über so viel Ehrfurcht, man behandelte ihn ja nachgerade wie einen Paradiespförtner.
»Ich würd dir gerne helfen, Mädchen. Mich dauert es jedes Mal, wenn eine so zarte Frau betrogen wird. Aber, es hilft nichts. Der Vogel«, er deutete mit einem schmutzigen Daumen hinter sich auf das Haus, »ist ausgeflogen. Vielleicht hat sie bereits bitteren Lohn für ihren Geiz empfangen.«
Märthe schaltete sich nun ein. »Ihr meint, die Marietta ist tot?« Der sbirro zuckte die Schultern. »Unser bargello nimmt es an. Glaubt sogar, sie sei direkt in die Hölle gefahren. Einer der Diener erzählt wirres Zeug von einem Mann mit Geieraugen in weißer Kluft und mit schwarzen Schwingen, der sie geraubt hat.«
Beatrice runzelte ärgerlich die Stirn, sie hatte reichlich genug von diesem Dämonengeschwätz. Sie wollte Märthe fortziehen. Doch die stand bleich vor dem Mann und schaute ihn an, als sei er ein Geist. »Ein weiß gewandter Mann mit Vogelgesicht?«, wiederholte sie.
»Ja, kennt Ihr eine solche Gestalt?«
Märthe schüttelte langsam den Kopf, dann wandte sie sich zum Gehen und zog Beatrice mit sich fort. Sich kurz besinnend, drehte sie sich noch einmal um. »Der Mann, ich meine der Diener, hat er ein schwaches Augenlicht?«
Verdutzt schaute der sbirro sie an. »Gewiss, er ist halb blind. Warum fragt Ihr?«
»Ach es ist nichts, nichts. Wir danken Euch für Eure Auskünfte.«
»Tut mir Leid, dass es Euch wenig hilft«, sagte bedauernd der Mann, und Beatrice schenkte ihm zum Dank ein süßes Lächeln.
Sie waren wieder am Ende der Gasse angelangt, als sie Märthe aufgeregt fragte. »Was war das, warum wusstet Ihr von den schlechten Augen des Dieners? Kennt Ihr einen Mann mit Vogelgesicht?«
Märthe sah das Mädchen nachdenklich an. »Es ist ein Traumgesicht, das ich in den letzten Wochen oftmals hatte.«
Beatrice seufzte. »O Märthe, nicht auch Ihr. Ich hasse all diesen Bombast um fliegende Teufel und Geisterfratzen.«
»Ich spreche nicht von einem Geist, Beatrice. Ich spreche von einem Mann, der das Böse in Menschengestalt ist. Ein Teufel, den ich endlich ausmerzen muss, denn es ist Gottes Wille. Doch alleine schaffe ich es nicht. Vor sechs Wochen habe ich Hesekiel schon um Hilfe ausgesandt, ich hoffe, er kehrt bald zurück.«
»Ist Hesekiel ein Diener von Euch? Und wo soll er Hilfe holen?«
»Im Norden. In Deutschland. Dort kenne ich einen vortrefflichen Mann, der es auch mit den härtesten Kerlen aufnehmen kann, sogar mit einer ganzen Armee.«
Beatrice lauschte immer ungeduldiger. »O Märthe, was redet Ihr, wie soll Euer Hesekiel diesen Weg schaffen?«
»Er kann fliegen.«
Beatrice schauderte. »Ihr macht mir Angst, liebe Muhme. Ihr sprecht wie eine billige Kräuterhexe, verzeiht. Fliegende Boten, Männer, die ganze Armeen vernichten. Und ein Mönch, der Euch im Traum erscheint und den Ihr einen Teufel nennt. Was soll das sein?«
»Der Mann, den ich meine, ist mein Bruder.«
»Dann kann er kein Teufel sein«, protestierte Beatrice.
»Er ist das Böse in Menschengestalt. Ich bete zu Gott, dass er bald Hilfe sendet.«
Beatrice schüttelte den Kopf über die wunderlichen Ideen der Alten.
»Scoferino«, sagte sie dann plötzlich und hielt Märthe am Ärmel zurück.
»Wer ist das?«, fragte die Alte.
»Mariettas Geliebter. Der Vater ihres Kindes Prospero. Ich kenne ihn, einmal kam ich zu ihr, da saß sie ihm für ein Marienbild. Ihre leuchtenden Augen verrieten mir alles. Er muss etwas wissen, er war beinahe jeden Tag bei ihr.« Die Frauen rafften ihre Röcke und wechselten die Richtung. Eine halbe Stunde Weg lag vor ihnen.