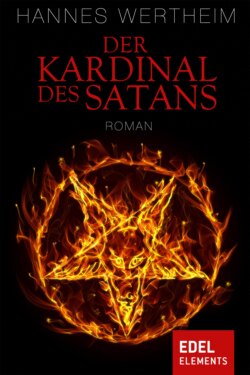Читать книгу Der Kardinal des Satans - Hannes Wertheim - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
Оглавление»Media vita in morte sumus – Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben.«
Die tiefen Schnittwunden brannten wie Feuer. Mit Mühe schob Marietta die Maske von ihren Augen in die Stirn. Blut rann ihre Wangen herab, doch sie war in diesem Moment nur dankbar, dass sie noch lebte, ihre Weiblichkeit unangetastet war und der gut gewetzte Degen ihr nicht auch das Augenlicht geraubt hatte. Mühsam zwängte sie sich aus dem umgekippten Tragsessel. Der Palazzo Ghiotti lag im Dunkeln, von dort konnte sie keine Hilfe erwarten, aber auch sonst würde sich kaum jemand um das Schicksal einer Verletzten scheren, aus Angst, selber in Händel verwickelt zu werden.
Wer konnte schließlich ahnen, ob das Frauenzimmer nicht selbst Schuld an ihrer Behandlung trug? Jedes anständige Weibsbild lag um diese Stunde bereits im Bett. Marietta bemühte sich aufzustehen, allein der Schock und der pochende Schmerz raubten ihr alle Kräfte. Ihr schwindelte, zuckende Sterne tanzten vor ihren Augen. »Du musst hier weg«, befahl ihr immer wieder eine innere Stimme, »du musst hier weg, bevor sie umkehren, um dich zu töten. Sie wollen keine Zeugin.«
Mühsam schleppte sich die Kurtisane auf das Tor des Palazzo zu, um sich im Schatten des Eingangs zu erholen und Kräfte für den Rückweg zu ihrem Haus zu sammeln. Schmutz und Blut mischten sich auf ihrem Mieder zu hässlichen Flecken, ihre Ellbogen schmerzten, als sie sich über das raue Pflaster der Straße näher an das Tor heranrobbte, während sie gegen eine aufkommende Ohnmacht ankämpfte.
Sie hatte die ersten Stufen im dunklen Torbogen beinahe erreicht, als ein Mann zwischen sie und die Treppe trat. Der Saum einer weißen Kutte war das letzte, was Marietta wahrnahm, bevor sie das Bewusstsein verlor. Gnädig umhüllte sie eine weiche dunkle Decke, so wohlig fühlte sich das an, als schlage tatsächlich einer ein weiches Tuch um sie.
Das Fest Falvinis erreichte mit der Enthüllung der Bahre seinen Höhepunkt, noch Tage später sollten die Gassen Roms schwirren von den Erzählungen über die unglaubliche Köstlichkeit, die der Kardinal seinen Gästen geboten hatte. Die Musik hatte ausgesetzt, mit beinahe atemloser Stille schauten nun alle auf einen Körper, der nackt bis auf einen Seidenschurz im Sarkophag lag.
Es war die Leiche eines wohl achtzehnjährigen Knaben, seine Haut war wie von grauem Marmorstaub überzogen, in seine dunklen Locken hatte man einen Kranz aus Efeu und Myrte gedrückt, um seinen vollkommenen Leib einen Ring aus duftenden Tuberosen gelegt, der den leichten Geruch von einsetzender Fäulnis übertönte. Wie ein antiker Zeremonienmeister stand der Kardinal Falvini im Gewand des Apoll an der Stirnseite des Sarkophages. Mit seiner angenehmen, tiefen Stimme durchbrach er die ehrfurchtsvolle Stille: »Seht diesen Jüngling, ich bringe ihn Euch als Geschenk. Betrachtet ihn genau, denn seine vollkommene Schönheit ist nun der Vergänglichkeit preisgegeben. Meine Diener haben ihn nach den Anweisungen eines außerordentlichen jungen Gelehrten aus Perugia nahe der Via Appia antica dem Erdreich und dem Vergessen entrissen. Er war ein wahrer Römer, wie das Ebenmaß seines Antlitzes verrät. Sein Leichnam hat auf geheimnisvolle Weise die Jahrhunderte überdauert und gibt uns ein Zeugnis von der Größe unserer stolzen Vorfahren, die, wenn auch keine Christen, so doch Künstler waren, und jeder Künstler trägt den göttlichen Funken in seiner Brust. Kommt und betrachtet dieses Werk unseres Schöpfers.«
Nach dieser Ansprache verneigte sich der Kardinal und kehrte zu seinem Prunksessel zurück. Aufgeregtes Raunen und Wispern begleiteten ihn. Sogar der feiste della Forsa vergaß, seinen leeren Weinbecher nachfüllen zu lassen. Die Augen traten ihm aus den Höhlen, während er auf den aufgebahrten Knaben starrte. Unübertrefflicher Falvini. Ihm war gelungen, was zuletzt vor mehr als 50 Jahren die heilige Stadt in Aufruhr versetzt hatte: die Entdeckung eines Balsamierten aus der Cäsarenzeit.
Im Jahre 1486 war es ein junges Mädchen gewesen, das man im Kapitol aufbahrte und an dem jeden Tag an die 400 Römer staunend vorbeigezogen waren, bis die Leiche endgültig zu Staub zerfiel. Die Chronisten der Kurie hatten sich damals einander überboten, um die Vollkommenheit des Geschöpfes zu betonen, deren Körper – so hatte es einer vermerkt – allerdings hart wie Stein und deren Haut von lederner Art gewesen war. Trockene Kräuter und Sand hatte man später in ihrem Leib entdeckt, doch niemand hatte erklären können, wie der Verfall ihres Körpers zum Stillstand gebracht worden war. Eines jedoch wurde mit Bedauern festgestellt, dass nämlich die Entfernung aus dem Sarg die Schönheit schließlich in wenigen Tagen für immer vernichtet hatte. Umso köstlicher und verschwenderischer von Falvini, eine solche Gestalt nun einfach den Elementen preiszugeben, allein, um seine Gäste zu verzaubern.
Niemand unter den Anwesenden hegte einen Zweifel an der Echtheit des toten Knaben. Der Kardinal war zu gebildet und zu stolz, um in dieser Sache einen schnöden Betrug zu begehen. Einige Edelleute sprangen nun über die steinerne Balustrade des Wandelgangs in den Innenhof und näherten sich keck dem Toten. Doch keiner wagte es, so nahe an das Wunderwerk heranzutreten, dass er es hätte berühren können.
»Oh, ihr Helden«, neckten einige tolldreiste Kurtisanen, »gibt es keinen, der dem schönen Toten den Gruß entbieten möchte? Einen Handschlag? Einen Kuss?« Die restlichen Gäste erhoben sich nun von der Tafel und bildeten eine Art Prozession. Ehrfurchtsvoll reihten sie sich in die Schlange ein, die an dem Sarg vorbeizog. Ein jeder war betroffen von dem bemerkenswerten Zustand des Leichnams und fühlte sich beim Betrachten der stillen, bleichen Züge so, als habe er einen Blick in die Ewigkeit getan.
»Welch köstlicher Trost«, flüsterte della Forsa ehrfürchtig, »dass so viel Perfektion die Jahrhunderte überdauert hat. Tu auf dein Herz vor so viel Schönheit.« Der Mailänder hielt sich sein unvermeidliches Mundtuch vor die Nase. »Mir scheint, der Jüngling riecht etwas streng.«
Falvini betrachtete das Schauspiel mit Befriedigung. Dieses Geschenk an seine Gäste übertraf jeden gewöhnlichen Stierkampf, jede Löwendressur und jede Pfauenparade, mit denen die Kaufmannschaft ihre Bankette zu zieren pflegte. Befriedigt lehnte er sich zurück und ließ seinen Blick durch die Wandelgänge streifen. Alle Tische waren leer, niemand wollte versäumen, den Knaben zu betrachten. Doch dann fiel sein Blick auf den schlafenden Montefiscone. Entsetzt richtete er sich auf. Die zusammengesunkene Haltung verriet ihm alles. Wer hatte es gewagt! In seinem Hause! Sein empfindlicher Magen krampfte sich kurz zusammen. Doch in diesem Moment konnte er sich keinen seiner Anfälle gestatten. Verstohlen machte er einem der Sarasine ein Zeichen. Der Mohr verstand sofort und näherte sich seinem Herrn. Flüsternd gab der Kardinal seine Befehle, und unbemerkt von den anderen Gästen wurde sogleich der schlaffe Leib Montefiscones von der Tafel entfernt und ins Haus geschleppt. Die allgemeine Ausgelassenheit, der Wein, die Musik und die Sensationen des Festes hatten eine Entdeckung des Toten bislang scheinbar verhindert.
Um die Verschwiegenheit seiner schwarzen Diener sorgte sich der Kardinal nicht, da sie alle der Zunge beraubt waren. Dennoch, die Furchen in den Mundwinkeln des magenkranken Kirchenfürsten vertieften sich beim Gedanken an einen Giftmord in seinem Haus. Einen Giftmord, den er nicht angeordnet hatte. Hatte es della Guarde etwa gewagt? Nein, so dreist war dieser dürre, unansehnliche Dominikaner nicht, er legte auch nie selbst Hand an, nicht einmal, um etwas Pulver in einen Becher zu schütten. Die Mundwinkel Falvinis zuckten erneut, eine weitere Welle von Krämpfen beeinträchtigte sein Denkvermögen.
Vor ihm kam nun Unruhe in die Prozession der Bewunderer. »Was tut Ihr?« – »Oh, welche Dreistigkeit!« – »Impossibile!« Hell ertönte das entzückte Lachen einiger Kurtisanen. Falvini gab Anweisung, ihm freien Blick auf den Sarkophag zu verschaffen. Er wollte sehen, was zu der Aufregung führte, ob jemand den edlen Knaben versehentlich verrückt, berührt oder sonst wie beschädigt hatte. »Tretet beiseite, beiseite« trieben zwei Höflinge die Gäste auseinander. Einige waren von sich aus zurückgewichen, denn vor ihren Augen tat ein schlanker, junger Edelmann mit einer Maske aus Pfauenfedern etwas Unerhörtes. Falvini biss die Zähne zusammen, vor Schmerz und vor Wut. Der Jüngling im grünen Wams und engen, zweifarbigen Beinkleidern beugte sich über den Sarkophag und – der Kardinal rang nach Luft über solche Unverschämtheit – drückte dem Toten einen Kuss auf die kalten Lippen.
Triumphierend richtete er sich danach auf und lachte in die Menge.
»Hier seht ihr einen, der es wagte, ein Geschenk Gottes zu küssen.« Dann packte sich der Unverschämte eine der herumstehenden Tänzerinnen, bog der Entsetzten den Kopf zurück und küsste auch sie. Als er sie losließ, floh das Mädchen unter entsetzlichen Schreien und dem Gelächter der Menge aus dem Innenhof. Der junge Pfau selbst lachte ein kehliges, höhnisches Lachen. Falvini erkannte es sofort. Es war das Lachen Rodicondas, genannt La Luparella, die große Wölfin. Roms teuerste und erste Kurtisane, seine verspielte, tolldreiste Konkubine, die er an diesem Abend freilich nicht eingeladen hatte.
Wütend raffte er seine Tunika zusammen. »Spielt auf«, gab er den Musikanten Befehl und seinen Gästen damit das Zeichen, sich wieder den Festfreuden zuzuwenden. Man gehorchte. Er selbst aber ließ den höchsten seiner Gäste, denen er Respekt schuldig war, bestellen, er befinde sich nicht wohl und wolle sich für einen Aderlass in sein Kabinett zurückziehen.
Diese Mitteilung führte zu verschiedenen Spekulationen. Der Satz, »Er hat etwas gegessen, was ihm nicht bekam«, machte die Runde, und dieser Satz hieß nichts anderes als »man hat ihm Gift verabreicht«. Als der Satz bei della Forsa anlangte, warf der Mailänder ihm einen Blick, gemischt aus Triumph und Verachtung, zu. »Mundet Euch Euer Wein noch?«, fragte er höhnisch. Della Forsa zuckte die Achseln.
»Ich habe nichts, um das man mich beneiden könnte. Ein armer Kirchenmann wie ich ist kein Körnchen Gift wert.«
Falvini wusste, dass das Gerücht eines Giftanschlages gegen ihn aufkommen würde, und es war ihm nur recht, angesichts des unwillkommenen Toten in seinem Haus. Wenn er selbst als Opfer galt, konnte er schlecht gleichzeitig als Täter eines Giftanschlages verdächtigt werden. Sollten die Leute später ruhig behaupten, auf seinem Bankett habe man Montefiscone erfolgreich, aber dem Gastgeber vergeblich nach dem Leben getrachtet. Jetzt galt es, sich zurückzuziehen. Er brauchte Ruhe, um nachzudenken. Ruhe, um seine elenden Krämpfe zu beruhigen. Inmitten aller Pracht war er vom Tod umgeben. Wie seltsam widersprüchlich war das Leben, wie wenig Trost hielt es selbst für den Edelsten bereit.
»Marietta« schoss es ihm durch den Kopf. Er sehnte sich nach Marietta. Warum hatte er sie nicht zu sich rufen lassen? Ihre Gegenwart hätte ihn nach den Anstrengungen eines solchen Banketts beruhigt, vielleicht sogar erheitert. Aber er hatte Marietta nicht bestellt, denn es behagte ihm nicht, wie viel Macht diese kleine, unbedeutende Dirne über sein Fühlen hatte.
Marietta erwachte widerwillig. Ihre Lider flatterten, doch sie weigerte sich, sie zu öffnen. Langsam kehrte das Bewusstsein zurück, und ihre erste Erinnerung galt dem blitzenden Degen, mit dem der nächtliche Angreifer ihre Wange zerschnitten hatte. In Erinnerung daran kniff sie noch einmal fest die Augen zusammen. Mein Gott, wer hasste sie so sehr, um ihr ein sfregio zuzufügen – die Narbenstrafe. Wer bezahlte dafür, dass ein Gauner sie mit der Klinge zu entstellen versuchte? Für gewöhnlich pflegten verfeindete Kurtisanen sich auf diese Weise gegenseitig zu strafen. Doch Marietta hielt sich für zu erfolglos und gering, um den Zorn einer anderen Liebesdienerin zu erregen. Auch ein zurückgewiesener Liebhaber gehörte nicht zu ihren Bekannten, der mit der Narbenstrafe dafür sorgen wollte, dass kein anderer Mann sie noch begehren würde. Begehren! Entsetzt tastete Marietta bei dem Gedanken nach ihrer linken Wange, doch sie bekam nur raues Leinen zu spüren. Man hatte sie also verbunden.
Endlich wagte sie es, ihre Augen ganz zu öffnen. Sie lag in ihrem Bett, in ihrer Kammer, sie ließ den Blick durch den Raum schweifen, und jeder ihr vertraute Gegenstand verschaffte ihr Erleichterung. Beim Anblick ihres schlafenden Sohnes wollte sie lächeln, doch der jähe Schmerz, der dabei ihre linke Wange durchzuckte, ließ sie laut aufstöhnen. Das Geräusch rief ihren Retter herbei. Verschwommen erkannte sie durch einen Tränenschleier des Schmerzes wieder dieses weiße Gewand.
Sie wischte sich die Augen und sah nun einen vogelgesichtigen Mann vor sich, der die Tracht des Dominikanerordens trug. Ein einfacher Mönch hatte sich ermannt, sie zu retten. Ihr Herz füllte sich dennoch nur widerstrebend mit Dankbarkeit, denn der Ordensmann war ihr unheimlich mit seinem dünnen Hals, der krummen langen Nase und den hellen, stechenden Augen, die sie durchdringend musterten.
»Ihr seid wach?«, fragte der Mönch mit einschmeichelnder Stimme. Marietta nickte stumm.
»O, Ihr scheint Euch zu fürchten. Dazu besteht kein Grund mehr. Ihr seid in Eurer Schlafkammer und in Sicherheit. Niemand wird Euch hier etwas tun.«
Mühsam richtete Marietta sich ein wenig auf. »Wie, wie wusstet Ihr, wo Ihr mich hinbringen musstet?«
Der Mönch zuckte leicht unter dieser scharfsinnigen Frage, sie kam unerwartet. Doch er fasste sich schnell.
»Nun, Ihr habt in Eurer Ohnmacht immer wieder diese Adresse gemurmelt, und als auf mein Klopfen Eure«, er pausierte kurz, um nach einer angemessenen Bezeichnung zu suchen, »als Eure Hausdame mir öffnete, rief sie sofort Euren Namen.« Marietta schwieg wieder, und der Mönch beeilte sich, über weitere Fragen hinwegzuplaudern. »Ich habe versäumt mich vorzustellen. Mein Name ist Claudius. Wie Ihr an meiner Aussprache bemerkt, bin ich nicht Euer Landsmann. Ich komme von Deutschland her, gehöre dem Orden der Dominikaner an und versehe seit kurzem das Amt des Beichtvaters im Kloster der Reuerinnen Santa Maria Maddalena.« Marietta stöhnte bei dem Namen des armseligen Klosters, in dem sie aufgewachsen war, leise.
Der Mönch aber fuhr unbeirrt fort. »Als ich Euch heute Nacht fand, fürchtete ich zunächst, dass alle Hilfe zu spät käme, es schien, als wären Eure Verwundungen bei weitem schwerer, doch Euer Leib ist unversehrt.« Unwillkürlich zog Marietta die Decke höher. Der Gedanke, dass die dürren Finger des Pfaffen sie entkleidet und untersucht hatten, behagte ihr nicht.
Der Mönch schien ihre Gedanken zu erraten und fügte so harmlos wie möglich an: »Verzeiht, dass ich mir diese scheinbaren Freiheiten nahm, doch bevor ich die Profess ablegte, habe ich mich medizinischen Studien gewidmet, war unter anderm Schüler des Paracelsus, dessen Ruhm Euch vielleicht bekannt sein dürfte, da er lange in Rom, Bologna und Florenz weilte.«
Marietta krauste – wieder unter Schmerzen – ihre schöne, unversehrte Stirn. Hielt dieser Mönch sie zum Narren? Wenn er tatsächlich Beichtvater im Kloster der Reuerinnen war, also vertraut im Umgang mit ehemaligen Dirnen, Bordellhuren, Kurtisanen und ihren Bastarden, dann musste er doch in ihr die Liebesdienerin erkannt haben. Wieso behandelte er sie dann mit so viel Zuvorkommenheit und einem Respekt, der an Unterwürfigkeit grenzte.
Ihr Kopf begann erneut zu schmerzen. Vor der Tür machte sich nun Veronica zu schaffen. Marietta erkannte die nölende Stimme der Alten sofort. »Bitte«, flehte sie den unheimlichen Mönch an, »bitte haltet mir die Alte vom Leib, ich, ich könnte ihre Vorwürfe nicht ertragen. Ich muss schlafen, ich will schlafen. Morgen bleibt genug Zeit, um die Schmerzen wieder zu spüren.« Der Mönch versuchte ein Lächeln, doch die nach oben verzogenen Mundwinkel machten ihn nur einem Aasvogel ähnlich.
»Seid beruhigt, meine Tochter. Ich lasse Euch nicht mehr im Stich. Ich werde das Weib im Zaum halten, das verspreche ich. Bald werdet Ihr nichts mehr mit dieser Elenden zu tun haben.« Der letzte Satz war so von Bosheit durchtränkt, dass die schläfrige Marietta für einen Moment Veronica in Schutz nehmen wollte, doch dann übermannte sie die tiefe Müdigkeit, die sie gnädig vor den Vorwürfen Veronicas und ebenso gnädig vor Selbstvorwürfen schützte. Morgen war Zeit genug, um das ganze Elend ihrer Lage zu bedauern. Eine Kurtisane mit zerschnittenen Wangen war keinen Karliho mehr wert, sondern nur noch ein höchst bedauernswertes, zu Bettelei und Armut verdammtes Geschöpf, das der geringste Gassenjunge mit beißendem Spott verfolgte.
»Scoferino«, seufzte Marietta, bevor sie in einen tiefen, traumlosen Schlaf versank. Claudius, der Mönch, warf ihr einen listigen Blick zu, bevor er die Kammertür hinter sich schloss. »Verliebte Närrin«, murmelte er zufrieden, dann brachte er die greinende Veronica mit einem bösen »Schweig, alte Metze« zur Ruhe.
Die Kerzen flackerten leise vor den venezianischen Spiegeln und tauchten das kostbare studiėlo in ein mildes, gelbes Licht, das sich in weiteren Spiegeln fing und so von allen Wänden her zurückgeworfen wurde. Strahlend überglänzte es die kostbaren Möbel, setzte Lichtsterne auf die bemalten Sitzbänke, die ledergepolsterten Sessel und das Klavichord aus Piacenza, auf dessen mit Intarsien verziertem Deckel einige wertvolle Handschriften ausgelegt waren. Die antiken Werke des Epikur, die neuen Übersetzungen des Plato verrieten Falvinis Hinwendung zur sinnenfreudigen, heiteren hellenistischen Welt. Die zeitgenössischen politischen Schriften, wie Macchiavellis »Der Fürst«, den Hunger nach Macht.
Erschöpft und angenehm benommen betrachtete Kardinal Falvini sich ohne einen Hauch von Selbstzweifeln in einem der kunstvoll geschliffenen Spiegel. Ein erhitzter Schröpfkopf sog ihm Blut aus seinem rechten Oberarm. Die Kerzen milderten gnädig die tiefen Furchen an beiden Seiten seines Mundes, die sein Magenleiden verrieten.
»Es ist wie immer das Übliche«, sagte der Leibarzt, während er seine Gerätschaften, den festen Gürtel zum Abschnüren der Ader und sein blinkendes Schermesser in einem Kästchen verstaute. »Ihr habt einen bedenklichen Überfluss an hemmenden, saturnischen Elementen in Eurem Blut, was gelegentliche Stauungen und Krämpfe verursacht. Die Aufregungen des heutigen Abends haben ein Übriges getan. Neben dem Aderlass empfehle ich Euch weiterhin den Genuss von frischer Muttermilch. Sie wirkt besänftigend, hilft bei schwarzer Leber und klärt das Gemüt. Euer Eminenz halten sich doch an die Verordnung?«
»Mit aller Pünktlichkeit.«
»Aber geht sicher, dass die Milch auch wirklich frisch abgepresst wird. Sie muss süß im Empfinden sein und nicht stockig. Tragt Sorge, dass ein verlässlicher Diener damit betraut wird.« Falvini nickte, ohne zu verraten, wie frisch von der Quelle er die verordnete Milch tatsächlich zu sich zu nehmen pflegte. Nur ungern inspizierte er die Auswirkungen der verordneten Medizin auf sein Gemüt. Die Kur linderte zwar das Brennen in seinem Magen, aber zugleich versetzte sie sein Herz in ungewohnten Aufruhr.
»Ihr wirkt zerstreut, Kardinal Falvini«, bemerkte der Arzt.
»Es ist nichts, nur das abfließende Blut lähmt meine Kraft ein wenig.«
›Marietta‹, flüsterte dabei in ihm wieder ein neckischer Dämon. ›Du sehnst dich nach Marietta.‹ Falvini brachte all seine bewusste Willenskraft in Stellung, um diese Einflüsterungen zu unterbinden, und seufzte gequält. Er, der weder Hölle noch Teufel fürchtete, wurde doch tatsächlich von der Liebe, Liebe in ihrer reinsten und lautersten Form, in Versuchung geführt. Was nur, was war es, das ihn seine späte Amme, so nannte er Marietta scherzhaft, so verzweifelt begehren ließ und ihn zugleich in demütiger Ehrfurcht vor ihrem Wesen niederzwang? Ihn, den mächtigen, vielleicht sogar mächtigsten Mann der Kurie. Der Sarasin Almansor trat still neben ihn, goss etwas Wein zur Stärkung in einen Becher und reichte dem Kardinal das Getränk.
»Geleite den Leibarzt nun zu Montefiscones Leichnam«, befahl der Kirchenfürst. Der Mohr nickte stumm.
»Ich wünsche eine genaue Untersuchung, werter Mann«, wandte sich Falvini noch einmal an den Mediziner, »und hoffe auf Eure Diskretion.« Der Angesprochene verneigte sich.
»Ihr könnt Euch ganz auf mich verlassen, es gibt kaum eine Todesart, die ich nicht zu bestimmen wüsste. Sei es die französische Krankheit, das englische Lungenfieber, Gift oder die Pest.«
»Die Pest?«, fragte Falvini mit dem üblichen Entsetzen.
»Ja, Monsignore, sie lebt wieder auf«, antwortete seufzend der Arzt, »wenngleich nur vereinzelt und mehr in den Armenvierteln und den sumpfigen Ebenen auf der Westseite des Tibers, aber vielleicht ...«Er beendete den Satz nicht und wandte sich zum Gehen. Falvini begriff blitzschnell. War das eine Aufforderung zur Bestechung seines Urteils? Die Diagnose eines Pestfalls würde Falvini einige Unannehmlichkeiten ersparen. Immerhin hatte er erst kürzlich Anspruch auf das höchste, nun freie Amt des Toten angemeldet. Die Ordnungshüter des governatore würden sich jedoch scheuen, ein pestilenzisches Haus aufzusuchen, um genauere Befragungen durchzuführen. Ja, die Pest schien ihm wie ein Geschenk Gottes in diesem Fall.
»Signor Atoli«, rief er den Gelehrten daher zurück, »ich gedenke Euer Salär für die Behandlungen zu erhöhen, da sie mir außerordentlich wohl tun. Auch werde ich Euch einige Messen lesen.«
»Ihr seid zu gütig.«
»Oh, dankt mir nicht, einem so aufrechten Christen wie Euch, der die Pest nicht scheut und so viel Gutes wirkt, gebührt ein hoher Lohn.« Noch einmal verbeugte sich der Mediziner und ließ sich dann von Almansor hinausführen.
Der Purpurträger konzentrierte sich wieder auf sein eigenes Bild im Spiegel. Ein Anblick, der ihm stets Beruhigung und höchsten Genuss verschaffte. Sein Kinn war kräftig geschwungen, die Backenknochen waren hoch und stark ausgeprägt, die Augen schmal und dunkel und etwas schräg gestellt. Sein erster großer Gönner hatte ihn darum zärtlich seinen kleinen Tscherkessen genannt. In der Tat war Battista Forlini, nun der Kardinal von Falvini, in seinen jungen Jahren ein reizvoller Jüngling gewesen, dessen volle, aufgeworfene Lippen Wonnen der Wollust versprachen und noch nichts von der kalten Grausamkeit und Zügellosigkeit kommender Jahre verrieten.
So schön war er gewesen, dass sein Gönner, der Kardinal von Tortosa, ein Mann, der die verkehrte Venus anbetete und das feste Fleisch junger Knaben schätzte, ihm schon im Alter von sechzehn Jahren eine Bischofsmütze verschaffte. So konnte er den ehemaligen Straßenjungen stets und ohne Verdacht zu erregen an seine Seite zitieren und intime Konklaven mit ihm halten.
Der Jüngling hatte es dem alten Sodomiten freilich nicht mit gleicher Hingabe und Zärtlichkeit gedankt, sondern sich nach Erhalt der ersten Pfründe in scheinbare Heiligkeit gehüllt und alle Liebesdienste – außer dem Küssen des Kardinalsringes – verweigert. Voll Gram hatte der Kardinal von Tortosa diese überraschende Kälte seines Schützlings zur Kenntnis genommen.
Doch blieb ihm nicht viel Zeit, seinen Kummer zu beweinen, da der jugendliche Bischof dem Leben des greisen Kirchenfürsten mit einer ausreichenden Dosis Gift ein Ende setzte, um sich aus jeglicher unbequemen Abhängigkeit zu lösen.
In Gedanken an diese erste Tat, die am Anfang einer langen Kette weiterer eleganter Intrigen und einträglicher Morde stand, lächelte der Kardinal von Falvini sich zu.
Das Testament seines ersten Gönners war Grundlage seines Reichtums geworden, den er in den folgenden Jahren mehr als verzehnfacht hatte. Sein außerordentliches Geschick und seine Freundschaft zu den ersten Sekretären der kurialen Datarie, die als Erste informiert wurden, wenn Pfründe durch Verfall, Verzicht oder Tod eines Amtsinhabers frei und käuflich wurden, hatten ihm zu einem raschen Aufstieg in höchste Ämter und Würden verholfen. Falvini, so hieß es in Rom, müsse mit dem Teufel im Bunde stehen, da er so oft anderen hoffnungsfrohen Prälaten und aufstrebenden Diakonen die schönsten Ämter vor der Nase wegschnappte.
Die Natur hatte ihn mit einem kalt berechnenden Verstand ausgestattet, einer unnahbaren Seele und einem sicheren Instinkt für drohende Gefahr. So war Falvini inzwischen Primat von Mons, Kanonikus verschiedener Kathedralen im Toskanischen, Prior in Montepulcio, der Abt verschiedener deutscher Monasterien, oberster Domherr sogar in spanischen Gebieten.
Papst Klemens VII. schätzte den gewandten, redebegabten Falvini als seinen contd’nuo commensale, seinen regelmäßigen Tischgenossen. Dem della Guarde und anderen Prälaten, die ebenfalls als papabile galten, war Falvini ein Dorn im Auge. Ein verteufelt festsitzender, schmerzhafter Dorn.
Erfrischt durch solche Gedanken über die eigene Glorie strich Falvini sich eine verdächtig dunkle Locke aus der Stirn. Er griff nach seinem purpurgoldenen Weinbecher, in den der Juwelier in kunstvoller Weise erotische Jagdszenen graviert hatte.
Falvini fuhr mit der Zunge über das edle Metall des Bechers und die zart ziselierten Linien einer nackten Nymphe, der sich von hinten ein gewaltig bestückter Satyr näherte. Genüsslich nahm der Kardinal einen Schluck vom Malvasier und prostete seinem Spiegelbild zu. Trotz meiner 45 Jahre bin ich ein schöner Mann, schien sein zufriedenes Lächeln zu sagen, und das Spiegelbild gab ihm lächelnd Recht.
Kleinlich wäre ein jeder gewesen, der Falvini auf die deutlichen Anzeichen eines ausschweifenden Lebens, die steilen Stirnfalten etwa, den blau schimmernden Teint oder die Tatsache, dass die an sein Nachtbarett gewebten Locken nicht die seinen waren, hingewiesen hätte. Ein Mann, der in so viel Pracht und Herrlichkeit lebte, umgeben von golddurchwirkten Tapeten, kostbaren Teppichen, damastenen Fußschemeln, von zahllosen Dienern und köstlichster Kunst, hatte selbst für schön und ein Kunstwerk gehalten zu werden. Und niemandem aus dem Hofstaat des Kardinals stand es zu, etwas anderes zu denken, geschweige denn zum Ausdruck zu bringen.
Nachdem er die Musterung seines Gesichtes abgeschlossen hatte, wurde der Kardinal ungeduldig. Unwillig wandte er sich zur Tür, wo blieb Almansor? Der Schröpfkopf saugte sich immer fester in seine Haut und verursachte ihm Schmerzen. Endlich öffneten sich die schweren Flügeltüren. Doch es war nicht der Sarasin.
Mit den abebbenden Geräuschen der Festlichkeit drang der verkehrte Edelmann mit der Pfauenmaske in das Privatgemach des Kardinals ein. Almansor, der zu gleicher Zeit die Tür erreichte, versuchte Rodiconda zurückzuhalten, doch sie stieß seinen muskulösen Arm von sich und zischte nur »stupido«.
Verärgert richtete der Kardinal sich in seinem Sessel auf. »Wer wagt es?«
»Ich, mein Herr«, rief die Kurtisane forsch, »ich bin gekommen, um mich nach Eurem Befinden zu erkundigen und Euch zu erfreuen.«
Falvini gab dem Sarasin ein Zeichen, sich zurückzuziehen, während Rodiconda mit elastischen Schritten den Saal durchmaß und die Pfauenmaske von ihrem Gesicht riss. Wirr legten sich nun ihre tizianfarbenen Locken um das bleiche, stolze Gesicht, das alle Mächtigen Roms zu Bewunderung hinriss. Freilich waren ihre dunklen, von goldenen Punkten durchsprenkelten Augen ein wenig eng gestellt, ihr Mund ein wenig breit, doch beides zusammen ergab ein apartes raubkatzenähnliches Antlitz, dem sie den Beinamen La Luparella – die Wölfin – verdankte.
»Was willst du, ich habe nicht nach dir gerufen«, herrschte der Kardinal sie nun an und mühte sich selbst, den Schröpfkopf von seinem Arm zu reißen, da er ihn in seiner Bewegungsfreiheit hinderte.
Rodiconda knickste vor dem Würdenträger, doch ein Anflug von Spott in ihrem schönen Wolfsgesicht war unverkennbar. Wie sollte sie auch ernsthaft dem Mann Reverenz erweisen, der im Bett all seine Keuschheit ablegte und die wildesten Liebesspiele von ihr verlangte, den sie bereits in den Nacken und die Lenden gebissen hatte, der sich nach den schmerzhaften Liebkosungen ihrer lang gewachsenen Fingernägel verzehrte.
»Eminenz, verzeiht mein spätes Eindringen oder soll ich sagen mein frühes, denn die erste Morgenröte überglänzt bereits das Kapitol und ...«
»Lass diese Possen«, befahl ihr Falvini, »du hast mich verärgert mit deinem Schelmenstreich. Wie konntest du es wagen, den köstlichen Toten mit deinem Kuss zu entweihen? Geh mir aus den Augen, bevor ich mir eine Strafe für dich überlege.«
Rodiconda spielte die Entsetzte und wich zurück. »Monsignore, Euer Herrlichkeit, wie könnt Ihr davon reden, Eure treueste Dienerin zu strafen, die Euch mit Seele und Leib verfallen ist. Es sei denn, meine Bestrafung bereitet Euch Lust, dann willige ich gern in eine genauere Inquisition ein.«
Bei den letzten Worten schlich sie wieder an ihn heran und öffnete mit einem Ruck ihr Wams. Sie ging in die Knie und bot dem Kardinal ihre entblößte Brust dar. Falvini, der zu lange in Gedanken an Mariettas weiche, sanfte Rundungen geschwelgt hatte, reizten die festen Äpfelchen der knabenhaften Rodiconda jedoch nicht.
»Bedecke dich, du machst dich lächerlich mit dieser Schamlosigkeit. Geh, geh nun.« Müde legte er seine rechte Hand über die Stirn. Rodiconda blieb unverschämt, schloss ihr Wams nicht, sondern rutschte auf Knien näher an Falvini heran. Ihre langen weißen Finger berührten seinen dunkelroten Rock und stahlen sich unter dem Saum nach oben. Als der Kardinal sie wegstoßen wollte, krallte sie ihre Nägel in seine Schenkel. Falvini stöhnte halb vor Schmerz und halb vor Lust. Noch immer, fast gegen seinen Willen, verstand es die Rodiconda, seine Begierde zu entfachen.
»Ich wusste doch«, sagte sie triumphierend, »dass Ihr meine Dienste heute noch benötigt.« Sie liebkoste weiter die Schenkel des Mannes, er ließ sie gewähren. Ihr Männerkostüm hatte Rodiconda mit Bedacht und der Absicht gewählt, in ihm verbotene Lust zu wecken. Denn so sehr Falvini die frühen Liebesbezeugungen seines ersten Gönners verabscheut hatte, so sehr verbanden sich damit seine ersten Erfahrungen in der Lust. Die verkehrte Venus konnte zu manchen Gelegenheiten immer noch seine Begierde wecken. Wenn er die Heilige Messe feierte, war er nicht davor gefeit, lüstern an die vor ihm knienden Messdiener und ihre zarten Körper unter den Spitzenüberwürfen zu denken.
Vor sich selbst verzieh er diese verächtliche Schwäche mit Hinweisen auf die in der von ihm verehrten Antike gepflegte Knabenliebe. Selbst die größten Geister hatten sich der platonischen Lust nicht geschämt. Machiavelli nannte alle Kirchendiener verstockt, die in der Lust zwischen Männern ein Werk Satans sahen. Doch in der Wirklichkeit unterdrückte Falvini diese Begierde, wohl wissend, dass sie unerbittlich verfolgt wurde, und lebte sie allenfalls in Verkleidungsspielen mit Rodiconda aus.
Und so gab er auch diesmal – er rechnete es seiner Schwächung durch den hohen Blutverlust an – der als Mann maskierten Rodiconda nach. Die schob nun seinen seidenen Purpurrock nach oben und küsste den Kardinal zwischen den Schenkeln. Der rutschte tiefer in seinen Sessel, um sich den Freuden der Entgrenzung und der Sünde ungezügelter Fleischeslust hinzugeben. Weich und zärtlich ruhten die Lippen der Wölfin kurz auf seinem sich regenden Geschlecht.
So beschäftigt waren der Kardinal und seine Hure, dass sie nicht bemerkten, wie sich ein Türflügel zum Privatgemach kurz öffnete und der Sarasin sein Haupt durch den Spalt schob. Umsichtig schloss er die Türe sofort und bedeutete dem wartenden Leibarzt stumm, dass er sich noch ein wenig gedulden müsse. Atoli seufzte. »Er nimmt gewiss der Rodiconda die Beichte ab«, versuchte er zu scherzen, doch der stumme Almansor verzog keine Miene. Achselzuckend nahm der Arzt auf einem dreibeinigen Schemel Platz. »Dabei komme ich, um ihm eine Freudenbotschaft zu übermitteln«, brummte er.
Im studiėlo reflektierte ein Spiegel derweil das anregende, wenn auch trügerische Bild eines schlanken, jungen Edelmannes in grünem Samt, der vor dem hohen Würdenträger kauerte und seine Lockenmähne in dessen Schoß tauchte. Genüsslich betrachtete Falvini sich und seine kunstfertige Dienerin.
Sich ihr preiszugeben war eine Freude, die der dunklen, animalischen Seite seiner Seele entsprang.
Müdigkeit und Erschöpfung ließen den Kardinal hinübergleiten in die Wehrlosigkeit der Wollust. Rodiconda ließ ihre Zunge tanzen. Als sie ihren Mund öffnen wollte, um Falvinis Geschlecht ganz in sich aufzunehmen, stöhnte er gegen seinen Willen den Namen »Marietta.«
Rodiconda schnellte zurück, der Kardinal bemühte sich, seine Blößen zu bedecken, die nun plötzlich lächerlich nackt erschienen. Rodicondas Wangen waren rot überhaucht, eine Folge der vorausgegangenen Erregung. Doch nun färbten sie sich tiefrot vor Zorn. »Marietta«, spie sie ihrem mächtigen Liebhaber entgegen, als sei sie eine beleidigte Fürstin. »Ihr wagt es, den Namen Eurer schäbigen Milchhure in den Mund zu nehmen, während ich Euch liebkose?« Der Zorn ließ sie alle Furcht und jeden Respekt vergessen. »Oh, ich habe diese billige Dirne, diese Brunnenhure satt, die zu gering ist, meinen Hass zu verdienen. Aber ich sorge dafür, dass sie Euch nie mehr heimsucht, das schwöre ich.«
Der Kardinal hatte sich schnell von jedem Gefühl der Beschämung und mit einem herzhaften Ruck endlich auch von dem störenden Schröpfkopf an seinem Arm befreit. Er schleuderte ihn zu Boden, wo er zersprang und das Blut des Kardinals als kleinen, dunklen See hinterließ. Rodiconda kroch darauf zu und tauchte zwei Finger ihrer rechten Hand hinein. Sie malte damit ein Kreuz auf den Marmor. »Dies ist mein Zeichen. Ich werde Marietta töten und Euch opfern, mein Herr. Ganz nach Art der Wölfin. So wie es Euch gefällt, werde ich meine Klauen in ihre milchprallen Brüste schlagen, und ...«
Mit einem Sprung war Falvini bei Rodiconda, die immer noch auf dem Boden vor ihm hockte. Er holte aus und versetzte ihr eine schallende Ohrfeige, die auf ihren Wangen den Abdruck seines schweren Rings hinterließ. Rodiconda zuckte, verbiss sich aber die Tränen und funkelte den Kirchenfürsten unter halb geöffneten Lidern zornig an.
Der wandte sich voll Abscheu von ihr ab, ihn schwächte nun keine Wollust mehr. »Bedecke dich«, befahl er barsch und schritt in kalter Ruhe durch sein studiėlo, seine grimmige Miene brachte die Wölfin zum Schweigen. Sie wusste, dass sie ihre Spiele mit dem Kardinal nicht zu weit treiben durfte. Ihn reizten ihre Unabhängigkeit und ihre Verwegenheit nur bis zu einer gewissen Grenze, die er zu ziehen sich vorbehielt. Und obgleich sie selber zu den gefährlichsten Geschöpfen Roms gezählt wurde und den Ruf einer geschickten Giftmischerin trug, war ihr Können bedeutungslos gegen die Skrupellosigkeit eines gereizten Falvini.
»Du hast mich nun schon zum zweiten Mal in dieser Nacht auf das Niederträchtigste beleidigt. Ich war bereit, dir deinen Streich mit der Leiche zu verzeihen, denn meine Gäste schienen sich dabei zu amüsieren. Doch welcher Dämon haucht dich an, dass du es wagst, meine Person und damit mein Amt zu beleidigen? Du vergisst deine Stellung und dein Herkommen, Rodiconda. Was gilt es dir, wem ich meine Gedanken widme? Sei es eine Milchhure, wie du behauptest, oder das Heiligste.« Er hielt einen Wimpernschlag lang inne. Wie komme ich in Zusammenhang mit Marietta auf ›das Heiligste‹?, schoss es ihm blitzartig durch den Kopf. Doch in derselben Sekunde, setzte er seine Ansprache bereits fort.
»Du, Rodiconda, bist selbst ein schmutziges Kind der Gosse und verderbter als jede ehrliche puttana. Grausamer als eine Lucrezia oder die Messalina.«
Die Wölfin fasste bei diesen Worten wieder Mut. »Und eben das reizte Euch immer, Monsignore.« Mehr wagte sie nicht zu sagen. Sie sparte sich auch den Hinweis, dass der Kardinal ihr in seinen – sehr seltenen – schwachen Momenten gestanden hatte, selbst der Gosse zu entstammen. Eben diese gemeine Herkunft, so hatte die Wölfin stets geglaubt, verband sie beide tiefer als es gemeinhin zwischen Kurtisane und Gönner der Fall zu sein pflegte.
»Du irrst Rodiconda«, sagte nun der Kardinal, »mich reizt die Gosse nicht. Schmutz ist Schmutz, eine Hure eine Hure. Ich spucke darauf. Mich reizt allein die Fähigkeit eines Menschen, sich über sich selbst und seinen Stand zu erheben, den Funken jener Göttlichkeit in sich zu erkennen, die ihn zu Höherem bestimmt, wenn er sich nur entschließt.«
Der von der Theorie des freien Menschen begeisterte Humanist in ihm sprach diese Worte. Ein Erasmus von Rotterdam oder andere Gelehrte seines Zeitalters hätten ihm dafür gewiss höchstes Lob gezollt. Und ebenso gewiss hätte sein dem Mittelalter verhafteter Feind della Guarde ihn dafür auf die Streckbank der Inquisition geschnallt.
Rodiconda – weniger gewitzt und nicht auf gelehrte Dispute aus – verstand nur so viel, dass der Kardinal Marietta leidenschaftlich verteidigte.
Es war eine tödliche Beleidigung gegen sie, die stolze Wölfin, die so viele Bewerber um sich hätte scharen können wie es Kirchen in Rom gab. Und das waren immerhin mehr als dreihundert. Rodiconda mit ihrer schneeweißen Haut und ihrem Wolfsgesicht war so recht das Ideal ihrer in Zwiespältigkeit gefangenen Zeitgenossen, die ebenso fromm wie genusssüchtig, ebenso schöngeistig wie grausam sein konnten.
Sie verlegte sich nun darauf, den Kardinal in seinem Stolz zu verletzen. Sie kleidete den giftigen Pfeil in schmeichelnde Worte. »Euer Eminenz, wenn Ihr mich erzürnt seht, so doch nur, weil ich es nicht ertrage, Euch in den Augen der Welt gedemütigt zu sehen.« Sie hielt inne, Falvini antwortete nicht. »Wisst Ihr, was die Gassenjungen für ein Lied auf Euch singen?« Falvini zwang sich, nicht aufzusehen, und studierte aufmerksam den Schnitt auf seinem Oberarm, aus dem immer noch Blut hervorsickerte.
»Ich will Euch sagen, womit sie Euch beleidigen. Sie singen vom großen Falvini, der sich vierzig Jahre vom Blut der anderen nährte, um nun wie ein zahnloses Lamm die Milch einer schamlosen Hure zu trinken. Euer Hochwürden, Ihr wisst, wie gefährlich es ist, wenn das Volk die Kurialen nicht mehr fürchtet. Schon gar in unruhigen Zeiten wie diesen, da man sogar über den Papst lästert. Das Volk ist eine reißende Bestie, die man an die Kette der Furcht legen muss. Vernichtet Marietta, bevor sie Euch ins Unglück bringt.«
»Was soll mir das Volk«, bemerkte der Kardinal abfällig. »Würde ich auf das Gewäsch einiger armseliger Krämer etwas geben, wäre ich ein schlechter Regent und ein armseliger Kirchenmann.«
»Sind Eure Gitter auch wirklich fest genug, Eure Tore so ehrlich bewacht und Eure Dienerschaft so treu, dass Ihr das Volk nicht fürchten müsst?«
»Drohst du mir mit deinen Spionen in meinem Haus? Ich kenne sie, Rodiconda, genau wie ich dich kenne. Es ist mir ein Leichtes, sie für immer im Kerker verschwinden zu lassen. Es kommt mir sogar gelegen, denn einer muss ja schließlich den ehrwürdigen Montefiscone vergiftet haben. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht gar in deinem Auftrag?«
»Das wagt Ihr nicht«, kam es mit bebender Stimme von seiner Gespielin. »Ich habe diesen lächerlichen Mann nicht getötet, was hätte ich für einen Vorteil davon?«
»Du hast andere getötet, du liebst es als Spiel.«
»Unwichtige Weibsbilder, Euch zum Vergnügen.« Der Kardinal war seiner Gefährtin überdrüssig, es gefiel ihm nicht, so offen über die gemeinsamen Spiele zu sprechen, die ihren Reiz eben daraus bezogen hatten, dass sie in stummem Einvernehmen geschehen waren. Rodiconda war sein Werkzeug, nicht seine ebenbürtige Gefährtin.
»Ich befehle dir zu gehen, Rodiconda, und ich rate dir, mich nicht mehr aufzusuchen. In Zeiten wie diesen schätzt der Papst es nicht, wenn seine Purpurträger Umgang mit stadtbekannten Kurtisanen haben. Ich denke, er arbeitet zurzeit an einer entsprechenden Bulle, die auch dir das Leben erheblich erschweren könnte, wenn einer deiner Gönner dich anzeigt.
«Die Wölfin sprang auf, mit dieser Entlassung hatte sie nicht gerechnet. Sie vergaß allen Respekt, alle Ehrfurcht genau wie alle Furcht, denn nun ging es um ihre Stellung. Eine Stellung, die sie nicht gedachte aufzugeben. Sie hing mit Leidenschaft – wenn auch vielleicht nicht der eines zart verliebten Herzens – an dem Kardinal Falvini, dem ihr ebenbürtigen Seelenbruder.
»Ihr habt mir die Ehe zur linken Hand versprochen, Ihr wolltet mich als Konkubine in Euer Haus aufnehmen, und nun soll ich verschwinden wie eine einfache Hure?«, schrie sie heiser. »Ich, die Euch jeden Wunsch erfüllt hat, keinen Tag verstreichen ließ, um nicht eine neue Vergnügung für Euch zu ersinnen? So leicht lasse ich mich nicht hinauswerfen, ich ...«
»Du beträgst dich wie ein Fischweib, Rodiconda. Wo bleibt deine Bildung, dein Benehmen? Ich sagte dir schon einmal, ich schätze die Gosse nicht.« Der Kardinal schritt nun selbst zu der Flügeltür seines studiėlo, doch Rodiconda kam ihm zuvor. Sie warf sich mit dem Rücken gegen die Tür. »Ich warne Euch, Kardinal Falvini, Ihr seid mächtig, ja. Doch mächtiger und rasender kann der Zorn einer verletzten Frau sein. Mein Zorn.« Wieder holte Falvini zu einer Ohrfeige aus, doch diesmal fing Rodiconda seinen Arm mit stählernem Griff ab. Sie funkelte ihn zornig an, und für einen Moment erkannte der Kardinal noch einmal die große Wölfin in ihr, die ihn so gereizt und begehrlich darauf gemacht hatte, sie zu besitzen.
»Ich weiß viel von Euch, Kardinal Falvini. Vieles, was Euren Amtsbruder della Guarde interessieren könnte.«
Der Kardinal ließ seinen Arm sinken und lachte verächtlich. »Suche dir deine Freunde, wo immer es dir beliebt. Selbst wenn ein della Guarde Anklage gegen mich erhöbe, so fürchte ich nichts. Mag er ruhig ein Geschrei machen, von mir aus Zeugen kaufen, ich würde immer die doppelte Anzahl gegen ihn aufbringen. Und deine Aussage ist weniger Wert als der Dreck einer Flussgans, Hure.«
Bei diesen Überlegungen gewann das Gefühl seiner grenzenlosen Überlegenheit über den kurzen Anflug von Verunsicherung. Rodiconda hatte ihr Spiel für dieses Mal verloren. »Geh«, wiederholte der Kardinal nur barsch, zog an einem Glockenstrang und sofort stieß von außen der Sarasin die Flügeltür auf, riss La Luparella an einem Arm aus dem studiėlo und führte sie so unsanft, wie der Ton seines Herrn gewesen war, die Treppenflucht hinab.
»Ihr werdet bitter bereuen, was Ihr heute getan habt«, schrie höhnisch und schrill die gedemütigte Frau, »Ihr werdet es bitter bereuen, hört Ihr, mein Kardinal. Ich werde Eure madėnna di latte töten!«
Der Leibarzt räusperte sich laut und vernehmlich, so als wolle er das unziemliche Geschrei der abgeführten Hure übertönen. Falvini verzog keine Miene. Atoli orderte Eigelb und Rosmarin, rührte daraus eine Salbe und bestrich die Schröpfwunde des Kardinals damit. Der begann eine Befragung des Arztes über die Leiche Montefiscones, die man in den kühlen Weinkeller gebracht und neben dem jahrhundertealten Leichnam des jungen Römers aufgebahrt hatte, wo nun beide begannen, um die Wette zu faulen und sich bei aller Unterschiedlichkeit zu Lebzeiten im Tode einander anzugleichen.
»Habt Ihr den Toten untersucht, Signore?«, fragte Falvini mit angemessenem Respekt.
»O ja, ich habe ihm die Adern geritzt, sein Blut beschaut und sogar seinen Urin. Durch das Drücken der Blase konnte ich einige Tropfen einfangen.«
»Und?«
»Schlagfluss.«
»Schlagfluss?« Falvini schaute den gelehrten Mann zweifelnd an.
»Ja, kein Zweifel«, bestätigte Atoli gelassen.
»Es ist nicht die Pest?« Der Arzt schüttelte – bedauernd – sein Haupt.
»Nicht einmal die Pest?«, wiederholte Falvini ungläubig und beinahe ein wenig enttäuscht. Dann fragte er. »Das, das könntet Ihr beeiden?«
Der Mediziner ließ sein geschliffenes Vergrößerungsglas fallen, mit dem er einige Flohbisse im Nacken des Kardinals betrachtet hatte. »Weshalb beeiden? Ich wüsste nicht, warum der nur allzu natürliche Tod eines alten, ehrwürdigen und dickblütigen Kardinals ein geistliches oder weltliches Gericht interessieren sollte? Gott sei seiner Seele gnädig, aber sein Körper war schon lange überfällig. Ein Becher Wein zu viel, ein zu fetter Braten, sogar ein zu kalter Schluck Wasser oder der laueste ponentino, der über den Tiber weht, hätte den hohen Herrn dahinraffen können.«
»Aber sein verfärbtes Gesicht und die aufgedunsene Gestalt?«
»Oh, aber das ist nur allzu natürlich. Ipsa senectus morbus est.« Falvini schaute den Arzt fragend an. »Es heißt, das Alter selbst ist eine Krankheit. Seht, sein Blut war fast schwarz vor schlechter Galle, es staute sich in allen Adern, war blau wegen des Übermaßes zurückgehaltener vulkanischer Elemente. Der Mann war ein unterdrückter collerico. Es ist ein ganz typisches Bild. Ihr könnt mir vertrauen. Kein Arzt käme zu einem anderen Schluss.«
Der Kardinal konnte sein Glück kaum fassen! Der angesehenste Arzt Roms verschaffte ihm einen makellosen Freibrief. Einen, für den er nicht einmal hätte bezahlen müssen.
»Ich danke Euch für Eure Mühen, die Ihr zu so später, oder soll ich sagen so früher Stunde auf Euch genommen habt.« Er trat zu einem Fenster und betrachtete mit befriedigtem Lächeln die ersten Sonnenstrahlen, die sich durch die Läden stahlen.
»Und wegen des Salärs ...«, getraute sich der Arzt nun, die stille Versenkung des Mannes zu unterbrechen.
Der Kardinal wandte sich um und hob – wie erstaunt – die Augenbrauen. »O gewiss, natürlich werde ich die Messen für Euch lesen, und ich verspreche Euch überdies zwölf Paternoster.«
»Ja, ja, gewiss, und ich bin dankbar, dass eine hochgestellte Person wie Ihr so sehr um mein Seelenheil bemüht ist, jedoch ...« Seine Stimme überschlug sich bei diesem Vortrag und nahm einen schrillen, fast pfeifenden Ton an.
Falvini brachte ihn mit hochmütiger Miene zum Schweigen. »Geschätzter Atoli, die Gier ist eine der sieben Todsünden, und meiner Meinung nach eine der unbekömmlichsten. Ich möchte Euch nun bitten zu gehen, denn ich brauche meinen Schlaf.«
Der Arzt verneigte sich – weniger tief als er es sonst zu tun pflegte –, griff sein Kästlein und schritt um Würde und Atem bemüht auf die Flügeltür zu. Sein Rücken war hart gespannt vor Hass. Kaum hatte der Sarasin die Tür hinter ihm geschlossen, als der Kardinal in übermütiges Gelächter ausbrach.
»Was sagst du dazu, Almansor. Welch eine fruchtbare Nacht! Ich habe mir nicht weniger als zwei Feinde darin gemacht. Eine törichte Frau und einen weibischen Toren. Wenn es freilich stimmt, dass man die Ehre eines Mannes an dem Geist und dem Wert seiner Feinde bemessen kann, dann war es ein schlechtes Geschäft. Eine überhebliche Kurtisane, die mir droht, und ein lächerlicher Bartscherer, der mich hasst.« Wieder lachte er schallend. Almansors Miene blieb unbeweglich. Vielleicht ahnte der stumme Mohr, dass sein Herr sich zu früh und zu ausgelassen freute und dass er überdies einen Feind übersah. Den Kardinal della Guarde.