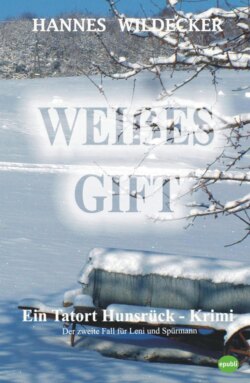Читать книгу Weißes Gift - Hannes Wildecker - Страница 14
7. Kapitel
ОглавлениеAuf der Dienststelle in Idar-Oberstein wurden wir am nächsten Morgen sofort von Werner Emmerich empfangen, der schon von weitem durch Achselzucken gebärdend mitteilte, dass wir überhaupt keinen Schritt weiter waren.
„Ich habe gestern noch mit Piefke gesprochen. Er hat uns nicht weitergeholfen. Ich glaube ihm, der weiß absolut nichts. Hat noch Glück gehabt, das arme Schwein, dass er nicht seine eigene Milch getrunken hat. Ich habe ihm noch ein Frühstück bringen lassen aber nun, glaube ich, sollten wir ihn laufen lassen.“
„Einverstanden“, stimmte ich ihm zu. „Aber er soll hinterlassen, wo wir ihn finden können. Oder besser noch: Er soll sich jeden Tag zu einer bestimmten Zeit auf der Dienststelle melden. Ich habe das Gefühl, das wäre auch für ihn das Beste.“
Emmerich wollte sich schon auf die Socken machen, als ich ihn zurück bat. Ich erzählte ihm von der Möglichkeit eines Verdachtes gegen Claus Schäfers aus Weilersberg. „Können Sie die Überprüfung durch Ihre Kollegen von hier aus veranlassen. Wir beide kommen heute beim besten Willen nicht dazu.“ Ich setzte ihn von unseren heutigen Plänen in Kenntnis.
„Ich werde mich darum kümmern. Übrigens: Ich heiße Werner“. Emmerich hielt mir seine Hand hin, die ich ergriff und drückte. „Ich bin Heiner. Danke für die hervorragende Unterstützung!“
„Und ich bin Leni?“ hörte ich meine Kollegin neben mir und sah, wie sie Emmerich ihre Hand entgegenstreckte.
„Und ich bin Susi!“ tönte es hinter uns und wie auf Kommando drehten wir uns um. Eine junge Lady, schlank, auffallend klein, wahrscheinlich die Mindestgröße für Polizeibeamtinnen, in dunkelblauer Jeans und einer kurzen Lederjacke mit hohem Kragen, besetzt mit silberfarbenen Nieten, stand vor uns.
„Ich gehöre doch dazu, oder?“
„Ich darf vorstellen: ‚Susi Quatro’, mit richtigem Namen Susanne Quarto“, informierte uns Emmerich über die Erscheinung in Leder.
„Dann wäre das Team ja wohl komplett.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Das waren die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Ermittlungen. Der harte Kern mit vier Personen besetzt und in der Hinterhand die Kolleginnen und Kollegen von Emmerich, die nur auf seine Anweisungen zu hören hatten, wenn es erforderlich würde.
„So, Leni, jetzt geht es mir besser. Auf zur Obduktion von Martin Scharlow ins Krankenhäuser – Klinikum. Bin froh, dass sich die Obduzenten für Idar-Oberstein entschieden haben. Normalerweise finden ja die Leichenöffnungen in Trier statt. Aber daran sieht man wieder, wie sich auch die Kleinstädte im Hunsrück mausern. Wir haben noch eine Stunde. Lust auf ein Käffchen?“
Und ob Leni Lust hatte, Wir suchten uns ein Bistro in der Nähe der Dr. Otmar Kohler - Straße, denn hier steht auch das Klinikum der Stadt. So konnten wir uns Zeit lassen und den Kaffee genießen.
Während ich an meinem Kaffee nippte, rührte Leni gedankenverloren in ihrer Tasse. Ich sah ihr dabei zu. Irgendetwas bedrückte sie. In den letzten Tagen hatte sie nicht so viel gesprochen, wie ich es von ihr gewohnt war. Auch ihre Lockerheit, ihre Sprüche, Ihr Dialekt, all das ließ sie vermissen. Doch ich wollte mich nicht aufdrängen. Wenn sie glaubte, mir etwas sagen zu müssen, würde sie es irgendwann tun.
„Hey, Leni“, versuchte ich ein lockeres Thema in Schwung zu bringen. „Was hältst du davon, wenn wir uns heute Abend gemeinsam im Hotel an der Bar eine Flasche Rotwein gönnen und all das hier für ein paar Stunden vergessen?“
„Dat mache mer“, ließ Leni ihrem Adenauer-Dialekt wieder einmal freien Lauf und lächelte, und ich hatte den Eindruck, dass die Welt für sie doch in Ordnung war.
Im Klinikum machten wir uns auf die Suche nach der Leichenhalle und dem Sezierraum. Der Pförtner beschrieb uns den Weg und nachdem wir uns ein paar Mal verlaufen hatten, erbarmte sich ein Pfleger und begleitete uns zu einem Trakt, der für den Normalbesucher gesperrt war. „Zutritt verboten“ stand es da in großen Lettern und wir marschierten durch die milchgläserne Doppeltür.
Am Ende des Ganges hörten wir Stimmen und gingen darauf zu. Es war tatsächlich der Sezierraum und ich traute meinen Augen kaum. Hier machten sich gerade zwei alte Bekannte bereit, ihr grausiges Werk zu verrichten, Pathologe Dr. Theodor Schneider und sein Gehilfe Wladimir Kornsack.
„Hallo, die Herrschaften, so sieht man sich wieder“, grüßte Schneider und Kornsack, der sich an Messern, Skalpells und sonstigen Utensilien zu schaffen machte, sah uns von der Seite an und nickte zum Gruße. Er hatte sich nicht verändert. Sein rechtes Augenlid hatte große Probleme, offen zu bleiben und klappte ständig nach unten. Kornsack schien keinerlei Gewalt darüber zu haben und je aufgeregter er war, desto mehr trat dieses Augenlid in Aktion.
Leni hatte sich beim ersten Treffen noch errötend weggedreht, da sie eine Anzüglichkeit in dem ständigen Augenzwinkern vermutete. Inzwischen legte sich nur noch ein fast unmerkliches Schmunzeln um ihre Lippen.
Auf dem Seziertisch lag bereits die Leiche von Martin Scharlow, nackt, wie Gott ihn schuf. Das Leben, das er in den vergangenen Jahren geführt hatte, sah man seinem Körper an. Mager, fleckig, an vielen Stellen mit Schorf behaftet, eine Folge der mangelnden Hygiene.
Scharlow war erst Fünfundfünfzig. Doch sein Körper sah aus, als ginge er auf die Siebzig zu. Was mochte dieser Mensch in seinem Leben schon alles durchgemacht haben? Als Landstreicher kommt man nicht zur Welt. Meist verbarg sich hinter diesen unbekannten Personen eine geordnete Vergangenheit. Ich war gespannt auf die Ergebnisse der Ermittlungen zu seiner Person. Die war zwar festgestellt, aber die Suche nach Angehörigen und die Kontaktaufnahme zu den zuständigen Dienststellen liefen immer noch.
Die Obduktion verlief, wie immer, nach einem routinierten Schema, an das man sich als Betrachter oder Beiwohner der Szenerie mit der Zeit immer mehr gewöhnte. Am Schlimmsten ist das erste Mal.
Ich erinnere mich, dass ich nach meiner ersten Anwesenheit bei einer Sektion, und es war nicht einmal eine von der Art, die einem Mund und Nase verschlossen, über eine Woche lang kein Fleisch auf dem Mittagstisch mehr sehen konnte, geschweige denn welches zu mir nehmen.
Dabei ist es nicht der Anblick des Toten, es ist vielmehr die routinierte und deshalb kaltschnäuzige Arbeit der Obduzenten am Körper desselben. Der sich beim Öffnen der Leiche verbreitende Geruch, wenn er auch oftmals nur geringe Verwesungsmerkmale mit sich bringt, bewirkt ein Zurückweichen auf Distanz.
Durch Mark und Bein geht der in einer extrem hohen Frequenz verlaufende Sägeschnitt, der die Schädeldecke vom restlichen Kopf trennt. Das Entnehmen der Organe, ihr Lösen vom Körper und das Zerschneiden in Streifen, um Proben für das Labor vorzubereiten, lässt den Anwesenden über das eigene Leben, über seine eigene Person nachdenken und ihn Vorsätze fassen, die er außerhalb der Institution bereits wieder vergessen haben wird.
Bis ins Unerträgliche aber sind Obduktionen an Leichen, deren Tod längere Zeit zurückliegt. Insbesondere Wasserleichen, deren Auffinden oftmals erst nach vielen Wochen erfolgt, verbreiten immer noch den impertinenten Verwesungsgeruch des körpereigenen Eiweißes, der nach Verlassen der Wassertiefen verstärkt einsetzt.
Eine solche Obduktion hatten wir ja noch vor uns. Der Tote im Stausee Talbrück, der inzwischen von den Kollegen unter Leitung des Kollegen Werner Emmerich geborgen worden und dessen Leiche nun sichergestellt war, würde in dieser Woche wahrscheinlich auf demselben Seziertisch liegen wie Scharlow, doch die Situation für die Anwesenden würde eine völlig andere sein.
Doch es gibt noch eine Steigerung in der Skala der Wertungen von Obduktionen und dabei ist dies die Traurigste. Die Zahl der Kindesmisshandlungen steigt kontinuierlich und mit ihr auch die Zahl der resultierenden Todesfälle.
Aber auch im Straßenverkehr, bei Wohnungsbränden und in vielen anderen Bereichen sind Kinder die Leidtragenden. Ein solch kleines Wesen auf dem Seziertisch lässt in fast allen Fällen die Beteiligten mit den Tränen kämpfen und es ist ein Ereignis, das man Wochen lang in sich nachträgt.
Ein Stoß in die Rippen riss mich aus meinen Gedanken. Es war Leni.
„Sag, Heiner, schläfst du? Es geht los!“
Es ging los wie bei jeder Obduktion. Abheben der Schädeldecke, Entfernen des Gehirns, um dasselbe in Streifen zu schneiden, Öffnen des Brustraumes, Lösen der Organe und Entnahme der entsprechenden Proben für das Labor. Leni traute sich heute in die Nahdistanz und fotografierte, was das Zeug hielt. Ab und zu, wenn sie sich zu nahe an die aufgeschnittene Leiche traute, hatte ich den Eindruck, sie liefe gegen eine Wand, die sie ein paar Zentimeter zurückwarf. Aber sie hielt sich tapfer, das musste ich eingestehen. Leni war in allen Belangen eine vollwertige Kollegin geworden.
Das Wichtigste bei dieser Sezierung war aus der Sicht unseres Falles der Mageninhalt von Scharlow.
Schneider zog einen Längsschnitt durch das Organ und betrachtete im Blitzlichtgewitter von Lenis Fotokamera dessen Inhalt und winkte mich schließlich heran.
„Kein Zweifel, die Todesursache ist ausschließlich auf ein Gift zurückzuführen“, begann Schneider zu referieren. „Sehen Sie, der Mageninhalt, der fast nur aus Flüssigkeit besteht, ist dunkelbraun gefärbt. Dann die Gelbfärbung der Haut, die Sie sicherlich schon bemerkt haben und die Antrocknung der inneren Organe.“
Schneider strich über Leber, Niere, Milz, besah sich Lunge und Bronchien und wandte sich zu mir.
„Der Mann ist innerlich erstickt. Doch seien Sie beruhigt, er hat nicht gelitten. Die Dosis ist offenbar so hoch, dass der Tod sofort eintrat.“
Schneider nahm die erforderlichen Proben von den Organen der Leiche, schöpfte einen Teil des Mageninhalts in ein Glas, verschraubte alle Behältnisse und nickte seinem Gehilfen Kornsack zu, der sich sofort darangab, die Leiche wieder in ihren Urzustand, soweit das noch möglich war, zu versetzen.
„Der Obduktionsbericht wird Ihnen zugehen, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind“, sagte Schneider und wusch sich derweil die Hände in dem Handwaschbecken und desinfizierte sie, wobei er sich alle Zeit der Welt ließ.
„Sie wissen, dass es für unsere Ermittlungen wichtig ist zu wissen, welche Beschaffenheit das Gift hat und wo sein Ursprung liegt. Wir müssen verhindern, dass weitere Lebensmittel damit in Berührung kommen. Wir müssen die Täter so schnell wie möglich ermitteln und dingfest machen.“
„Ich kann Ihre Eile verstehen. Aber, Herr Spürmann, Sie machen das hier doch nicht zum ersten Mal. Sie wissen doch, wie das läuft. Ich werde einen Zusatz für das Labor schreiben und ihnen die Dringlichkeit erklären. Mehr kann auch ich nicht tun. Eine Möglichkeit wäre ein Schnelltest, aber damit ist Ihnen auch nicht gedient, denn die präzise Substanz kann auch dieser Test nicht ermitteln.“
Schneider zog seinen Kittel aus und legte ihn in den dafür vorgesehenen Wäschekorb. „Ich werde mein Möglichstes tun, verlassen Sie sich darauf.“
Als ich mich mit Leni draußen, vor den Gemäuern der Krankenanstalt wiederfand, sog ich die frische Luft tief in mich ein. Es dämmerte bereits und in spätestens einer Stunde würde es dunkel sein.
Leni stand schweigend neben mir. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie während der gesamten Obduktion kaum gesprochen hatte. Ich sah sie von der Seite an und sah ihren Atem, der durch das hinter ihr scheinende Straßenlicht wie eine weiße Fahne bei jedem Atemzug aus ihrem Mund wehte.
„Alles o.k. Leni?“
„Alles o.k.“ Leni sah mich dabei nicht an, sondern drehte ihr Gesicht von mir weg und tat, als beobachte sie das Treiben vor dem Krankenhauseingang. Dort drängten sich -und diese Feststellung kann man jederzeit bei jedem Krankenhaus der Welt machen- eine Menge Krankenhausinsassen um einen riesigen Aschenbecher aus Eternit, gefüllt mit feinem Sand.
Ich wollte nicht wissen, wie viele von ihnen von ihren Ärzten ein absolutes Rauchverbot erhalten hatten, wie viele von ihnen gar Lungenkrebs oder eine andere Krankheit, vielleicht sogar als Folge des Rauchens, hatten. Ich sah die gelbliche Farbe in den Gesichtern, erblickte rauchende Rollstuhlfahrer und einen Mann, der seine Zigarette kaum bis zum Mund führen konnte, weil seine beiden Arme fest bandagiert waren. Eine dürre Frau mit unappetitlich wirkendem schwarzem, strähnig herabfallendem Haar, drückte das, was von der Zigarette noch übriggeblieben war, in dem riesigen Aschenbecher aus, begleitet von einem Hustenkonzert, das mir durch Mark und Bein ging.
Sollte ich diese Frau bedauern? Die Antwort war ein klares Nein, denn noch während sie mit ihrem Hustenanfall kämpfte, nestelte sie bereits eine frische Zigarette aus der Seitentasche ihres verwaschenen Morgenmantels und konnte mit zittrigen Händen kaum erwarten, den giftigen Smog einzuatmen.
Ich musste mich abwenden. Nicht aus Mitleid. Nein, ich konnte diesen selbst vernichtenden Unverstand einfach nicht mehr mit ansehen.
„Komm, Leni, auf ein Bier!“
Heute Abend gab es nichts mehr zu ermitteln. Zudem hatte ich das Gefühl, dass Leni etwas Abwechslung brauchte. Ich tippte auf Liebeskummer. Aber ich wollte nicht aufdringlich sein. Wenn Leni mir etwas mitteilen wollte, würde sie das von sich aus tun.