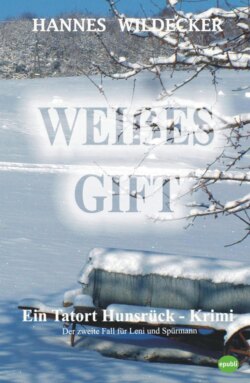Читать книгу Weißes Gift - Hannes Wildecker - Страница 7
Prolog
ОглавлениеDie prallen Plastiktüten mit der Aufschrift eines großen Lebensmittelkonzerns ziehen an beiden Armen von Manfred Piefke und das Gehen fällt ihm schwer. Es ist kurz vor Dunkelheitseinbruch und Müdigkeit macht sich in ihm breit. Seit sechs Uhr am Morgen ist er schon auf den Beinen, hat fast die gesamte Stadt durchkämmt nach brauchbaren Dingen und auf der Suche nach Seinesgleichen.
Langsam schwindet ihm die Kraft, denn eine richtige Mahlzeit hat er heute noch nicht zu sich genommen. Normalerweise steht er mittags an der Bahnhofsmission an, denn dort wartet auf ihn eine kräftige Suppe und manchmal auch ein Stück Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse. Doch heute war ihm der Weg zu weit bis zum Bahnhof. Am anderen Ende der Stadt hatte er Freunde getroffen. Freunde ist eigentlich der falsche Ausdruck, eher Leidensgenossen. Ja. Leidensgenossen, diese Bezeichnung gefällt ihm.
Wir haben alle dasselbe Leiden, denkt Piefke. Keine Wohnung, keine Angehörigen, kein Geld, kein Mitleid. Penner, wie man uns allerorten nennt. Ehrlose, Outlaws, Geduldete. Aber auch wir haben unser Schicksal hinter uns. Ist eigentlich falsch, denkt Piefke. Wir sind doch mitten in unserem Schicksal drin. Leben irgendwo, wo man uns lässt. Im Sommer unter Brücken, in den Grünanlagen der Krankenhäuser und im Winter in zerfallenen Häusern, die von den Eigentümern aus irgendwelchen Gründen aufgegeben wurden, oder um die man sich streitet, ob es Wert hätte, sie abzureißen oder wieder aufzubauen. Das ist eigentlich kein Leben, das ist Dahinvegetieren, denkt Piefke. Das Eigentum stets am Leibe mit sich rumschleppend, denn einmal etwas am Übernachtungsplatz liegen lassen ist die Aufgabe am Eigentum. Im Sommer trägst du deine Kleidung in Plastiktüten nach und im Winter gleichst du einer Zwiebel, denn alle kleidenden Besitztümer stapeln sich auf deinem Körper, auch in der kalten Jahreszeit nur eine Notlösung. Aber, was soll’s? Das ist unser Leben, das ist auch mein Leben. Und das bereits seit fast zwanzig Jahren, erinnert sich Piefke und Bilder aus vergangener Zeit tauchen erst milchig, dann immer klarer werdend, in seiner Vorstellung auf.
Der Weg in die Verwahrlosung bedarf nur eines kleinen Anstoßes, wenn der dazu führende Anlass schon so angewachsen ist, dass er reicht, um geregelte Bahnen zu verlassen.
Piefke erinnert sich ungern, doch manchmal kommen die Gedanken einfach und er kann sich ihrer nicht erwehren. Wie durch einen Schleier sieht er seine Frau in den Armen eines anderen, in seiner Wohnung, in seinem Schlafzimmer, in seinem Pyjama. Wie im Traum hört er ihre Stimme, die ihm sagt, dass es vorbei ist, dass er gehen soll, dass er seine Sachen packen kann.
Die Scheidung, die Ansprüche an ihn, die Kinder, die sich von ihren Eltern abgewendet hatten, brachten den kleinen Stein ins Rollen, der zu einem Felsen anwuchs. Kaum etwas blieb ihm am Monatsende von seinem Verdienten und seine Frau und ihr Liebhaber machten sich auf seine Kosten ein schönes Leben. Nicht mit mir! hatte er sich vorgenommen. Nicht mit mir!
Von einem Tag auf den anderen hatte er seine Arbeit aufgegeben, sein Ränzel gepackt und war auf und davon. Er hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Frau umzubringen. Doch die Vernunft hatte gesiegt. Bei ihm war nichts mehr zu holen und es überfiel ihn trotzt allem, oder gerade deswegen, eine wohlige Genugtuung. Von diesem Tag an hat er fast jeden Winkel in Deutschland durchkämmt, aber ein wirklicher Tippelbruder ist er nie geworden. Rastlos in der Welt umher zu wandern, das war und ist nicht sein Ding. Und so landete er schließlich im Hunsrück und ließ sich in Idar-Oberstein nieder. Was man so unter Niederlassen in seiner Situation verstehen mochte. Hier gefällt es mir, denkt er. Ein schöner Fleck zum Sterben, irgendwann, nicht schon jetzt. Die Winter, ja die Winter sind kalt hier. Doch, umso schöner sind die Sommer.
Piefke bleibt stehen. Er muss ausruhen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Im kommenden Jahr wird er sechzig. Das wird gefeiert, denkt er. Mit Rotwein, seinen Kumpeln und vielleicht in einem freundlicheren Haus als jenem, in dem er sich derzeit aufhält.
Piefke hat Hunger. Sein heute erbetteltes Geld hat er für eine Riesenflasche roten Landweins eingetauscht. Ein paar Münzen sind ihm geblieben. Am Supermarkt mit der Aufschrift „Gutkauf“ bleibt er stehen und zählt seine Barschaft. Dann geht er hinein und kauft sich einen Liter Milch im Tetra-Pack. „Hunsrück - Milch“ steht groß auf der Packung.
Ist vielleicht nahrhafter als ein oder zwei trockene Semmeln, denkt er und macht sich auf den Heimweg in die Rosengasse. Er schleppt sich die Stiege in dem muffig und nach Urin stinkenden Treppenhaus ins Obergeschoss, wo ein Teil seiner Kumpane schon ihr Nachtlager aufgeschlagen hat. Der über den Tag konsumierte Rotwein hat ihnen bereits jetzt schon die nötige Schläfrigkeit beschert und macht die aufkommende Herbstkälte etwas weniger merklich.
Bald wird es wieder Winter sein, denkt Piefke. Jetzt, Mitte November, sind die Temperaturen noch gut auszuhalten, aber im übernächsten Monat? Er will nicht darüber nachdenken. Wir sind Penner, wir leben jetzt, in den Tag hinein, nicht in die Zukunft. Zukunft, was ist das schon für einen wie mich? Zukunft, pah, die ist für mich Vergangenheit. Wenn ich es recht überlege: Eine Zukunft im Sinne von etwas erreichen, etwas darstellen, etwas sein, die hatte ich nie. Und die werde ich eben nie haben, denkt er, wieder ernüchtert die Gegenwart erkennend.
Piefke stellt seine Plastiktüten neben der Schlafstelle von Martin Scharlow ab. Zu ihm hat er einen engeren Kontakt als zu den anderen. Scharlow ist eine gutmütige Seele, nicht so verschlagen wie manche der anderen. Man kann ihnen deshalb keinen Vorwurf machen, denkt Piefke. Das Leben, das wir führen, hat sie so gemacht.
Scharlow ist noch wach. Er sieht Piefke zu, der seine Habseligkeiten ausbreitet und sein Nachtlager aufschlägt. Als Piefke den Tetra-Pack Milch auspackt, kommt Leben in ihn.
„Darf ich einen Schluck haben?“ fragt er, doch Piefke macht keine Anstalten, ihm etwas abzugeben.
„Ich habe hier noch eine Semmel. Ein Schluck von der Milch für diese Semmel.“
Piefke hat Hunger. Eine Semmel und dann noch ein halber Liter Milch, das würde ihn sättigen. Der nickt zur Bestätigung und Scharlow zeigt ihm das altbackene Mehlprodukt. Dann greift er zum Milchbehälter, dreht mit fahrigen Händen den Schraubverschluss auf, reißt die Dichtungsmembrane heraus und nimmt einen großen Schluck und noch einen.
„Ist genug“, sagt Piefke unwirsch und windet Scharlow das Milchgefäß aus der Hand. Der säuft mir noch alles weg, denkt er und schaut in die Runde. Soll mir ja nicht noch einer kommen, so geht das nicht. Das ist meine Milch. Und für den Teil, den Scharlow gesoffen hat, will ich sofort meine Semmel haben. Er dreht sich zu Scharlow um, doch der kümmert sich nicht mehr um ihn. „Das kann doch nicht wahr sein“, denkt Piefke und ertappt sich dabei, dass er es laut gesagt hat. „Trinkt mir meine Milch weg und legt sich zufrieden hin zum Schlafen.“
„He, Scharlow, so geht das aber nicht. Ich will meine Semmel.“ Er stößt Scharlow mit dem Fuß gegen dessen Allerwertesten, doch Scharlow rührt sich nicht.
Nicht mit mir, denkt Piefke und schüttelt den vermeintlich Schlafenden, der sich immer noch nicht rührt. Piefke wird stutzig. In der Dämmerung kann er das Gesicht von Scharlow nur schemenhaft erkennen. Mit zitternden Fingern nestelt er eine Kerze und Streichholz aus der Jackentasche.
Utensilien zum Feuermachen hat er immer dabei. Eine Kerze in einem kleinen Raum hat ihm schon des Öfteren, auch im Winter, die erforderliche Wärme geschenkt. Er zündet die Kerze an und hält sie vor das Gesicht von Scharlow. Der bewegt sich nicht, sondern sieht ihn nur mit großen Augen an. Piefke will erneut ansetzen und Scharlow mit Vorwürfen überhäufen, doch dann hält er ein. „Mein Gott, Scharlow!“ Vor ihm liegt ein Toter, das weiß er jetzt. Scharlow, sein Gefährte, liegt vor ihm, hat Schaum vor dem Mund. Es scheint, als grinse er ihn verzerrt an. Scharlow ist tot. Piefke kann keinen klaren Gedanken fassen. Eben noch war doch alles in Ordnung und jetzt!
Die Milch, kommt es ihm blitzartig in den Sinn. Es muss mit der Milch zusammenhängen! Wenn das so sein sollte, dann könnte ich jetzt auch so daliegen. Wenn ich als Erster getrunken hätte! Nicht auszudenken!
Piefke packt seine Sachen zusammen, schraubt den Gewindedeckel auf den Tetra-Pack und steckt ihn in seine Tragetasche. Einen Blick noch auf Scharlow, dann verlässt er, wie er gekommen ist, gebeugt von der Last, den Ort, der ihm immer unheimlicher wird. Die Polizei, denkt er. Ich muss zur Polizei. Man wird sonst denken, dass ich etwas damit zu tun habe. Scharlow, mein alter Kumpel! Warum lässt du mich alleine?