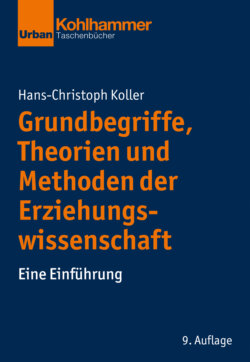Читать книгу Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft - Hans-Christoph Koller - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Zum Umgang mit diesem Buch
ОглавлениеIm Blick auf den Aufbau und die Darstellungsform ist diese Einführung durch drei Ziele geprägt. Wie bereits erwähnt, geht es erstens um eine Verbindung von Überblick und exemplarischer Vertiefung. Einen Überblick über die begrifflichen, theoretischen und methodischen Grundlagen der Erziehungswissenschaft vermittelt das Buch dadurch, dass es die drei Grundbegriffe Erziehung, Bildung und Sozialisation nicht nur jeweils in größere historische und theoretische Kontexte einzuordnen, sondern auch in ihrem systematischen Verhältnis zueinander darzustellen versucht. Die exemplarische Vertiefung ausgewählter Probleme wird dadurch erreicht, dass anstelle einer oberflächlichen Behandlung mehrerer Theorien pro Grundbegriff jeweils nur eine historische und ein bis zwei aktuelle Theorien ausgewählt und eingehender dargestellt bzw. diskutiert werden.
Ein zweites Anliegen gilt der Verknüpfung von sachlich-informierender Darstellung und kritischer Problematisierung der ausgewählten Theorien und methodischen Ansätze. Im Vordergrund steht dabei zunächst die Bemühung um eine verständliche und nachvollziehbare Darstellung der zum Teil komplexen Theoriezusammenhänge. Darüber hinaus werden die ausgewählten theoretischen und methodischen Konzeptionen nach der referierenden Darstellung jeweils kritisch auf ihre Reichweite und Grenzen hin untersucht. Dabei liegen jedem Kapitel ein bis zwei kürzere Originaltexte zugrunde, die auch für Studienanfänger verständlich sind und es den Leserinnen und Lesern erlauben sollen, den Gang der argumentativen Auseinandersetzung selbst anhand eigener begleitender Lektüre mitzuverfolgen.
Ein drittes Ziel dieses Buches besteht schließlich darin, die zu behandelnden Grundbegriffe und Theorien im Sinne der oben skizzierten Reflexionskompetenz in einen Bezug zu Handlungssituationen aus der pädagogischen Praxis zu setzen. Dabei geht es keineswegs darum, solche Handlungssituationen oder Praxisbeispiele nur zur Veranschaulichtung abstrakter theoretischer Zusammenhänge heranzuziehen und so dem theoretischen Wissen mehr oder weniger umstandslos unterzuordnen. Der Bezug von Begriffen und Theorien auf Beispiele aus der Erziehungswirklichkeit verfolgt vielmehr, wie oben erläutert, zwei einander ergänzende Ziele. Er soll es einerseits erlauben, die praktische Bedeutung theoretischer Ansätze zu verdeutlichen, die darin liegt, dass sie den jeweiligen »Fall« in einem neuen Licht erscheinen lassen und dabei bisher nicht genutzte pädagogische Handlungsmöglichkeiten erschließen. Auf der anderen Seite dienen die Beispiele jedoch auch dazu, das theoretische Wissen gleichsam auf die Probe zu stellen, seine Grenzen herauszuarbeiten und zumindest anzudeuten, in welcher Richtung dieses Wissen weiterentwickelt werden müsste.
Anstelle einer Vielzahl unterschiedlicher und schwer zu vergleichender Situationen aus der pädagogischen Praxis stützt sich die folgende Einführung durchgängig auf Beispiele aus einem zeitgenössischen literarischen Text, in dem Erziehungsfragen eine zentrale Rolle spielen. In dem 1998 erstmals erschienenen Roman About a boy erzählt der britische Autor Nick Hornby die Geschichte einer ungewöhnlichen Dreiecksbeziehung, die sich zwischen dem 12-jährigen Marcus, seiner alleinerziehenden Mutter Fiona und dem 36-jährigen überzeugten Single Will entspinnt. Bei diesem Roman handelt es sich zwar um einen fiktiven »Fall«, der aber eine Fülle anschaulich beschriebener Situationen enthält, die mit guten Gründen als Beispiele möglicher Erziehungswirklichkeit aufgefasst werden können. Hornbys Kunstgriff, abwechselnd jeweils ein Kapitel lang aus der Perspektive seines 12-jährigen Helden und aus der des erwachsenen Will zu erzählen, erlaubt es außerdem, die unterschiedlichen Sichtweisen der am Erziehungsgeschehen Beteiligten zu thematisieren. Die Beispiele aus dem Buch, auf die sich die Argumentation im Folgenden bezieht, werden jeweils ausführlich zitiert. Leserinnen und Lesern sei aber trotzdem die Lektüre von Hornbys Roman ans Herz gelegt. Abgesehen von dem damit verbundenen Lesevergnügen bietet die selbstständige Lektüre von About a boy nicht nur die Chance, die hier vorgelegten Interpretationen zu prüfen und mit eigenen Deutungen zu konfrontieren, sondern auch andere Passagen des Romans heranzuziehen, um sie aus der Perspektive der vorgestellten Theorien zu betrachten und dabei zugleich diese Theorien auf die Probe zu stellen.
Zuletzt bleibt mir noch, all denen, die zum Zustandekommen dieses Buches beigetragen haben, zu danken. Dazu gehören vor allem die Kolleginnen und Kollegen der Universität Hamburg, die an der Entwicklung und Erprobung des Rahmenkonzepts »Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft« im Rahmen des Kerncurriculums beteiligt waren (namentlich Stefan Aufenanger, Manfred Buth, Werner Friedrichs, Helga Gebert, Herbert Gudjons, Christine Mayer, Helmut Richter, Hans-Joachim Roth, Olaf Sanders und Michael Wimmer), sowie die Studierenden und Tutoren der Lehrveranstaltungen, aus denen dieses Buch hervorgegangen ist und die mich immer wieder dazu genötigt haben, meine Vorstellungen vom Kern eines erziehungswissenschaftlichen Studiums neu zu überdenken (insbesondere Sönke Ahrens, Dennis Blesinger, Frank Elster, Oliver Janoschka, Christoph Koenig, Oliver Liebenberg, Nadine Rose, Elke Rüpke und Christian Schomann). Wichtige Anregungen verdanke ich außerdem Jenny Lüders und Werner Friedrichs, die frühere Fassungen des Buches kritisch kommentiert haben, sowie Birgit Haustedt, die mich auf Hornbys Roman aufmerksam gemacht und die Entstehung des Buches in vielen Gesprächen begleitet hat. Ihnen allen – und denen, die ich möglicherweise vergessen habe – gilt mein herzlicher Dank.