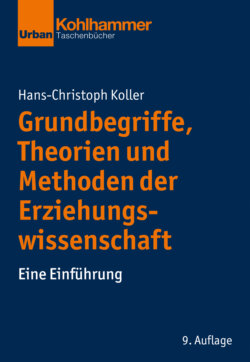Читать книгу Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft - Hans-Christoph Koller - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 »Weil ich möchte, daß du selbstständig denkst« – Analyse eines Beispiels
ОглавлениеKants unbestreitbares Verdienst besteht zunächst vor allem darin, dass er das pädagogische Problem der Verknüpfung zweier gegensätzlicher Erziehungsprinzipien, nämlich von Freiheit und Zwang, in aller Schärfe herausgearbeitet hat. Inwieweit seine Lösung des Problems, die in den eben skizzierten pädagogischen Regeln zur Einschränkung der Freiheit besteht, heute noch zu überzeugen vermag, steht auf einem anderen Blatt. Dass jedoch zumindest seine Problemformulierung noch immer als Theoriehintergrund für die Analyse und Reflexion pädagogischer Handlungssituation dienen kann, zeigt sich, wenn man eine zentrale Passage aus Hornbys Roman About a boy aus der Perspektive Kants betrachtet.
Bei dieser Passage handelt es sich um die Beschreibung eines Streitgesprächs zwischen Marcus und seiner Mutter Fiona, in dem es darum geht, dass Marcus – nachdem Fiona von seinen Besuchen bei Will erfahren hat – entgegen dem Willen seiner Mutter darauf besteht, Will weiterhin zu besuchen. Die Vorgeschichte dieses Streitgesprächs bildet ein früherer Disput über Marcus’ Besuche bei Will, in dem Fiona ihren Sohn aufgefordert hatte, ihr zu vertrauen – immerhin sei sie seit zwölf Jahren seine Mutter und wisse, was sie tue. Besonders ihr Satz »Ich denke mir etwas dabei« geht Marcus im Folgenden nicht mehr aus dem Kopf. Bisher war ihm die Erziehung seiner Mutter als etwas Selbstverständliches erschienen, sozusagen als »mechanische« Praxis im Sinne Kants. Doch nun kommt ihm zum ersten Mal der Gedanke, dass dem Verhalten seiner Mutter ihm gegenüber ein Plan – in Kants Worten also so etwas wie eine »judiziöse« Pädagogik – zugrunde liegen könnte. Und deshalb fragt sich Marcus, worin dieser Plan wohl besteht:
»In den nächsten paar Tagen begann er genauer darauf zu achten, wie Fiona mit ihm redete. Immer wenn sie davon sprach, was er sehen oder hören oder lesen oder essen konnte und sollte, wurde er neugierig: Gehörte das zum Plan, oder dachte sie es sich einfach je nach Bedarf aus? Es kam ihm nie in den Sinn, sie zu fragen, bis sie ihn in den Laden schickte, um Eier fürs Abendessen zu holen: Ihm ging auf, daß er nur Vegetarier war, weil sie es auch war.
›Wusstest du immer schon, dass ich Vegetarier werde?‹
Sie lachte. ›Natürlich. Das war keine plötzliche Schnapsidee, weil uns die Würstchen ausgegangen waren.‹
›Und findest du das fair?‹
›Wie meinst du das?‹
›Muss ich nicht das Recht haben, mich selbst zu entscheiden?‹
›Das kannst du, wenn du älter bist.‹
›Warum bin ich jetzt nicht alt genug?‹
›Weil du nicht selbst kochst. Ich will kein Fleisch kochen, also musst du essen, was ich esse.‹« (Hornby 2000, S. 142)
Marcus’ Versuch, herauszufinden, worin der Erziehungsplan seiner Mutter besteht, führt nicht zufällig auf die Frage der Ernährung, stellt diese doch einen Ort dar, an dem Eltern ihren Kindern in der Regel wie selbstverständlich ihre eigenen Essensgewohnheiten weitergeben. Ganz in Übereinstimmung mit Kants dritter Begründung für die Notwendigkeit von Zwang erklärt Fiona ihr Tun damit, dass Marcus noch nicht alt genug sei, um selbst zu kochen, und deshalb essen müsse, was auf den Tisch kommt. Dass Marcus von ihr gezwungen wird, sich vegetarisch zu ernähren, rechtfertigt sie also damit, dass er noch nicht selbstständig genug sei, um sich (wie es bei Kant hieß) »selbst zu erhalten«. Die Frage ist jedoch, ob in dieser gleichsam lebenspraktischen Begründung auch Kants entsprechende Regel beherzigt wird, wonach die Einschränkung der Freiheit nur im Interesse künftiger Freiheit gerechtfertigt sei. Marcus’ künftige Freiheit wird in der zitierten Passage von Fiona angesprochen, wenn diese darauf verweist, dass er erst dann das Recht haben werde, selbst zu entscheiden, wenn er älter sei. Auf den ersten Blick besteht dabei allerdings keinerlei Zusammenhang zwischen heutigem Zwang und künftiger Freiheit, trägt der Zwang doch in keiner Weise dazu bei, dass Marcus lernt, seine Freiheit zu gebrauchen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigt sich allerdings doch eine – wenn auch problematische – Verbindung. Mit sicherem Gespür hat Marcus nämlich eine Schwachstelle in der Argumentation seiner Mutter entdeckt:
»›Aber du lässt mich auch nicht zu McDonald’s gehen.‹
›Soll das eine vorgezogene Teenagerrebellion werden? Ich kann dich nicht daran hindern, zu McDonald’s zu gehen.‹
›Echt?‹
›Wie könnte ich das? Ich wäre bloß enttäuscht, wenn du hingingst.‹
Enttäuscht. Enttäuschung. So machte sie es. So machte sie viele Dinge.
›Warum?‹
›Ich dachte, du wärst aus Überzeugung Vegetarier.‹
›Bin ich ja.‹
›Na, dann kannst du nicht zu McDonald’s gehen, oder?‹
Sie hatte es schon wieder gemacht. Sie sagte ihm immer, er dürfe tun, was er wolle, und dann diskutierte sie mit ihm, bis das, was er wollte, wieder das war, was sie wollte. Das machte ihn langsam sauer.« (Hornby 2000, S. 142 f.)
Fionas bisherige Begründung für Marcus’ vegetarische Ernährung lässt sich nicht mehr aufrechterhalten, wenn es um den Besuch in einem Hamburger-Restaurant geht. Deshalb – und weil klar ist, dass die unmittelbare Ausübung von Zwang bei einem 12-jährigen zumindest außerhalb der eigenen Wohnung ihre Grenzen hat – bringt die Mutter nun etwas anderes ins Spiel: ihren Wunsch nämlich, dass Marcus nicht nur aus Zwang oder Gewohnheit Vegetarier sein möge, sondern »aus Überzeugung«. Wie Kant es fordert, setzt Fiona also darauf, dass ihr Kind in seinem Essverhalten Prinzipien folgen möge, »deren Billigkeit es selbst einsieht«. Der Zwang (oder vielleicht besser: der psychische Druck), den Fiona in punkto McDonald’s auf Marcus ausübt, wäre demzufolge darin begründet, dass die Mutter hofft, ihren Sohn auf diese Weise »zum Gebrauche seiner eigenen Freiheit« zu führen (wie es bei Kant hieß).
Problematisch daran ist freilich zum einen, dass Fiona dabei nur einen solchen Gebrauch der Freiheit im Sinn zu haben scheint, der ihren eigenen Vorstellungen entspricht – ein Umstand, der dem Prinzip der Freiheit ganz offensichtlich zuwiderläuft. Problematisch ist aber auch und vor allem, dass mit Fionas angedrohter »Enttäuschung« eine Dimension ins Spiel kommt, von der bei Kant noch gar keine Rede war: die emotionale Beziehung zwischen Erzieher(in) und Zu-Erziehendem. Der Zwang, den Fiona hier einsetzt und auf den Marcus besonders empfindlich reagiert, besteht nämlich keineswegs in körperlicher Gewalt oder einem expliziten Verbot, sondern vielmehr in einem subtilen psychischen Druck, dem sie ihren Sohn aussetzt, wenn sie ankündigt, sie wäre enttäuscht, wenn er zu McDonald’s ginge. Im Gespräch zwischen Mutter und Sohn geht es also offenbar nicht nur um bloße Einsicht, vernünftige Gründe oder die besseren Argumente, sondern auch um eine emotionale Beziehung, in der Gefühle und wechselseitige Erwartungen eine zentrale Rolle spielen. Und es scheint genau dieser psychische Druck zu sein, der Marcus »langsam sauer« werden lässt. Ihm wäre es lieber, wenn Streitfragen zwischen seiner Mutter und ihm klipp und klar entschieden würden:
»›Warum sagst du mir nicht einfach, was ich tun soll? Warum müssen wir immer darüber reden?‹
›Weil ich möchte, dass du selbstständig denkst.‹
›War das dein Plan?‹
›Welcher Plan?‹
›Als du neulich gesagt hast, du wüsstest, was du tust.‹
›Wobei?‹
›Beim Muttersein.‹
›Habe ich das gesagt?‹
›Ja.‹
›Oh. Okay. Nun, natürlich will ich, dass du selbstständig denkst. Das wollen alle Eltern.‹
›Aber es läuft immer darauf raus, dass wir diskutieren und ich verliere und dann tue, was du von mir willst. Die Zeit können wir uns sparen. Sag mir, was du mir nicht erlaubst, und den Rest sparst du dir.‹
›Wie sind wir überhaupt darauf gekommen?‹
›Ich habe selbstständig nachgedacht.‹
›Um so besser.‹
›Ich habe selbstständig nachgedacht, und ich möchte Will nach der Schule besuchen gehen.‹
›Diese Diskussion hast du schon verloren.‹
›Ich muss auch mal mit anderen Menschen zusammen sein als nur mit dir.‹
›Was ist mit Suzie?‹
›Sie ist wie du. Will ist nicht wie du.‹
›Nein, er ist ein Lügner und er arbeitet nicht, und …‹
›Er hat mir diese Turnschuhe gekauft.‹
›Ja. Er ist ein reicher Lügner, der nicht arbeitet.‹
›Er kennt sich aus mit der Schule und so. Er weiß alles Mögliche.‹
›Er weiß alles Mögliche! Marcus, der weiß nicht mal, dass er geboren ist!‹
›Siehst du, was ich meine?‹ Er wurde immer frustrierter. ›Ich denke selbstständig nach, und du … es funktioniert einfach nicht. Du gewinnst sowieso.‹
›Weil du keine überzeugenden Argumente hast. Es genügt nicht, selbstständig nachzudenken. Du musst es mir auch beweisen.‹
›Wie beweise ich es dir?‹
›Nenn mir einen guten Grund.‹
Er konnte ihr einen guten Grund nennen. Es wäre nicht der wahre Grund, und er sagte es nicht gerne und er war ziemlich sicher, dass sie anfangen würde zu weinen. Aber es war ein guter Grund, ein Grund, der sie zum Schweigen bringen würde, und wenn das nötig war, um in einer Diskussion zu überzeugen, würde er ihn vorbringen.
›Weil ich einen Vater brauche.‹
Er brachte sie zum Schweigen, und sie fing an zu weinen. Es erfüllte seinen Zweck.« (Hornby 2000, S. 144 f.)
Als zentrales Moment von Fionas »Plan« enthüllt sich hier ihr Wunsch, Marcus möge selbstständig denken (lernen). Deshalb, so scheint es, befiehlt sie ihm nicht einfach, was er tun soll, sondern besteht darauf, mit ihm zu diskutieren und dabei an seine Einsicht zu appellieren. Andererseits überlässt sie ihm auch nicht einfach die Entscheidung darüber, was er tun möchte, sondern zwingt ihn dazu, überzeugende Argumente für seine Wünsche vorzubringen. Aus Kants Perspektive könnte man sagen, dieser Zwang ziele darauf, Marcus zum selbstständigen Gebrauch seines Verstandes anzuhalten. Insofern ließe sich Fionas Zwang damit rechtfertigen, dass er im Interesse von Marcus’ künftiger Freiheit notwendig sei. Denn er dient dazu, Marcus in den Stand zu versetzen, künftig unabhängig von anderen Entscheidungen treffen zu können und nach »Maximen« zu handeln, von deren Richtigkeit er selber überzeugt ist.
Andererseits hat Marcus aber zu Recht den Eindruck, dass diese Rechnung nicht ganz aufgeht. Denn in der Diskussion mit seiner Mutter ist es offenbar sie, die die Macht besitzt, darüber zu entscheiden, ob ein Argument »überzeugend« ist oder nicht. Besonders offensichtlich ist das Ungleichgewicht zwischen Mutter und Sohn in Fionas Satz »Diese Diskussion hast du schon verloren«. Denn wie kann sie dies wissen, da sie Marcus’ Argumente doch noch gar nicht kennt? Insofern möchte man Marcus Einschätzung durchaus zustimmen, wenn er sagt: »[E]s funktioniert einfach nicht. Du gewinnst sowieso.« Dabei scheint Marcus zu spüren, dass es in dieser Diskussion entgegen der Darstellung seiner Mutter nicht nur auf überzeugende Argumente ankommt, sondern dass dabei noch etwas anderes im Spiel ist (wovon auch bei Kant keine Rede war), nämlich Macht – und zwar in einem doppelten Sinne. Macht spielt in diesem Streitgespräch zum einen eine Rolle als Herrschaft über die Spielregeln der Auseinandersetzung (welches Argument kann als überzeugend gelten?), zum andern aber auch im Sinne der Macht über die Gefühle des anderen.
Während die Herrschaft über die Spielregeln der Auseinandersetzung ganz in den Händen der Mutter zu liegen scheint, verhält es sich bei der Macht über die Gefühle anders. Zwar verrät Marcus’ innerer Stoßseufzer »Enttäuscht. Enttäuschung. So machte sie es. So machte sie viele Dinge« aus der zuvor zitierten Passage, dass er spürt, dass seine Mutter eine besondere Art von Macht über ihn hat, wenn sie sagt, sie könne ihn zwar nicht hindern, zu McDonald’s zu gehen, aber sie wäre enttäuscht, wenn er es täte (im Kern lässt sich dies nämlich als Drohung mit Liebesentzug deuten). Doch am Ende der Passage zeigt sich, dass umgekehrt auch Marcus eine Art von Macht über seine Mutter besitzt. Als er nämlich von Fiona aufgefordert wird, einen guten Grund dafür zu nennen, dass er weiterhin Will besuchen möchte, greift er auf ein Argument zurück, von dem er weiß, dass es seinen Zweck erfüllen wird, obwohl es gar nicht der »wahre Grund« ist. Das Argument »weil ich einen Vater brauche« erfüllt seinen Zweck insofern, als es Fiona nicht nur zum Schweigen, sondern auch zum Weinen bringt und Marcus damit einen Punktsieg in der Auseinandersetzung mit seiner Mutter verschafft.
Die Betrachtung der Passage aus About a boy zeigt, dass Kants Formulierung des Problems einer Verbindung von Freiheit und Zwang in der Erziehung auch heute durchaus noch geeignet ist, pädagogische Handlungssituationen theoretisch zu durchdringen. So kann man in der skizzierten Passage, wenn man sie aus der Perspektive Kants liest, durchaus Gründe für die Auffassung finden, dass Fionas Erziehung weniger unzulänglich ist, als es in den Kapiteln, die aus der Perspektive Wills geschrieben sind, gelegentlich erscheint. Denn immerhin gelingt es ihr, Marcus zum selbstständigen Denken zu veranlassen – was man von Wills »zivilisierender« Einführung seines Schützling in die Jugendkultur der 1990er Jahre nicht unbedingt sagen kann (so notwendig diese auch sein mag).
Auf der anderen Seite zeigte sich aber auch, dass Kants Erziehungstheorie Grenzen oder blinde Flecken hat, wenn es um die Analyse heutiger pädagogischer Problemsituationen geht. Die Analyse des Streitgesprächs zwischen Marcus und Fiona macht so darauf aufmerksam, dass eine Theorie der Erziehung über Kant hinaus auch die Frage der Machtverteilung zwischen Erziehern und Zöglingen thematisieren muss sowie die Rolle, die wechselseitige Gefühle in diesem Verhältnis spielen können.