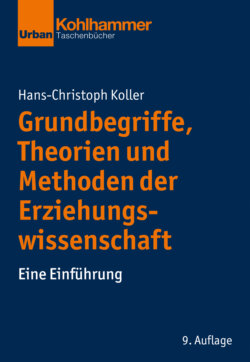Читать книгу Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft - Hans-Christoph Koller - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Kants Begriff von Erziehung
ОглавлениеAusgangspunkt von Kants Argumentation2 ist eine anthropologische Bestimmung von weit reichender Bedeutung: »Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muß.« (Kant 1803/1983, S. 697) Die Begründung dafür liegt Kant zufolge in der besonderen Ausstattung des Menschen im Unterschied zum Tier:
»Ein Tier ist schon alles durch seinen Instinkt; eine fremde Vernunft hat bereits alles für dasselbe besorgt. Der Mensch aber braucht eigene Vernunft. Er hat keinen Instinkt, und muß sich selbst den Plan seines Verhaltens machen. Weil er aber nicht sogleich im Stande ist, dieses zu tun, sondern roh auf die Welt kommt: so müssen es andere für ihn tun.« (Kant 1803/1983, S. 697)
Während das Verhalten der Tiere weitgehend durch Instinkte festgelegt ist, zeichnet sich der Mensch für Kant also durch eine größere Offenheit aus, die aber zugleich mit einer Art Hilflosigkeit verbunden ist und deshalb eine besondere Angewiesenheit auf andere mit sich bringt. Und eben dies, worauf der Mensch angesichts seiner Instinktarmut angewiesen ist, bezeichnet Kant nun als Erziehung. In diesem Sinne gehört für ihn Erzogenwerden zum Menschsein dazu:
»Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht.« (Kant 1803/1983, S. 699)
Betrachtet man diese Aussage näher, so handelt es sich um ein Paradox. Denn einerseits ist der Mensch für Kant offenbar zunächst noch gar nicht Mensch, sondern ein »nichts«, aus dem erst durch Erziehung ein Mensch wird. Auf der anderen Seite beginnt die Aussage mit »Der Mensch …«, und daraus folgt zwingend, dass der Mensch doch auch schon vor aller Erziehung auf irgendeine Art Mensch sein muss, denn sonst könnte er gar nicht als solcher identifiziert (und erzogen) werden. Zum Wesen des Menschen scheint für Kant also eine Art Noch-nicht zu gehören: Gerade insofern der Mensch Mensch ist, ist er es noch nicht, sondern muss durch Erziehung erst noch dazu werden.
Das Paradox lässt sich nur auflösen, wenn man das, was den Menschen als Menschen auszeichnet, als eine erst noch zu entfaltende Anlage begreift, als entwicklungsoffenes Potenzial, als Möglichkeit, zu deren Realisierung es eben einer besonderen Praxis namens Erziehung bedarf. Genau das tut Kant, wenn er schreibt: »Die Menschengattung soll die ganze Naturanlage der Menschheit, durch ihre eigne Bemühung, nach und nach von selbst herausbringen« (Kant 1803/1983, S. 697). Die »Menschheit« als Inbegriff dessen, was den Menschen als solchen ausmacht3, kommt ihm also zwar von Natur aus zu, aber doch nur als Anlage, die erst noch »heraus(zu)bringen«, zu entwickeln oder zu entfalten ist.
Daraus erwächst jedoch ein Problem: Wenn das, was den Menschen als Menschen ausmacht, noch nicht von Anfang an in ihm anzutreffen ist, sondern erst noch durch Erziehung hervorgebracht werden muss, woher kann man dann wissen, worin dieses Menschsein und damit das Ziel von Erziehung besteht? Die nahe liegende Antwort, man müsse nur ein bereits erzogenes Exemplar der Gattung Mensch betrachten, um zu sehen, wozu die noch nicht erzogenen Menschen gebracht werden sollen, scheidet für Kant deshalb aus, weil Erziehung selbst ein Werk von Menschen und deshalb notwendigerweise unvollkommen sei (vgl. Kant 1803/1983, S. 699).
Die von Kant zwar nicht ausdrücklich formulierte, in seinen Überlegungen aber implizit enthaltene Konsequenz dieses Gedankengangs besteht darin, dass das Ziel von Erziehung letztlich unbestimmt bleiben muss. Dem steht auch die Idee einer »Vervollkommnung der Menschheit« nicht entgegen, die Kant im nächsten Absatz ausführt:
»Vielleicht, dass die Erziehung immer besser werden, und daß jede folgende Generation einen Schritt näher tun wird zur Vervollkommnung der Menschheit; denn hinter der Edukation steckt das große Geheimnis der Vollkommenheit der menschlichen Natur. […] Es ist entzückend, sich vorzustellen, daß die menschliche Natur immer besser durch Erziehung werde entwickelt werden, und daß man diese in eine Form bringen kann, die der Menschheit angemessen ist. Dies eröffnet uns den Prospekt zu einem künftigen glücklichern Menschengeschlechte.« (Kant 1803/1983, S. 700)
Gerade weil das Ziel der Erziehung unbestimmt ist und die »Vollkommenheit der menschlichen Natur« ein »Geheimnis« bleiben muss, ist die »Vervollkommnung der Menschheit« als ein zukunftsoffener Prozess möglich und nötig. Dabei ist – trotz des »Vielleicht«, mit dem die zitierte Passage beginnt – unverkennbar, dass Kants Optimismus im Blick auf einen stetigen Fortschritt dieses Vervollkommnungsprozesses größer ist, als dies nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts angemessen erscheinen mag. Aber man muss diesen Fortschrittsoptimismus nicht teilen, um dennoch am Gedanken der Vervollkommnung festhalten zu können. Das wird deutlich, wenn Kant das Ziel des durch Erziehung zu bewirkenden Vervollkommnungsprozesses beschreibt:
»Es liegen viele Keime in der Menschheit, und nun ist es unsere Sache, die Naturanlagen proportionierlich zu entwickeln, und die Menschheit aus ihren Keimen zu entfalten, und zu machen, daß der Mensch seine Bestimmung erreiche. Die Tiere erfüllen diese von selbst, und ohne daß sie sie kennen. Der Mensch muß erst suchen, sie zu erreichen, dieses kann aber nicht geschehen, wenn er nicht einmal einen Begriff von seiner Bestimmung hat.« (Kant 1803/1983, S. 701)
In Übereinstimmung mit der oben skizzierten Auffassung des Menschseins als einer Möglichkeit, eines zukunftsoffenen Entwicklungspotenzials, wird hier das Ziel von Erziehung als proportionierliche, d. h. verhältnismäßige oder ausgewogene Entfaltung aller menschlichen »Keime« bzw. »Naturanlagen« beschrieben. Dabei ist es kein Widerspruch zur These, dass dieses Ziel unbestimmt sei, wenn hier von der »Bestimmung des Menschen« die Rede ist. Denn diese Bestimmung ist für Kant eben gerade keine Bestimmtheit, kein vorgezeichneter Weg, dem man unproblematisch folgen könnte, sondern vielmehr ein Weg, den es erst noch zu »suchen« gilt, ein unabgeschlossener und vielleicht nie ganz abzuschließender Prozess.
Worin besteht nun aber Erziehung als diejenige Tätigkeit, die den Menschen auf diesen Weg bringen soll? Die zuletzt zitierte Passage enthält zwei verschiedene metaphorische Formulierungen, die in der Geschichte des pädagogischen Denkens immer wieder benutzt worden sind, um das Geschäft der Erziehung bildlich zu veranschaulichen. Da ist zum einen Erziehung als ein herstellendes Machen (»es ist unsere Sache […], zu machen, daß der Mensch seine Bestimmung erreiche«), das sich mit dem Tun eines Handwerkers vergleichen lässt, der mit Hilfe angebbarer Mittel ein bestimmtes ›Produkt‹ hervorzubringen sucht. Dieser Auffassung von Erziehung steht in derselben Passage ein anderes Bild gegenüber, das Erziehung als ein beschützendes Wachsenlassen begreift (»die Menschheit aus ihren Keimen entfalten«). In dieser Perspektive ist Erziehung immer wieder mit der Tätigkeit eines Gärtners verglichen worden, der das natürliche Wachstum seiner Pflanzen behütend und pflegend begleitet. Während die eine Metapher das aktive, produktive Tun des Erziehers betont, hebt das andere Bild hervor, dass Erziehung es mit einem Geschehen zu tun hat, das eigenen, nicht beliebig steuerbaren Gesetzen folgt. Kant lässt offen, welche der beiden Metaphern ihm als geeigneter erscheint, und auch in der Geschichte der Pädagogik stehen beide Bilder bis heute in unentschiedener Konkurrenz zueinander.
Entscheidend für Kant jedoch ist, dass die Entwicklung der menschlichen Anlagen in keinem Fall von ganz alleine geschieht, sofern die Natur dem Menschen auch dazu keinen Instinkt verliehen hat. Deshalb ist Erziehung als diejenige Tätigkeit, die diese Entwicklung befördern soll, Kant zufolge eine »Kunst«, d. h. im Sprachgebrauch der Zeit etwas, was ein spezifisches Können erforderlich macht. Und diese Kunst soll nicht einfach »mechanisch« ausgeübt werden, d. h. planlos und nur den jeweiligen Umständen angepasst, sondern »judiziös« (Kant 1803/1983, S. 702), also planvoll und auf begründeten Urteilen beruhend (vom lateinischen judicare = urteilen). In dieser Formulierung klingt die Forderung nach einer wissenschaftlich begründeten Pädagogik an, die das Geschäft der Erziehung nicht dem gleichsam mechanischen Alltagshandeln überlässt, sondern zum Gegenstand gründlicher Reflexion und abwägenden Urteilens macht.
Einen wichtigen Grundsatz dieser Pädagogik bildet Kant zufolge nun die Zukunftsorientierung pädagogischen Handelns, von der bereits in der Einleitung dieses Buchs die Rede war:
»Ein Prinzip der Erziehungskunst, das besonders solche Männer, die Pläne zur Erziehung machen, vor Augen haben sollten, ist: Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglich bessern Zustande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee der Menschheit, und deren ganzer Bestimmung angemessen, erzogen werden. Dieses Prinzip ist von großer Wichtigkeit. Eltern erziehen gemeiniglich ihre Kinder nur so, daß sie in die gegenwärtige Welt, sei sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser erziehen, damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht werde.« (Kant 1803/1983, S. 704)
Die »Idee der Menschheit« als eines erst noch zu verwirklichenden Entwicklungspotenzials hat für Kant also zur Folge, dass Erziehung nicht nur und nicht einmal in erster Linie darin besteht, Kinder auf das Leben in der Welt vorzubereiten, wie es gegenwärtig ist. Erziehung im Sinne einer Unterstützung beim Finden der eigenen Bestimmung lässt sich vielmehr daran messen, inwiefern sie dazu beiträgt, eine Welt zu schaffen, wie sie sein könnte oder sollte – z. B. indem erzieherisches Handeln Heranwachsenden dazu verhilft, ihre gesellschaftlichen Lebensbedingungen nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern selbst aktiv zu gestalten und zu verändern.
Im weiteren Verlauf seiner Argumentation beschreibt Kant nun vier aufeinander aufbauende Stufen des Erziehungsprozesses, die er Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung nennt.4 Disziplinierung als die erste dieser Stufen bedeutet für Kant »suchen zu verhüten, daß die Tierheit nicht der Menschheit, in dem einzelnen sowohl, als gesellschaftlichen Menschen, zum Schaden gereiche« (Kant 1803/1983, S. 706). Die Vorbedingung einer Erziehung, die auf die »Vervollkommnung der Menschheit« abzielt, besteht also darin, dafür Sorge zu tragen, dass die tierische Natur des Menschen der »proportionierlichen« Entfaltung seiner spezifisch menschlichen Anlagen nicht im Wege steht. Wir können dieser Formulierung entnehmen, dass Kant nicht alle natürlichen Eigenschaften des Menschen gleichermaßen für wert befindet, entwickelt zu werden, weil einige, die dessen »Tierheit« ausmachen, die Entfaltung der anderen behindern könnten. Auch spätere für die Geschichte der Pädagogik bedeutsame Denker wie z. B. Sigmund Freud sind diesem Gedankengang gefolgt und sehen in der Beherrschung der eigenen (vor allem sexuellen und aggressiven) Triebe eine zentrale (wenn auch keineswegs unproblematische) Aufgabe der Erziehung (vgl. z. B. Freud 1933/1994, S. 575–579).
Die zweite Stufe des Erziehungsprozesses nennt Kant Kultivierung und versteht darunter die »Verschaffung der Geschicklichkeit«, d. h. desjenigen »Vermögens, welches zu allen beliebigen Zwecken zureichend ist« (Kant 1803/1983, S. 706). Auf dieser Stufe geht es also darum, dem Kind alle die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verschaffen, die notwendig sind, um irgendwelche »Zwecke« zu erreichen – ganz unabhängig davon, um welche Zwecke es sich dabei handelt. Kant spricht in diesem Zusammenhang auch von »Belehrung und Unterweisung« und nennt als Beispiele Lesen und Schreiben. Daraus erhellt, dass die »Geschicklichkeit«, um die es ihm zu tun ist, auch eine gesellschaftlich-historische Dimension hat, denn diese Fähigkeiten sind erst seit Durchsetzung der Schriftkultur einigermaßen unentbehrlich (während man heute wohl auch die Vermittlung der Fähigkeit, einen Computer zu bedienen, zur Kultivierung im Sinne Kants rechnen müsste).
Als dritte Stufe führt Kant die Zivilisierung an, die für ihn darin besteht, dafür zu sorgen, »daß der Mensch auch klug werde, in die menschliche Gesellschaft passe, daß er beliebt sei, und Einfluß habe« (Kant 1803/1983, S. 706). Während es bei der Kultivierung eher um sachbezogene Fähigkeiten geht, stehen bei der Zivilisierung soziale Kompetenzen und Haltungen im Vordergrund, die für das gesellschaftliche Zusammenleben erforderlich sind. Kant bezeichnet diese Kompetenzen daher auch als »Manieren, Artigkeit und eine gewisse Klugheit«, die man brauche, um im Umgang mit anderen Menschen eigene Zwecke zu verfolgen (ebd., S. 707). In diesem Zusammenhang verweist Kant selbst auf die historische Veränderlichkeit solcher Zivilisierung – sie richte sich »nach dem wandelbaren Geschmacke jedes Zeitalters«.
Insofern erscheint die Zivilisierung ähnlich wie die Kultivierung als moralisch neutral oder unter Umständen sogar fragwürdig. Deshalb bedarf es im Argumentationsgang von Kants Erziehungstheorie noch einer vierten Stufe, der Moralisierung:
»Der Mensch soll nicht bloß zu allerlei Zwecken geschickt sein, sondern auch die Gesinnung bekommen, daß er nur lauter gute Zwecke erwähle. Gute Zwecke sind diejenigen, die notwendigerweise von jedermann gebilligt werden; und die auch zu gleicher Zeit jedermanns Zwecke sein können.« (Kant 1803/1983, S. 707)
Es ist diese Stufe, die den entscheidenden Beitrag Kants zu einer modernen Theorie der Erziehung darstellt. Während Kant zufolge Disziplinierung, Kultivierung und Zivilisierung in der pädagogischen Praxis seiner Zeit bereits in ausreichendem Maß realisiert wurden, bleibt die Moralisierung seiner Ansicht nach ein noch unerreichtes Ziel. Anders als bisher geht es auf dieser Stufe nicht mehr um äußere Verhaltensweisen, Fähigkeiten und »Manieren«, sondern um das Innere des Menschen, seine »Gesinnung«. Und im Unterschied zu den beiden vorhergehenden Stufen sind dabei die Zwecke nicht beliebig, sondern werden einem moralischen Kriterium unterworfen: Sie sollen »gut« sein, d. h. von jedermann »gebilligt« und von jedermann gleichzeitig verfolgt werden können. Im Kern entspricht dieses Kriterium dem »kategorischen Imperativ«, den Kant an anderer Stelle folgendermaßen formuliert hat: »Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« (Kant 1788/1983, S. 140).
Dieses Ziel ist, wie Kant ausdrücklich betont, im Unterschied zur Disziplinierung (und in gewisser Weise auch zur Kultivierung und Zivilisierung) nicht durch bloße Dressur zu erreichen. Denn zu seiner Erreichung sei es notwendig, »daß Kinder denken lernen« und ihr Handeln statt an Verboten und Strafen oder bloßen Opportunitätsgesichtspunkten an begründungsfähigen »Prinzipien« ausrichten (Kant 1803/1983, S. 707). Das Beispiel, an dem Kant diesen Gedankengang zu verdeutlichen sucht, ist das »Laster«. Unendlich wichtig sei es, »die Kinder von Jugend auf das Laster verabscheuen zu lehren, nicht gerade allein aus dem Grunde, weil Gott es verboten hat, sondern weil es in sich selbst verabscheuungswürdig ist« (ebd.). Nicht das göttliche (oder elterliche) Verbot dient hier als Bezugspunkt und Instanz der Moralisierung, sondern die Einsicht in die Sache selbst, aus der für Kant die Verabscheuungswürdigkeit des Lasters unmittelbar hervorgeht.
Auch wenn man Kant darin zustimmt, dass der oben erwähnte kategorische Imperativ ausreiche, um zu begründen, warum ein bestimmtes Verhalten lasterhaft, d. h. unmoralisch und deshalb verabscheuenswert ist, bleibt die Frage, wie man Kinder dies »lehren« kann. Kants Antwort auf diese Frage findet sich an einer späteren Stelle der Vorlesung, an der er die Prinzipien, an denen das Handeln sich ausrichten soll, als »Maximen« bezeichnet und von bloßer »Disziplin« oder »Angewohnheit« abgrenzt. Maximen, so heißt es da, sind Prinzipien des Handelns, deren »Billigkeit« das Kind selbst einsehe (Kant 1803/1983, S. 740). Das Kind soll also die Angemessenheit der moralischen Prinzipien, an denen sein Handeln sich orientiert, selber erkennen. Die Instanz, auf die alles ankommt, ist mithin die Einsicht des Kindes, sein Urteil, das auf den selbstständigen Gebrauch des eigenen Verstandes zurückgeht.
Die entscheidende Frage innerhalb der Erziehungstheorie Kants lautet deshalb: Wie können Kinder zur Einsicht, d. h. zum selbstständigen Gebrauch ihres Verstandes gebracht werden? Kants Antwort ist eine doppelte: Es brauche dazu sowohl Zwang als auch Freiheit, und das entscheidende Problem bestehe darin, beides auf die richtige Weise miteinander zu verbinden. Kants berühmte Formel für dieses Problem, in der sich sein wichtigster und bedenkenswertester Beitrag zur Theorie der Erziehung verbirgt, lautet: »Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?« (Kant 1803/1983, S. 711).
Es lohnt sich, etwas länger bei dieser Formel zu verbleiben und dabei drei Fragen zu klären – nämlich erstens, was Kant unter »Freiheit« versteht, zweitens, weshalb diese Freiheit der Kultivierung (und d. h. der Bearbeitung und Verfeinerung) bedarf, und drittens, weshalb für Kant neben der Kultivierung von Freiheit auch die Ausübung von Zwang als ein unverzichtbarer Bestandteil von Erziehung gilt. Beginnen wir mit der ersten Frage. Freiheit ist für Kant zunächst die »Unabhängigkeit von Gesetzen«, nach welcher der Mensch ein natürliches Bedürfnis habe (Kant 1803/1983, S. 698). In diesem Sinne meint Freiheit das, was man Willkürfreiheit nennen kann: die Möglichkeit, dem eigenen Willen bzw. der eigenen »Laune« zu folgen (ebd.). Bei Kindern zeigt sich der Hang zu solcher Freiheit Kant zufolge in ihrer Tendenz, »jeden ihrer Einfälle würklich auch und augenblicklich in Ausführung [zu] bringen« (ebd.). Freiheit bedeutet im Kontext der Pädagogik-Vorlesung, wie im Folgenden noch deutlich werden wird, aber auch eine Art praktischer Selbstständigkeit, nämlich den Zustand, »nicht von der Vorsorge anderer ab[zu]hängen« (ebd., S. 711). Und schließlich gilt Freiheit Kant auch (wie bereits oben zitiert wurde) als die entscheidende Voraussetzung für Aufklärung, nämlich als Möglichkeit, »von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen« (Kant 1784/1983, S. 55) – und d. h. als Bedingung von Mündigkeit. Man kann daher annehmen, dass für Kant alle drei Arten von Freiheit – Willkürfreiheit, Selbstständigkeit und Mündigkeit – im Erziehungsprozess eine Rolle spielen und Gegenstand der Kultivierung werden sollen.
Was aber bedeutet dieses Kultivieren der Freiheit? Bei Kant heißt es direkt im Anschluss an die zitierte Formel: »Ich soll meinen Zögling gewöhnen, einen Zwang seiner Freiheit zu dulden, und soll ihn selbst zugleich anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen« (Kant 1803/1983, S. 711). »Kultivieren« ist also doppelt zu verstehen: Zum einen bezeichnet es negativ die Einschränkung von Freiheit (»einen Zwang seiner Freiheit zu dulden«), zum andern positiv eine Anleitung zum ›guten‹ Gebrauch der Freiheit. Die erste Bedeutung bezieht sich dabei wohl vor allem auf die Willkürfreiheit, die zweite auch auf Freiheit im Sinne von Selbstständigkeit und Mündigkeit.
Sofern das Kultivieren der Freiheit als Einschränkung zu begreifen ist, fällt die Frage nach dem Sinn dieser Kultivierung mit der Frage nach der Notwendigkeit von Zwang zusammen. Kants Vorlesung lassen sich drei verschiedene Gründe dafür entnehmen, warum Zwang nötig ist. Diesen drei Gründen entspricht jeweils eine Regel für das Handeln von Erziehern, die als Begrenzung erzieherischer Zwangsausübung verstanden werden kann. Die erste Begründung für die Notwendigkeit des Zwangs findet sich dort, wo von der so genannten ›positiven‹ Unterwürfigkeit des Kindes die Rede ist, die darin bestehe, dass der Zögling »tun muß, was ihm vorgeschrieben wird, weil er nicht selbst urteilen kann, und die bloße Fähigkeit der Nachahmung noch in ihm fortdauert« (Kant 1803/1983, S. 711). Zwang bzw. Unterwerfung ist für Kant also in dem Maße unvermeidlich, in dem das Kind nur über die Fähigkeit zur Nachahmung verfügt und noch nicht in der Lage ist, selbstständige Urteile zu treffen. Dem entspricht die (den Zwang limitierende) Regel, dass die Einschränkung der Freiheit dann (und nur dann) geboten ist, wenn das Kind sich andernfalls selbst Schaden zufügen würde. So fordert Kant, »daß man das Kind, von der ersten Kindheit an, in allen Stücken frei sein lasse (ausgenommen in den Dingen, wo es sich selbst schadet)« (ebd.).
Der zweite Grund entspricht dem, was Kant ›negative‹ Unterwürfigkeit nennt, die darauf beruhe, dass der Zögling »tun muß, was andere wollen, wenn er will, daß andere ihm wieder etwas zu Gefallen tun sollen« (Kant 1803/1983, S. 711). Hier liegt die Begründung für die Notwendigkeit des Zwangs in der Dialektik sozialer Beziehungen: Das Kind muss lernen, sich dem Willen eines anderen unterzuordnen, weil bzw. sofern es etwas von diesem anderen will. Daraus folgt als zweite Regel für pädagogisches Handeln, dass man einem Kind zeigen solle, »daß es seine Zwecke nicht anders erreichen könne, als nur dadurch, daß es andere ihre Zwecke auch erreichen lasse« (ebd.). Die Einschränkung der (Willkür-)Freiheit, so könnte man sagen, ist notwendig, sofern diese auf die Freiheit der anderen stößt und dort ihre Grenze findet.
Als dritte Begründung für den Zwang als unverzichtbares Erziehungsmittel führt Kant an, dass das Kind »den unvermeidlichen Widerstand der Gesellschaft fühlen« müsse, da es nur so die Schwierigkeit kennen lernen könne, »sich selbst zu erhalten, zu entbehren, und zu erwerben, um unabhängig zu sein« (Kant 1803/1983, S. 711). Zwang ist in diesem Sinne nötig im Interesse künftiger Selbstständigkeit, sofern diese nämlich Fähigkeiten voraussetzt, die nicht von selbst entstehen: die Fähigkeit, sich durch Arbeit bzw. Erwerbstätigkeit »selbst zu erhalten« und zu diesem Zweck auch Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Daraus ergibt sich als dritte pädagogische Regel, dass die Einschränkung der Freiheit nur in dem Maße gerechtfertigt ist, wie sie sich im Interesse künftiger Freiheit (im Sinne von Selbstständigkeit) als erforderlich erweist: Man müsse, so Kant, dem Kind »beweisen, daß man ihm einen Zwang auferlegt, der es zum Gebrauche seiner eigenen Freiheit führt, daß man es kultiviere, damit es einst frei sein könne« (ebd.).
Gewiss lassen diese Ausführungen Kants noch etlichen Spielraum für Interpretationen. So wäre z. B. in Bezug auf die letzte Bestimmung an konkreten Beispielen zu diskutieren (was gleich versucht werden soll), inwiefern die Ausübung von Zwang im Interesse künftiger Freiheit notwendig und gerechtfertigt ist. Dennoch bleibt festzuhalten, dass Kants Begründungen für die Notwendigkeit von Zwang und seine Regeln für pädagogisches Handeln primär als Begrenzungen erzieherischer Zwangsausübung zu verstehen sind. Anders formuliert: Abgesehen von den genannten Gründen und jenseits der gezogenen Grenzen ist den Zöglingen Kant zufolge völlige Freiheit einzuräumen. Die positive Dimension des ›Kultivierens‹, d. h. die Anleitung zum richtigen Gebrauch der Freiheit, hat also zur Voraussetzung, dass Kindern Freiheit gewährt wird.