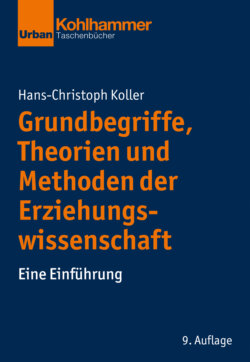Читать книгу Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft - Hans-Christoph Koller - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Das »pädagogische Jahrhundert«
ОглавлениеDas 18. Jahrhundert ist bereits von Zeitgenossen als das »pädagogische Jahrhundert« bezeichnet worden (vgl. Tenorth 2010, S. 79). Aus heutiger Sicht ist dies insofern einleuchtend, als sich in diesem Jahrhundert nicht nur neue (und in ihren Grundzügen bis heute wirksame) Auffassungen von Erziehung durchgesetzt haben, sondern auch wesentliche Momente der praktischen Organisation von Erziehung, ohne die unser heutiges Erziehungssystem nicht denkbar wäre.
Eine entscheidende Voraussetzung moderner Erziehungsvorstellungen ist das, was man die »Entdeckung der Kindheit« genannt hat. Wie der französische Historiker Philippe Ariès in seiner bahnbrechenden »Geschichte der Kindheit« gezeigt hat, gab es Kindheit als eine besondere, vom Erwachsenenalter abgegrenzte Lebensphase keineswegs schon immer. Die Auffassung, dass Kinder eine von den Erwachsenen deutlich geschiedene Altersgruppe bilden, ist Ariès zufolge vielmehr eine Errungenschaft der Neuzeit, die in Europa seit etwa 1500 allmählich aufkam und sich erst im 19. Jahrhundert in allen Bevölkerungsschichten endgültig durchgesetzt hat. Ein besonders eindrücklicher Beleg, den Ariès für diese These anführt, ist die Darstellung des kindlichen Körpers in der Bildenden Kunst. Während Kinder auf Bildern aus dem Mittelalter noch durchweg als verkleinerte Erwachsene dargestellt werden, entsteht erst ab etwa 1500 allmählich ein Blick für die Besonderheit kindlicher Körperproportionen (vgl. Ariès 1975/2007, S. 92ff.).
Im Zuge dieser Entdeckung der Kindheit als einer eigenen Lebensphase setzen sich Ariès zufolge nun auch besondere, pädagogische Formen des Umgangs mit Kindern durch. Während Kinder bisher vor allem durch die selbstverständliche Teilnahme am Leben der Erwachsenen in deren Welt hineinwuchsen, werden sie nun, wie Ariès an einer Fülle von Beispielen demonstriert, immer mehr aus dieser Welt ausgegrenzt, in eine Art Schonraum versetzt und einer Sonderbehandlung unterzogen, die man als »Erziehung« im modernen Sinne bezeichnen kann. Ein deutliches Indiz dieser Entwicklung ist etwa die auch von anderen Historikern beschriebene Entstehung der modernen (Klein-)Familie, die sich durch eine private, von der Außenwelt bzw. vom Arbeitsleben abgeschirmte und emotional aufgeladene Binnensphäre auszeichnet, in deren Mittelpunkt das Kind bzw. die Kinder stehen.
Parallel dazu etabliert sich in einem langen Prozess seit dem Mittelalter auch eine besondere Institution zur Vorbereitung der Kinder auf das Leben in der Gesellschaft: die Schule. Die paradoxe Struktur dieser Institution, die auf das Alltagsleben vorbereitet, indem sie die Kinder daraus ausgrenzt, beruht u. a. darauf, dass das Erwachsenenleben zu komplex, zu störungsanfällig oder zu gefährlich geworden ist, um Kinder das, was zur aktiven Teilnahme daran notwendig ist, wie früher einfach durch Partizipation und Nachahmung lernen zu lassen. Aus diesem Grund entsteht im Laufe der Zeit eine besondere, aus dem Alltagsleben ausgegliederte Institution, in der Kindern die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten systematisch vermittelt werden. Wie lange der Prozess der Durchsetzung dieser Institution gedauert hat, kann man daran ablesen, dass die allgemeine Schulpflicht in Preußen zwar schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts verkündet wurde, aber erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf breiter Ebene (d. h. vor allem auch für die Kinder der Unterschichten, die zuvor als Arbeitskräfte benötigt wurden) wirklich durchgesetzt werden konnte (vgl. Herrlitz, Hopf, Titze & Cloer 2005, S. 50f.).
Alle diese, hier nur grob skizzierten Tendenzen stehen im Zusammenhang mit einer weiteren, für die Geschichte der Pädagogik folgenreichen Entwicklung: der Etablierung eines pädagogischen Diskurses über Erziehungsfragen, die sich in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollzieht. Diese Entwicklung kommt nicht nur im sprunghaften Anstieg pädagogischer Veröffentlichungen und der Gründung eigener Zeitschriften zum Ausdruck, sondern auch darin, dass in diesem Zeitraum pädagogische Probleme, wie z. B. die Frage der Erziehung von Waisenkindern, zum Gegenstand öffentlich geführter Debatten werden. Ein weiteres Indiz der Etablierung des neuen Diskurses ist darin zu sehen, dass 1779 in Halle die erste Professur für Pädagogik an einer deutschen Universität eingerichtet wurde, während das Fach bis dahin als Teildisziplin der Philosophie gegolten hatte (vgl. Tenorth 2010, S. 108).
Als Teilbereich der Philosophie begegnet uns das Nachdenken über Fragen der Erziehung auch noch im Werk Kants, zu dessen Pflichten es als Philosophieprofessor an der Universität Königsberg gehörte, in regelmäßigen Abständen eine Vorlesung über Pädagogik zu halten. Doch das neue Interesse an Erziehungsfragen spiegelt sich darin, dass Kants Vorlesung in vielerlei Hinsicht über die frühere Behandlung des Themas hinausgeht und der Erziehung eine zentrale Stellung im aufklärerischen Denkgebäude zuweist. Worin nun besteht der spezifische Beitrag Kants zur theoretischen Fassung des Erziehungsbegriffs?