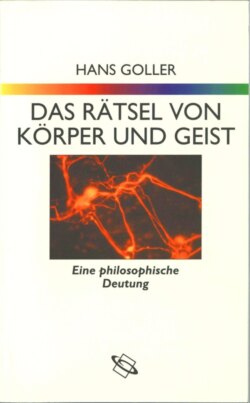Читать книгу Das Rätsel von Körper und Geist - Hans Goller - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Das bewusste Erleben, das Mentale
ОглавлениеDer Ausdruck ‘bewusstes Erleben’ meint alle inneren Prozesse und Zustände, die nur der Selbstbeobachtung direkt zugänglich sind. Man kann zwar Beispiele für bewusstes Erleben anführen, aber keine genaue Definition geben. Dabei steht vor allem die subjektive Qualität des Erlebens im Mittelpunkt des Interesses. Bewusstes Erleben reicht von lebhafter Farbwahrnehmung bis zum Erleben des schwächsten Hintergrundaromas, von stechenden Schmerzen bis zum Erleben eines Gedankens. Etwas hat Bewusstsein, wenn es sich auf irgendeine Weise anfühlt, dieses Etwas zu sein. Ein mentaler Zustand ist bewusst, wenn er eine bestimmte Erlebnisqualität besitzt. Das Problem, Bewusstsein erklären zu wollen, ist das Problem, Erlebnisqualitäten erklären zu wollen. Erlebnisqualitäten sind das schwierigste Problem in der Körper-Geist-Debatte (vgl. Chalmers, 1996 a, 4). Warum fühlt es sich auf eine spezifische Weise an, etwas zu sehen, etwas zu hören, etwas zu riechen, etwas zu tasten und etwas zu schmecken?
Der Ausdruck ‘Bewusstsein’ ist mehrdeutig. Er bezieht sich auf eine Reihe von Phänomenen: Wachheit, Aufmerksamkeit, Denken, Introspektion, willentliche Verhaltenskontrolle und Wissen über etwas. Für Chalmers ist Bewusstsein das bewusste Erleben, die subjektive Qualität des Erlebens. Bewusstsein zu haben bedeutet so viel wie Erlebnisqualitäten zu haben (vgl. Chalmers, 1996 a, 6). John Searle versteht unter Bewusstsein „diejenigen Zustände der Sinnesempfindung oder des Gewahrseins, die typischerweise einsetzen, wenn wir am Morgen aus einem traumlosen Schlaf erwachen, und die den ganzen Tag über da sind, bis wir wieder einschlafen. Bewusstsein kann auch anders als durch den Schlaf aussetzen: wenn man stirbt, in ein Koma fällt oder auf andere Art ‘bewusstlos’ wird“ (Searle, 2001, 54). Bewusstsein ist reich an Formen und Spielarten. Unser bewusstes Erleben ist enorm vielfältig. Folgende Beispiele illustrieren seine Mannigfaltigkeit:
„Denken wir beispielsweise daran, welche Unterschiede zwischen den folgenden Erlebnissen bestehen: eine Rose riechen, Wein schmecken, Schmerzen im Rücken haben, sich plötzlich an einen Herbsttag vor zehn Jahren erinnern, ein Buch lesen, über ein philosophisches Problem nachdenken, sich Sorgen wegen der Einkommenssteuer machen, mitten in der Nacht mit einer unbestimmten Unruhe wach werden, plötzlich darüber wütend werden, dass die anderen Fahrer auf der Autobahn so miserabel fahren, von sexueller Begierde überwältigt werden, angesichts exquisit zubereiteter Speise stechenden Hunger verspüren, woanders sein wollen und sich beim Schlangestehen langweilen“ (Searle, 2001, 55).
Diese Beispiele vermitteln nicht einmal ansatzweise einen vollständigen Eindruck davon, wie reich, bunt und vielfältig unser bewusstes Erleben tatsächlich ist. Solange wir wach sind und solange wir träumen, befinden wir uns in einem Bewusstseinszustand oder in mehreren Bewusstseinszuständen. Bewusstseinszustände umfassen die gesamte Vielfalt, die das Leben im Wachzustand hat. Dazu zählen folgende Erlebnisse (vgl. Chalmers, 1996 a, 6–11):
Visuelle Erlebnisse: Farbwahrnehmungen gelten als Paradebeispiele visuellen Erlebens. Manche Farben eignen sich besonders gut, unsere Aufmerksamkeit auf das Rätsel des Bewusstseins zu lenken. Warum fühlt sich das Blau des Herbsthimmels in den Dolomiten so an, wie es sich anfühlt? Warum fühlt sich die Wahrnehmung einzelner Farben je anders an? Ist es möglich, einem Blindgeborenen zu vermitteln, wie es sich anfühlt, Farben zu sehen? Andere Aspekte visueller Erlebnisse sind die Erfahrung der Form, der Größe, der Helle oder der Tiefe.
Akustische Erlebnisse: Töne sind irgendwie noch seltsamer als visuelle Vorstellungen. Die Struktur visueller Vorstellungen entspricht in der Regel der Struktur wahrgenommener Dinge, doch Töne scheinen davon unabhängig zu sein. Nichts am schrillen Ton eines Telefons entspricht direkt irgendeiner Struktur in der äußeren Welt, obwohl wir wissen, dass der Ton von einem Apparat kommt und durch eine Schallwelle bestimmter Frequenz und Amplitude ausgelöst wird. Warum führt eine Welle dieser Form, oder vielmehr, warum führen die Gehirnprozesse, die sie auslöst, gerade zu dieser speziellen Tonqualität? Das Musik-Erleben ist der vielfältigste Aspekt akustischer Erfahrungen. Musik kann uns völlig in ihren Bann ziehen.
Taktile Erlebnisse: Denken Sie an das Gefühl, das Sie haben, wenn Sie mit der Hand über Samt streichen, und vergleichen Sie es mit dem Gefühl, das sich einstellt, wenn Sie mit der Hand über kaltes Metall streichen. Taktile Erlebnisse können äußerst variantenreich sein.
Geruchserlebnisse: Denken Sie an den Duft gerösteter Kastanien, an den muffigen Geruch alter Kleider, an den Gestank von faulem Abfall, an den Duft einer frisch gemähten Wiese oder an den Duft frisch gebackenen Brotes. Der Geruchsinn ist einer der rätselhaftesten Sinne, der so genannte stumme Sinn, der Sinn ohne Worte. Warum führen bestimmte Moleküle gerade zu dieser Art von Empfindung?
Geschmackserlebnisse: Es gibt vier unabhängige Dimensionen von Geschmacksempfindungen: süß, sauer, bitter und salzig. Der Geschmackssinn verbindet sich mit dem Geruchsinn zu einer großen Palette möglicher Erlebnisse. Man denke zum Beispiel an den Geschmack reifer Melonen, gerösteter Kastanien oder an den Duft und Geschmack frisch vom Baum gepflückter Pfirsiche.
Schmerzerlebnisse: In der Philosophie des Geistes ist Schmerz das Paradebeispiel für bewusstes Erleben. Schmerzen bilden eine sehr auffällige Gruppe von Erlebnisqualitäten. Es gibt stechende, brennende oder pochende Schmerzen. Schmerzen scheinen noch subjektiver zu sein als die meisten Sinnesempfindungen.
Temperaturempfindungen: Ein heißer, schwüler Sommertag und ein frostiger Wintertag führen zu unterschiedlichen Erlebnisqualitäten. Man stelle sich die Hitzeempfindung vor beim Berühren einer Flamme oder die Heiß-Kalt-Empfindung, die man beim Kontakt mit ultrakaltem Eis hat.
Andere Körperempfindungen: Hunger, Durst, Jucken, Kitzel, Druck, Müdigkeit und die Erfahrung, die mit dem Bedürfnis zu urinieren einhergeht. Es gibt Erlebnisse, die mit der Propriozeption, der Eigenwahrnehmung, zusammenhängen, d. h. mit dem Gefühl, wo unser Körper sich im Raum befindet.
Vorstellungen: Wir kennen alle Erfahrungen, die nicht mit bestimmten Objekten in unserer Umgebung oder mit unserem Körper zusammenhängen, sondern die unserer Einbildungskraft entstammen. Wir können visuelle, akustische und taktile Vorstellungen sowie Geruchs- und Geschmacksvorstelllungen bilden.
Bewusste Gedanken: Manches, was wir denken und glauben, ist nicht mit einer bestimmten Erlebnisqualität verbunden, aber vieles schon. Es gibt das Gefühl, wie es ist, bestimmte Gedanken zu haben: zum Beispiel den Gedanken an einen sonnigen Wintertag, an den Petersdom in Rom oder an den Einsturz des World Trade Centers in New York. Auch Erinnerungen kommt eine bestimmte Gefühlsqualität zu.
Emotionen: Emotionen färben unsere bewussten Erlebnisse ein. Gefühle wie Freude, Trauer, Ärger, Wut, Überraschung, Scham und Ekel; Stimmungen wie Heiterkeit, Ängstlichkeit und Niedergeschlagenheit können das bewusste Erleben sehr stark prägen. Nach Izard (1999) sind Emotionen die grundlegendste Bezogenheit des Menschen auf Wirklichkeit. Sie geben dem Bewusstsein Kontinuität. Stärker als im Wissen, im Wollen oder im Handeln erlebt der Mensch sich in seinen Gefühlen als mit sich selbst identisch. Jeder Bewusstseinsinhalt ist durch Gefühle eingefärbt: Er ist angenehm oder unangenehm, interessant oder langweilig, erfreulich oder unerfreulich. Derselbe Sachverhalt erscheint anders, je nachdem, ob wir uns freuen oder ärgern, sanft oder zornig gestimmt sind. Ohne Gefühlsqualität wäre unser Wissen psychisch irrelevant, und unsere Welt wäre so kalt wie die Welt der Computer und intelligenten Maschinen. Nur in Ausnahmesituationen, wie in einer schweren Depression, kann es geschehen, dass ein Mensch völlig teilnahmslos seinen Mitmenschen und der Welt gegenübersteht.
Wünsche, Bedürfnisse, Triebe und Willensentschlüsse: Es fühlt sich auf eine bestimmte Weise an, motiviert zu sein, einen Entschluss gefasst zu haben, mit Energie und Konzentration ein Ziel zu verfolgen oder ablenkungsfrei bei einer Arbeit zu sein. Zustände des Getriebenseins sind mit einer anderen Erlebnisqualität verbunden als Zustände des Angezogenseins.
Selbst-Sinn: Wie entsteht das Gefühl, dass ich es bin, der etwas sieht, hört, riecht oder betastet? Es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise an, ich selbst zu sein. Dieses Gefühl ist privat und nur dem Besitzer des Organismus zugänglich. ‘Selbst-Sinn’ meint das Erleben, eine eigene Person zu sein, ein Selbst, ein Ich. Der Selbst-Sinn bildet die Grundlage für alle anderen Erfahrungen, Erlebnisse und Bewusstseinselemente.
Der Neurologe Antonio Damasio (1999, 5 f.) illustriert dies durch eine beeindruckende Begegnung mit einem seiner Patienten. Er berichtet von einem Mann, der „abwesend war, ohne fortgegangen zu sein“. Während er sich im Untersuchungszimmer mit ihm unterhielt, stoppte der Mann plötzlich mitten im Satz, sein Gesicht versteinerte sich, sein Mund blieb halb offen und seine Augen starrten ausdruckslos auf einen Punkt an der Wand. Einige Sekunden verharrte er regungslos. Damasio rief seinen Namen, aber der Mann gab keine Antwort. Dann rührte sich der Mann ein wenig, schmatzte mit den Lippen und bewegte seine Augen zum Tisch, der zwischen ihnen stand. Er schien die Tasse Kaffee und die kleine Metallvase mit Blumen zu sehen, die auf dem Tisch standen. Er muss sie gesehen haben, denn er nahm die Tasse und trank daraus. Damasio sprach ihn wiederholt an, doch er gab keine Antwort. Er berührte die Vase. Damasio fragte ihn, was los sei, aber er antwortete nicht. Sein Gesicht blieb ausdruckslos. Er sah Damasio nicht an. Plötzlich stand der Mann auf, drehte sich um und ging langsam zur Tür. Damasio stand auf und rief ihn mit seinem Namen. Der Mann blieb stehen, sah Damasio an, und in sein Gesicht kehrte allmählich das Leben zurück. Er sah verwirrt aus. Damasio sprach ihn nochmals an, und der Mann sagte: „Was?“
Für eine kurze Zeit, die wie eine Ewigkeit schien, litt dieser Mann an einer Beeinträchtigung des Bewusstseins. Aus neurologischer Sicht hatte er einen Absence-Anfall erlitten, gefolgt von einem Absence-Automatismus. Dieser Bewusstseinsausfall war nicht wie beim Einschlafen, er war viel radikaler, er war so etwas wie ein totaler Stromausfall. Das Erstaunlichste an dieser Bewusstseinsstörung war, dass der Mann nicht auf den Boden fiel wie in einem Koma. Er war auch nicht eingeschlafen. Er war zugleich da und nicht da. Er war wach und zum Teil aufmerksam. Körperlich war er zwar anwesend, persönlich aber unauffindbar. Er war weg, ohne fortgegangen zu sein.
Damasio meint, er sei bei dieser Begegnung Zeuge des messerscharfen Übergangs vom vollen Bewusstsein zu einem Bewusstsein, dem der Selbst-Sinn abhanden gekommen war, gewesen. Während das Bewusstsein des Mannes eingeschränkt war, blieben seine Wachheit und seine Fähigkeit, auf Objekte zu reagieren und sich im Raum zu bewegen, erhalten. Sein Selbst-Sinn und seine bewusste Aufmerksamkeit waren jedoch aufgehoben. Damals, so Damasio, begann er zu ahnen, dass der Selbst-Sinn ein unverzichtbarer Teil des Bewusstseins sein müsse. Konkrete Gestalt nahm diese Idee an, als er vergleichbare Fälle zu Gesicht bekam. Der Tragik dieser Fälle wäre er lieber aus dem Wege gegangen. Es gibt nämlich kaum etwas Traurigeres, als erleben zu müssen, wie ein Mensch plötzlich und unaufhaltsam das Selbstbewusstsein verliert, obwohl er am Leben bleibt. Nichts ist so belastend, wie den Familienangehörigen mitteilen zu müssen, dass dieser einmal empfindende und fühlende Mensch wahrscheinlich nie mehr das sein wird, was er einmal war.
Sinnesempfindungen, Körperempfindungen, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Gedanken, Reflexionen, Meinungen und Wissensinhalte bilden unser bewusstes Erleben. In der Philosophie hat es sich eingebürgert, für geistige und psychische Phänomene den Ausdruck ‘das Mentale’ zu verwenden (vgl. Brüntrup, 1996). Zu den mentalen Zuständen zählen einerseits Denkinhalte, Reflexionen, Meinungen und Wissensinhalte, andererseits qualitative Wahrnehmungen und Empfindungen. Für die qualitativen Bewusstseinszustände ist der Ausdruck ‘Qualia’ gebräuchlich. Qualia sind Erlebnisqualitäten wie beispielsweise der Anblick glänzender Schneeberge, die Klangqualität einer Panflöte, der Geruch gerösteter Mandeln, der Geschmack exotischer Früchte, die Schmerzhaftigkeit von Schmerzen, das Tasterlebnis der Glätte, das wir haben, wenn wir mit der Hand über eine glatte Fläche streichen, Gefühle wie Freude, Überraschung, Trauer, Ärger, Wut, Ekel, Scham, Furcht oder Verachtung. Erlebnisqualitäten besitzen einen ganz bestimmten phänomenalen Gehalt. Sie sind nicht einfach vorhanden wie Tische, Stühle oder Häuser, sondern es fühlt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise an, sie zu haben. Sie bestimmen für uns, wie es ist, ein Mensch zu sein. Sie sind auch ausschlaggebend dafür, dass wir uns als Urheber unseres Handelns erfahren. Qualia sind die Sorgenkinder der Bewusstseinsphilosophen. Im Folgenden wird der Ausdruck ‘Qualia’ synonym mit dem Ausdruck ‘Erlebnisqualitäten’ verwendet. Bewusstsein im eigentlichen Sinn besitzt ein Organismus dann, wenn es sich auf eine bestimmte Weise anfühlt, dieser Organismus zu sein. Ein mentaler Zustand ist bewusst, wenn er erlebt wird. Die Begriffe ‘phänomenales Bewusstsein’ und ‘Qualia’ bezeichnen diese bewussten Zustände. Es scheint natürlicher, von ‘bewusstem Erleben’ oder einfach von ‘Erleben’ zu sprechen (vgl. Chalmers, 1995, 1996 b).
Das bewusste Erleben umfasst nicht den gesamten Geist. Die Kognitionswissenschaften untersuchen mentale Zustände und kognitive Prozesse, insofern diese Ursachen des Verhaltens sind. Mentale Zustände können bewusst sein, müssen es aber nicht. Chalmers unterscheidet zwischen einem ‘phänomenalen’ und einem ‘psychologischen’ Begriff des Geistes (vgl. 1996 a, 11 f.). Der phänomenale Begriff des Geistes meint Geist als bewusstes Erleben. Der psychologische Begriff des Geistes hingegen meint Geist als Ursache des Verhaltens. Hier ist die Qualität des Bewusstseins nicht wichtig, sondern die kausale Rolle. Beide Aspekte, der phänomenale und der psychologische, sind real, decken aber verschiedene Bereiche ab. Ein spezifischer mentaler Begriff kann als phänomenaler, als psychologischer oder als beides analysiert werden. Dass ein mentaler Zustand eine kausale Rolle spielt, ist nicht rätselhaft. Rätselhaft ist, warum es sich auf eine bestimmte Weise anfühlt, in diesem Zustand zu sein. Das Psychologische und das Phänomenale erschöpfen gemeinsam das Mentale. Jede mentale Eigenschaft ist entweder eine phänomenale oder eine psychologische, oder eine Mischung aus beiden. Schmerz beinhaltet beide Aspekte, und es lässt sich darüber streiten, ob die phänomenale Qualität oder die kausale Rolle für Schmerz grundlegender ist. Beide Aspekte des Schmerzes treten in der Regel gemeinsam auf. Viele mentale Begriffe führen ein solches Doppelleben. Überzeugungen, Meinungen, Wünsche und Einstellungen haben sowohl einen psychologischen als auch einen phänomenalen Aspekt.