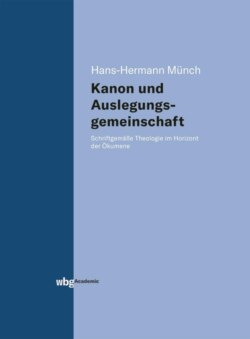Читать книгу Kanon und Auslegungsgemeinschaft - Hans-H. Münch - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Der Kanon und die innere Pluralität der Kirche
ОглавлениеIn seiner Studie Die Entstehung des Neuen Testaments als literaturgeschichtliches Problem legt Theißen zunächst dar, dass der Kanon des Neuen Testaments „Ausdruck einer religiösen Gemeinschaft vom Typus der Kirche“ sei, „die eine innere Pluralität toleriert und sich gleichzeitig von Gruppen mit allzu großer Spannung zur Welt (wie den Markioniten) abgrenzt […];“ das Neue Testament bilde ein Gegenmodell zum Kanon Markions: „Gegen ihn wurde die Pluralität der Evangelien, die Pluralität der Briefautoren und die Dualität von Altem und Neuen Testament zum Konsens. Markion hatte nur ein Evangelium, nur einen Apostel und nur das eine Neue Testament.“121 – Wiederum ist gegenüber Wrede und seiner Zeit ein wichtiger Erkenntnisfortschritt zu benennen: Seinem Vorwurf122, die Anerkennung des Kanons bedeute, sich der Autorität von Bischöfen und Theologen der Alten Kirche zu unterwerfen, setzt Theißen eine nüchterne Erkenntnis entgegen:
„Es hat nie einen formellen Beschluss über den Kanon gegeben. […]. Hier […] gibt es ein historisches Rätsel: Im 2. Jh., als sich die Grundlinien des Kanons abzeichneten, fehlte es an Institutionen mit der nötigen Macht, um die Kanonbildung in ihrem Interesse durchzusetzen. Dennoch entwickelte sich ein Konsens über Aufnahme und Nichtaufnahme vieler Schriften.“123
Mit Verweis auf den Kirchenvater Irenäus werden zwei inhaltliche Hauptkriterien für die (Nicht-) Aufnahme in den Kanon genannt:124
1. „Alle Schriften, welche die Einheit des Schöpfer- und Erlösergottes in Frage stellten und in dieser Welt das Werk eines stümperhaften und unwissenden Demiurgen sahen, hatten in den Gemeinden keine Chance, akzeptiert zu werden.“
2. Die „Realität der Inkarnation: Alle Schriften, die lehrten, dass der wahre Gott nicht wirklich in diese Welt eingegangen war und sich mit einem ganzen menschlichen Leben (materiell mit Fleisch und Blut, chronologisch von der Geburt bis zum Tod) verbunden hatte, hatten in den Gemeinden keine Chance.“
Theißen skizziert ausführlich eine fünffache „soziale Funktionalität“ des Kanons:125
1. „Konsensbildung: Der Kanon wurde gebildet, um der christlichen Bewegung eine normative Grundlage zu geben.“ – Dabei enthalte er gleichwohl Widersprüche, so etwa
- radikale ethische Forderungen in den synoptischen Evangelien und gemäßigten Konservativismus in den deuteropaulinischen Briefen;
- den irdischen Jesus in den synoptischen Evangelien und den unter den Menschen lebende Gott des Johannesevangeliums;
- die Orientierung am neu ausgelegten Gesetz des Alten Testaments im Matthäusevangelium und den Bruch mit dem Gesetz bei Paulus;
- das Zutrauen zur Veränderungsbereitschaft des Menschen bei Matthäus und Lukas und den anthropologischen Pessimismus bei Paulus.
Hierbei gelte insgesamt: „Trotz dieser inneren Mannigfaltigkeit war nirgendwo das Bekenntnis zur Realität der Inkarnation und zum Glauben an den einen und einzigen Gott strittig.“
2. „Orientierung in der Umwelt“: Der Kanon hatte nicht nur innerhalb der Gemeinden wichtige Bedeutung, er „war auch für die Außendarstellung und die Apologetik unersetzlich.“
3. „Identitätsdarstellung“: Der entstehende zweiteilige christliche Kanon signalisierte sowohl Verbindung mit als auch Trennung vom Judentum: „Die Christen fügten ihr Neues Testament dem Alten Testament in dem Bewusstsein hinzu, dass das Neue Testament geschichtlich dessen Erfüllung und hermeneutisch sein Schlüssel ist. Es wurde dem Alten Testament übergeordnet.“
4. „Konfliktregelung“: Die Pluralität der Positionen innerhalb des Kanons beschrieb gleichzeitig Grenzen der christlichen Identität; er „ließ eine große Variabilität von Überzeugungen zu, markierte aber auch Kriterien für abzulehnenden Überzeugungen“ – wie z.B. gnostische Positionen.
5. „Autoritätsbegründung“: Neben der Etablierung des kirchlichen Amtes und der Bildung erster Bekenntnisse nach Art der regula fidei wurde der Kanon „eine der wichtigsten autoritativen Stützen des Christentums,“ – und zwar nicht grundsätzlich im konservativen Sinn: „In ihm waren viele sperrige Lehren und Traditionen enthalten, die durch die Kanonisierung sakrosankt geworden waren und die in der Geschichte des Christentums immer wieder für Unruhe gesorgt haben.“
Insgesamt hält Theißen fest: „Schriften, welche die genannten fünf Funktionen erfüllen konnten, hatten eine weit größere Chance, kanonisiert zu werden, als andere. Dabei konnten auch einseitige Schriften im Rahmen des Kanons in einen Konsens eingebettet werden. Der Kanon enthält auf jeden Fall neben einer Begrenzung innerkirchlicher Autorität auch deren Anerkennung, ohne welche die Kirche ein Sekte geworden wäre.“126