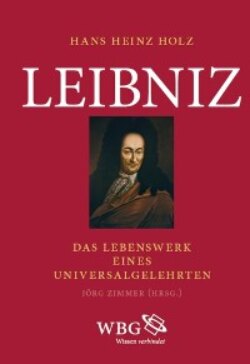Читать книгу Leibniz - Hans Heinz Holz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Schwierigkeiten des Leibniz-Verständnisses
ОглавлениеVon Leibniz geht die große Bewegung spekulativer Metaphysik aus, die zu den Systemen des deutschen Idealismus führte und deren epigonale Erben alle späteren Philosophen gewesen sind. Leibniz ist der Denker, der zuerst mit ungeheuerer begrifflicher Anstrengung die Vielheit der Welt im Gegensatz zu einer theologischen Begründung aus einem zentralen innerweltlichen Prinzip abzuleiten unternahm und damit das Ziel und die Aufgabe der Philosophie für die folgenden Zeiten setzte. Dieser Absicht konnte er nur durch die Ausarbeitung eines komplexen dialektischen Denkschemas gerecht werden, das er als Modell der Realverhältnisse verstand. Von Leibniz führt so eine direkte Linie zum jungen Schelling, zu Hegel und später zu Marx. Von ihm nimmt in der deutschen Philosophie jener Säkularisierungsprozeß seinen Ausgang, in dessen Verlauf die Philosophie die theologische Begründung der Welt aufgibt, um die Wirklichkeit aus sich selbst, aus ihrer systematischen Struktur zu begreifen. Leibniz leitet die Verknüpfung aller einzelnen Seienden aus dem principium rationis sufficientis (Prinzip des zureichenden Grundes) ab, das besagt, „daß nichts geschieht, ohne daß es dem, der die Dinge genügend kennt, möglich wäre, einen Grund anzugeben, der zureicht, um zu bestimmen, warum es so und nicht anders ist“ (KS, S. 427). Da zu jedem einzelnen Grund wiederum ein anderer Grund muß angegeben werden können, würde die Kette der Gründe (catena rationum) eine unendliche Reihe ergeben, deren Anfang nur durch eine willkürliche Setzung eines Ersten (des „ersten Bewegers“ des Aristoteles oder des christlichen Schöpfergottes) ausgemacht werden könnte. Nichts aber hindert, die Reihe der Dinge (series rerum) ins Unendliche fortgesetzt zu denken. Daher kann der Anfang nicht am Anfang der Reihe liegen, der immer unbestimmt bleiben würde, sondern muß mit der räumlich unbegrenzten und zeitlich ewigen Totalität aller Seienden zusammenfallen: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, und es ist logisch (wenn auch nicht empirisch) vor den Teilen, die durch den Gesamtzusammenhang, also ihre wechselseitige Verknüpfung, in ihrer Besonderheit, „so und nicht anders existieren zu müssen“ (KS, S. 427), determiniert sind.
So gelangt Leibniz zum Begriff der Determination des individuell Seienden als einer bloß innerweltlichen, über die hinaus eine catena rationum nicht weitergeführt werden kann und auch nicht weitergeführt zu werden braucht.34 Wohl gebraucht er für die Weltordnung im ganzen noch den Terminus Gott, aber als einen Terminus, der dem Begriff der „einzigen, universellen und notwendigen Substanz“ (KS, S. 457) äquivalent ist, also den Titel für die strukturell-substantielle Einheit der Welttotalität darstellt.35 Leibniz säkularisiert die Philosophie nicht weniger radikal als Spinoza, der Gott, Natur und Substanz gleichsetzte. Denn er entwickelt die Begründung des Seienden aus der Idee der Welt, d.h. aus der Idee des Seins im ganzen, als ontologisches Theorem. Das Argumentationsmuster einer spekulativen Philosophie verbindet ihn unmittelbar mit Hegel.
Angesichts der Neuartigkeit des philosophischen Konzepts und der damit verbundenen Schwierigkeiten, sich aus der überkommenen Vorstellungs- und Begriffswelt zu lösen, ist es nicht erstaunlich, daß Leibniz’ Philosophie schon zu seinen Lebzeiten auf Verständnissperren stieß und auch noch der Nachwelt mancherlei Deutungsprobleme aufgibt. Wir haben gesehen, wie die Leibnizsche Philosophie sich in einer Periode des stürmischen Aufbruchs der modernen Wissenschaften entwickelt. Leibniz wurde vier Jahre nach dem Tode Galileis geboren, Descartes ist vier Jahre nach der Geburt von Leibniz gestorben. Newton ist sein Zeitgenosse. Selbst mit mathematischen und physikalischen Forschungen befaßt und allen Veränderungen der Naturwissenschaften aufmerksam zugewandt, hat er wie kein anderer von der Fülle der empirischen Daten her begriffen, daß neue philosophische Denkmittel für den Entwurf eines der wissenschaftlichen Entwicklung entsprechenden Weltbildes zu erarbeiten notwendig war. Das Instrumentarium der aristotelischen Kategorien und der scholastischen Logik reichte nicht mehr aus, um die neu auftauchenden Probleme angemessen zu formulieren. Die von der Theologie und der von ihr abhängigen Metaphysik bereitgestellten Denkmodelle wurden durch die Erkenntnisse der Erfahrungswissenschaften gesprengt. Der Prozeß gegen Galilei hatte die Unversöhnlichkeit des Widerspruchs signalisiert. Aber noch waren die philosophischen Methoden und Begriffe nicht ausgereift, die das Modell einer wissenschaftlichen Weltanschauung hätten abgeben können. Die Philosophien des Descartes und Spinoza trugen noch den Ballast der scholastischen Traditionen mit sich: Der cartesische Gottesbeweis und die rigide Phänomenalisierung der mannigfaltigen Welt gegenüber der einzig wahrhaft seienden einen Substanz bei Spinoza zeugen von den Schwierigkeiten, in die beide Denker bei ihren Versuchen, zu einer weltimmanenten Metaphysik vorzustoßen, gerieten. Eine neuzeitliche Metaphysik aber, die der sich Schritt für Schritt enthüllenden Dialektik der Natur Rechnung tragen wollte, mußte zu neuen Konzepten kommen, die die alte Substanzenlehre ablösen konnten.
Aus dieser Situation erwächst die Schwierigkeit, Leibniz angemessen zu verstehen. Schon ihm selbst scheint diese Schwierigkeit bewußt geworden zu sein, sodaß sein Denken sich in immer neuen Anläufen und perspektivischen Varianten den Problemen von verschiedenen Seiten her zu nähern versuchte. Im Bemühen um Gespräch und Verständnis blieb für ihn die Auseinandersetzung mit den Zeitgenossen in Briefen und kritischen Schriften der Rahmen, in dem sich seine systematische Absicht entfaltete. Nur selten hat Leibniz systematische Entwürfe skizziert – und auch dann meist nur in der Diskussion mit korrespondierenden Geistern; so 1685/86 die Metaphysische Abhandlung, die am Anfang der systematischen Publikationen der Reifezeit steht und für den berühmten jansenistischen Theologen und Philosophen, den Mitverfasser der Logik von Port Royal, Antoine Arnauld bestimmt war; so 1714 die beiden „Vermächtnisschriften“, die Monadologie, deren Empfänger Rémond, die Prinzipien der Natur und Gnade, deren Adressat der Prinz Eugen war. Publiziert hat Leibniz nur das Neue System und die Erläuterungen, mit denen er auf kritische Einwände antwortete.36
Bei der Lektüre von Leibniz-Texten ist also zu berücksichtigen: Er schreibt selten ausschließlich zur Selbstverständigung oder Selbstdarstellung. Meist sind seine Schriften (soweit es sich nicht um Notizzettel handelt) mit einem bestimmten Zweck verbunden; sie entspringen einem einmaligen Anlaß und sind an einen bestimmten Adressaten gerichtet. Daraus ergibt sich für Leibniz die Notwendigkeit, zweierlei vom eigentlichen Systemkern zu trennen: erstens die diplomatischen Rücksichtnahmen, die sich aus der Absicht ergeben, mit der Leibniz die Diskussion führt; zweitens die Abstimmung der Problemfassung und der Formulierung auf den Gesichtskreis des Adressaten, die dem Ziel dient, sich besser verständlich zu machen. Es schien Leibniz geraten, seine eigenen, von Grund auf neuen Ideen in ein Gewand zu kleiden, das sie dem Gesprächspartner vertraut machen sollte. Als Diplomat und Hofmann war er, anders als die meisten Philosophen, an solche Taktik gewöhnt, ja sie muß ihm seit jungen Jahren, als er die politische Karriere im Dienst Boineburgs und des Mainzer Erzbischofs (als Protestant!) begann, zu einer zweiten Natur geworden sein. Zudem hat Leibniz – wie wir sehen werden – einen Substanz- und Wahrheitsbegriff entwickelt, demgemäß sich eine Sache unter verschiedenen Gesichtspunkten auf verschiedene Weise jeweils mit relativer Wahrheit darstellt, sodaß Perspektivenverschiebungen in der Präsentation seiner Gedanken ihm als ein angemessener Ausdruck seines relationalen Seinsverständnisses keine Schwierigkeiten machten.
„Man sieht deutlich, daß seine allseitig verstehende Duldsamkeit nicht etwa nur eine Klugheitsregel des geschmeidigen Hofmannes ist, sondern in erster Linie ein vernünftig begründeter methodischer Grundsatz der universellen Gelehrten … Auch die Relativität der Meinungen ist ihm nicht Ende, sondern Anfang, nicht Ziel, sondern Mittel, um zur Absolutheit der einen Wahrheit durchzudringen … Bei dieser Auffassung ist es also möglich, sie alle in gewisser Hinsicht, in ihrer relativen Berechtigung, gelten zu lassen und sich doch nicht in diesen Relativitäten zu verlieren …“37
Leibniz stellt sich also in der Diskussion sehr weitgehend auf seine Kontrahenten ein. Oft läßt er sich sogar dazu verleiten, deren Basis zu beziehen, um überhaupt mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Schon Johann Christoph Gottsched gibt in einer Anmerkung zu seiner deutschen Übersetzung der Theodizee darauf einen Hinweis (der gerade bei der Theodizee auch besonders angebracht ist):
„Man merke doch hier, wie auch überhaupt in der Schreibart des ganzen Buches, welches doch eigentlich zu reden eine Streitschrift ist, die besondre liebreiche Gemütsart des Herrn von Leibnitz an. Er begegnet seinem Gegner nicht stolz, nicht feindselig, nicht argwöhnisch; viel weniger hitzig, trotzig und ketzermacherisch; nein er leget ihm fast seine Meinungen gar nicht zur Last; er entschuldiget ihn, indem er ihn tadeln muß; er lobet ihn, wenn er ihn widerlegt …“38
Die in solchen Diskussionsschriften niedergelegten Gedanken müssen als eine Projektion Leibnizscher Ansichten auf eine jeweils durch das Gegenüber gegebene Ebene angesehen werden. Es bedarf immer der Kenntnis dieses Gegenübers, um den Kern, der für Leibniz originär ist, herausschälen zu können. Die Leibniz-Interpretation stellt sich derart vor Schwierigkeiten, wie sie bei fast keinem anderen Autor auftauchen.
Die Schwierigkeiten werden noch dadurch vergrößert, daß Leibniz bei diesen diplomatischen Rücksichten und dem systematischen Entgegenkommen nicht stehen bleibt. Die Anpassung an die Gesichtspunkte des Gesprächspartners, das hypothetische Experimentieren mit Konzepten führt ihn bisweilen zur Übernahme fremder Auffassungen und Auslegungen in das eigene System, das heißt zu Überlagerungen in Details, die die Reinheit und Strenge seines ursprünglichen Gedankens trüben. Hinzu kommt, daß er grundsätzlich in seiner Zeit gewisse Erkenntnisse erst ahnen, antizipieren, aber noch nicht explizit aussprechen konnte; daß er vieles im begrifflichen Gewand seiner Zeit und Umgebung, das heißt in theologischen Kategorien denken mußte, was tatsächlich dem inneren Sinn nach rein weltlichen Charakter hat. Auch bei naturwissenschaftlichen Erklärungsmustern werden wir auf diese Diskrepanz zwischen konzeptioneller Treffsicherheit und zeitbedingter Phantastik stoßen.
Leibniz hat selbst den Unterschied „exoterischer“ und „akroamatischer“ Rede, also volkstümlicher, allgemeinverständlicher (aber begrifflich unscharfer) und philosophisch genauer, für den Kenner bestimmter (aber schwer verständlicher) Formulierung, getroffen39 und auf seine eigenen Schriften angewandt. Von der Theodizee sagt er selbst: „Endlich habe ich mich bemüht, mich bei allem auf die Erbauung zu beziehen“ (Theod., S. 63), was einschließt, daß die Abstraktion des spekulativen Begriffs nicht eingehalten wird; und der Vergleich mit der Monadologie, am Ende von deren Paragraphen Leibniz auf die entsprechenden Stellen der Theodizee verweist, läßt den Abstand spüren, der zwischen einer philosophisch kompromißlos formulierten Thesen-Abhandlung und einer Popularisierung für den gebildeten Leser bei Hof und in den Bürgerhäusern besteht.
Daß es unter der Oberfläche von Brief- und Konversationsstil ein eigentlich Gemeintes gibt, hat Leibniz kenntlich gemacht, wenn er zuweilen hervorhebt, eine Aussage müsse „à la rigueur métaphysique“ (mit metaphysischer Strenge) verstanden werden.
Eben die Neuartigkeit der geistigen Situation Leibniz’, der auf der Schwelle eines neuen Zeitalters stand, bedingt die Doppelsinnigkeit seines philosophischen Ausdrucks. Für das, was er meinte, fand er kein begriffliches Instrumentarium vor, das er hätte benutzen und verfeinern können. Er mußte vielmehr jedem Denkgebilde erst eine angemessene Form verleihen, er mußte selbst die begrifflichen Mittel entwickeln, mit denen er dann arbeiten konnte. Es hilft wenig, wenn wir die Herkunft dieses oder jenes Terminus bei Vorgängern oder Zeitgenossen aufspüren. Im Leibnizschen System wandeln sich die Begriffe und nehmen einen eigenen, aus der Tradition nicht ableitbaren Sinn an.
So ist die erste Aufgabe einer Leibniz-Interpretation die „Richtigstellung der Begriffe“ im immerwährenden Überdenken der Leibnizschen Intentionen. Nichts darf ungeprüft hingenommen werden. Zugleich führt uns diese Vor-Arbeit aber auch schon ins Zentrum. Haben wir den korrekten Sinn der Schlüsselbegriffe gefaßt, so liegt der Zugang zum System offen – was bislang dunkel schien, wird deutlich und läßt sich in einen übergreifenden Zusammenhang einordnen.
Die systematische Konzeption der Leibnizschen Philosophie wird beim ersten Hinblick durch den Anschein einer äußerst zugespitzten idealistischen Konstruktion verdeckt. Die Bestimmungen der monadischen Substanz, perceptio und appetitus, repraesentatio mundi und Fensterlosigkeit scheinen auf den Bewußtseinscharakter der Monade zu deuten. Ihr tiefer liegender realistischer Sinn wird nicht erfaßt, wenn ebendiese Bestimmungen in ihrer überlieferten Bedeutung genommen werden. Leibniz sprengt den Bedeutungsrahmen der traditionellen Terminologie auf und erfüllt die Begriffe mit anderem Gehalt. Dies ist zu Eingang einer Untersuchung zu bedenken, die die Konturen der grundlegenden Gedanken des Leibnizschen Systems umreißen will.