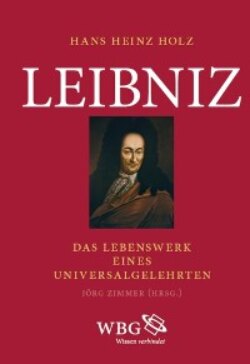Читать книгу Leibniz - Hans Heinz Holz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die geschichtliche Ausgangslage
ОглавлениеZu dieser Ausbreitung in ein individuelles Kommunikationsfeld hat zweifellos auch die historisch-politische Lage beigetragen, in die Leibniz sich als politisch aktiver Mensch gestellt fand. Er wurde am 1. Juli 1646, also zwei Jahre vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) geboren. Das Deutsche Reich war nur noch als ein lockerer Verband von Klein- und Mittelstaaten – zeitweilig etwa zweitausend selbständige Reichsstände! – aus dem Westfälischen Frieden (1648) hervorgegangen; die Reichseinheit war nur noch symbolisch durch den „Supremat“ des Kaisers und einige Bundesinstanzen (Reichstag, Reichskammergericht, Reichshofrat) gewahrt, im übrigen war allen Reichsständen nach Art. VIII § 1 des Vertrags von Münster die landesherrliche Souveränität zugestanden; sie sollen „in freier Ausübung der Landshoheit in kirchlichen wie weltlichen Dingen in ihren Vollmachten und Hoheitsrechten und im Besitz all dieser Dinge kraft dieses Vertrages so bestätigt und gesichert sein, daß sie von niemandem jemals unter irgend einem Vorwand tatsächlich gestört werden können oder dürfen“.
Und diese Souveränität war sogar auf das Recht zu selbständiger, wenn auch nicht reichsfeindlicher, Außenpolitik ausgedehnt (§ 2):
„Vor allem aber sollen alle Reichsstände das Recht haben, unter sich und mit auswärtigen Staaten Bündnisse zu schließen zu ihrer Erhaltung und Sicherung, jedoch derart, daß solche Bündnisse sich nicht gegen Kaiser und Reich und den Reichsfrieden oder vor allem gegen diesen Vertrag richten, und in allem vorbehaltlich des Eides, wodurch jeder dem Kaiser und dem Reiche verpflichtet ist“.
Es liegt auf der Hand, daß unter den Bedingungen solcher politischer Zersplitterung und territorialer Aufspaltung in zahllose kleine Staatsgebilde mit auseinanderstrebenden Interessen sich ein kulturelles Zentrum nicht ausbilden konnte. Wer in Deutschland sich der Wissenschaft oder Literatur widmete, hatte kein staatlich initiiertes und gefördertes Institut, wie die 1635 von Richelieu gegründete Academie française oder die 1660 von Karl II. bestätigte Royal Society, sondern mußte sich in individuellen Kontakten den Kreis von Korrespondenzpartnern schaffen, dessen er zur Kritik und Förderung seiner eigenen Forschung bedurfte. Aus dieser Erfahrung hat Leibniz zeit seines Lebens an der Errichtung von wissenschaftlichen Zentren gearbeitet, die das geistige Leben der Nation organisieren und für den gesellschaftlichen Fortschritt nutzbar machen sollten. Schon als Dreiundzwanzigjähriger hat er 1669 den Entwurf zu einer „Philadelphischen Gesellschaft“ ausgearbeitet, in dem es u.a. heißt:
„Es werden die Künste und Wissenschaften vermehrt werden durch eine allgemeine Korrespondenz, so umfassend sie nur sein kann, sowie durch sorgfältigste Vertiefung in die Natur der Dinge.
Beides, die Erfindung selbst wie auch das Eingießen der Erfindung in die Geiste, kann sowohl durch einzelne geschehen wie auch durch die gemeinschaftlichen Bemühungen einer weit ausgedehnten Sozietät.
Es ist jedoch offensichtlich, daß bei weitem mehr mit größerem Nutzeffekt durch die Sozietät erreicht werden kann als durch die Mühe einzelner, die untereinander unverbunden sind und gleichsam auf einer Rennbahn ohne Ziel keuchen“ (Pol. Schr. II, S. 22).
Deutschland könne, so meinte Leibniz zwei Jahre später in dem „Grundriß eines Bedenkens von Aufrichtung einer Sozietät in Deutschland zu Aufnehmen der Künste und Wissenschaften“ (1671), durch die Konzentration und Förderung der Wissenschaften auch den technisch-wirtschaftlichen Rückstand gegenüber seinen großen Nachbarländern aufholen, weil durch eine Akademie „Manufakturen darin zu stiften und per consequens Kommerzien dahin zu ziehen …, ein sicher Banko zu formieren, in Kompagnien zu treten, bei den formierten Aktien zu erhandeln, die Deutschen zur Handlung zur See aufzumuntern …, die Schulen zu verbessern …, die Handwerke mit Vorteilen und Instrumenten zu erleichtern“ (Pol. Schr. II, S. 40) seien.11 Solche Pläne finden aber noch dreißig Jahre lang kein Gehör bei den Fürsten; erst die Königin Sophie Charlotte von Preußen, die als hannoversche Prinzessin die Schülerin von Leibniz und später stets seine Gönnerin und Vertraute gewesen ist, ermöglichte ihrem großen Freund und Lehrer die Gründung der kurbrandenburgischen Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, der späteren Preußischen Akademie der Wissenschaften (1700).
Sicher waren es die Folgen des Dreißigjährigen Krieges gewesen, die die „deutsche Misere“ verstärkt und die Rückständigkeit des Landes besiegelt hatten. Die Anfänge aber reichen schon weiter zurück. In seiner brillanten Darstellung der Lage Europas um 1618 – also vor dem Ausbruch des Krieges – hat Golo Mann das zerfallende Deutsche Reich trefflich charakterisiert: „Es war ein Chaos sich bekämpfender, durchkreuzender, an einander vorbeizielender Willenszentren, wenn der Wille überhaupt ein Zentrum hatte und wußte, was ihm noch zu wollen übrig blieb“.12 Zunftschranken in den selbständigen Städten hinderten die Entwicklung des Gewerbes, Zoll- und Handelsschranken erschwerten den Warenverkehr und lenkten den internationalen Transfer auf andere Wege, hohe Abgaben an die geldbedürftigen Territorialherren verminderten das Investitionskapital, die konfessionelle Spaltung vertiefte die Gräben zwischen den einzelnen deutschen Ländern; so konnte ein aufstrebendes Gewerbebürgertum kaum entstehen, und der Adel hielt an seinen Vorrechten und an der Ausnutzung des Grundeigentums fest, mit wachsendem, am Standard der entwickelteren Nachbarländer orientiertem Luxusbedürfnis und immer stärkerer Ausbeutung und Bedrückung der Bauern. Diese Entwicklung hatte schon im 15. Jahrhundert eingesetzt und war um 1600, als in England und Frankreich zentral organisierte Wirtschaftseinheiten entstanden, bereits weit gediehen.
Der Krieg allerdings vernichtete dann jede Möglichkeit, aus der Entwicklung in den Nachbarstaaten zu lernen, Gewinn zu ziehen und den Rückstand aufzuholen. Die Feldzüge der dreißig Jahre fanden ja in Mitteleuropa statt, die Heere plünderten das Land aus, die dauernden Kontributionen zur Aufstellung neuer Heere ließen die Städte und kleineren Staaten verarmen. Wo Zahlen vorliegen, weisen sie übereinstimmend während der Kriegsjahre einen Bevölkerungsrückgang auf ein Drittel der ursprünglichen Einwohnerzahl, eine Vermögensschrumpfung auf ebenfalls ein Drittel und die Verminderung der Handwerksbetriebe und Produktionsstätten im gleichen Umfang aus. Es brauchte zwei Generationen, das heißt bis zum Ende des Jahrhunderts, bis der Vorkriegsstand wieder erreicht war.
Auch wenn der ökonomische Niedergang Deutschlands durch den Krieg nicht ausgelöst, sondern nur verstärkt wurde, so blieb doch das Kriegstrauma über lange Zeit ein Moment der deutschen Bewußtseinslage und hatte Konsequenzen für die Problemstellungen der deutschen Philosophie bis hin zu Immanuel Kants Schrift Vom ewigen Frieden (1795).13 Leibniz’ philosophisches, religionspolitisches und staatspolitisches Bemühen kann ganz unter diesem Gesichtspunkt verstanden werden; Gerhard Krüger hat 1946 seinen Festvortrag zum 300. Geburtstag des Philosophen unter den Titel gestellt: „Leibniz als Friedensstifter“. Es gibt zahlreiche politische Memoranden und juristische Abhandlungen von Leibniz zu einer europäischen Friedensordnung, aber auch Niederschriften, die den inneren sozialen Frieden zum Ziel haben; viel Zeit und Arbeit hat er in seine Anstrengungen zur Herstellung des konfessionellen Friedens, letztlich mit dem Ziel der Wiedervereinigung der Konfessionen, investiert; und das philosophische Konzept einer Ordnung kompossibler (zusammen möglicher und verträglicher) Verschiedener ist der Versuch, die logischontologische Grundlage für die Idee einer friedlichen, harmonischen Welt zu finden.
Die Einheit des Leibnizschen Denkens, die manche Philosophiehistoriker bei ihm nicht zu entdecken vermochten, liegt in der Überzeugung, daß ontologische Grundlage, wissenschaftliche Erkenntnis von Natur und Menschenwelt und gesellschaftlichpolitische Ordnungsidee demselben Prinzip der universellen Harmonie entspringen, das sich in der streng geregelten Verknüpfung der Dinge zeigt und in der politischen Organisation wie dem ethischen Verhalten der Menschen mit freiem Willen aus Vernunfterkenntnis verwirklicht werden muß. Die wechselseitige Anpassung der Monaden als Struktur einer einheitlichen Welt von unendlich vielen verschiedenen Individuen ist dieselbe, die auch die öffentliche Sicherheit (securitas publica) und das öffentliche Wohl (salus publica) oder das allgemeine Wohl (commune bonum) bestimmt; die Gemeinschaft einer Vielheit von Einzelnen beruht auf dem Prinzip der Friedlichkeit: „Das Recht entspringt aus dem Prinzip der Erhaltung des Friedens“.14 Der Friede – das heißt logisch: die Auflösung der Widersprüche in Kompossibilität – ist die allgemeinste und aus allen Verletzungen immer wieder herzustellende Form des kosmischen Gleichgewichts, weil Welt „die Verknüpfung oder die Anpassung aller erschaffenen Dinge an jedes einzelne von ihnen und jedes einzelnen an alle anderen“ bedeutet (Mon., § 56, KS, S. 465). Metaphysische und politische Ordnung entsprechen einander. Das ist das zeitgeschichtliche Credo, die Überwindung des Kriegstraumas unter der Idee des Vertrags: „Die Versicherung des Friedens ist der größte und sicherste Punkte … Die Versicherung des Friedens besteht in zwei Punkten, erstlich in Abtuung aller Kriegspraetexte, zweitens in Formierung einer so viel möglichen beständigen Allianz der Garantie“ (Pol. Schr. I, S. 72). Sozusagen aus einer Affinität des Zeitempfindens konnte nach dem 2. Weltkrieg die Leibniz-Problematik metaphysisch wie politisch ganz aktuell aufgenommen werden.15
Die Historiographie der Wissenschaften orientiert sich heute gern am Begriff der „wissenschaftlichen Revolutionen“ und kennzeichnet diese durch einen Vorgang, der als „Paradigmenwechsel“16 bezeichnet wird. Gewonnen wurde dieses Modell der Wissenschaftsgeschichte am Übergang zur Neuzeit als dem schlagendsten Beispielfall, der durch die Ablösung des ptolemäischen Weltbildes durch das kopernikanische charakterisiert ist. Ohne auf die methodologischen Probleme einzugehen, die sich mit dem von Thomas Kuhn eingeführten historiographischen Modell verbinden,17 läßt sich wohl sagen, daß die Philosophie des 17. Jahrhunderts unter dem Eindruck der grundlegenden Veränderungen des wissenschaftlichen Weltbildes stand und weltanschauliche Entwürfe zur Integration des neuen und sich rapid erweiternden Wissens vorlegte.
Der Leitfunktion, die die Galileische Physik für die Grundlegung des neuen Weltbildes hatte, entsprach die Ausbreitung mechanistischer Denkschemata, nicht nur im Materialismus der Gassendi und Hobbes, sondern auch bei Descartes und im gesamten Cartesianismus, verbunden mit der Orientierung am Vorbildcharakter der Mathematik (der sich zum Beispiel in der Darstellung more geometrico des Spinoza auch gegenüber ihm disparaten Gegenständen durchsetzt). Demgegenüber waren die platonisierend idealistischen oder thomistischen Systeme der Schulphilosophie ungeeignet, den Gehalt der neuen Naturwissenschaften zu interpretieren, obschon im Rückgriff auf die originäre, nichtscholastische Aristoteles-Überlieferung eine nichtmechanische materialistische Naturphilosophie wichtige Anregungen gewinnen konnte.18
In gewisser Weise kann man sagen, daß der Weg der Wissenschaften durch eine schrittweise Ablösung der einzelnen Disziplinen von der Philosophie gekennzeichnet war und daß im Zuge dieser Ablösung die methodisch gesicherte Erfahrung an die Stelle bloßer Konstruktionen aus Verstandesüberlegungen trat. Aber schon in der Epoche, in der die Autonomie der Wissenschaften sich durchsetzte, vollzog sich auch die Umkehr: Die Wissenschaften begannen nach einer Philosophie zu suchen, durch die sie die Mannigfaltigkeit selbständig erworbenen Wissens wieder zu einem kohärenten Ganzen verknüpfen könnten, zu einem Bildteppich der Welt, der es dem Menschen erlaubt, die Orientierungspunkte auszumachen, von denen aus er seinen Ort und sein Handeln bestimmen könnte. Diese Philosophie muß wissenschaftlich sein, denn hinter den Erkenntnisstand der Wissenschaften darf kein Denken des Ganzen mehr zurückfallen.
„Eine geschlossene Disziplin des Experimentierens und Berechnens war entwickelt worden, eine einheitliche Methode, mit deren Hilfe früher oder später jedes Problem in Angriff genommen werden konnte … In ihren Anfangsstadien war die neue Experimentalwissenschaft notwendigerweise kritisch und destruktiv; in den späteren Entwicklungsphasen zielte sie jedoch darauf hin, eine neue Basis für eine Philosophie zur Verfügung zu stellen, die mehr mit den Bedürfnissen der Zeit in Einklang stand“.19
Mit dem Programm einer wissenschaftlichen Philosophie (das erst nach Ausbildung eines von der Philosophie unabhängigen Begriffs von Wissenschaft aufgestellt werden konnte) war an die Stelle des Nebeneinanders von theoretischen Verallgemeinerungen und bloßen Beschreibungen ein neuer Typus von Welterfahrung getreten, in dem beide Erkenntniseinstellungen eine (methodologisch oft widerstreitend reflektierte20) Einheit bilden.
„Die Naturerkenntnis oszillierte immer zwischen zwei entgegengesetzten Polen: Ausarbeitung allgemeiner Theorien, die darauf gerichtet sind, die ersten Prinzipien der Wirklichkeit festzustellen, um daraus eine rationale Erklärung aller Phänomene abzuleiten; und einfache Beschreibung eines begrenzten Ausschnitts aus der Erfahrung … Die Geburt der neuen Wissenschaft zeigte, daß ein dritter Typus des Wissens möglich war, in dem die theoretische Ausarbeitung und die Beobachtung der Tatsachen sich untrennbar miteinander verflechten, mit außerordentlichem Nutzen für beide Seiten … Offenkundig bewirkt ihre feste Bindung an die Erfahrung für alle so erworbene Erkenntnis eine nicht auszuräumende Vorläufigkeit, weil das Hervortreten neuer, zunächst nicht beobachteter Tatsachen in einem gewissen Augenblick – wenn diese Fakten sich theorieintern nicht mehr erklärbar erweisen – dazu nötigen kann, die Theorie zu berichtigen, zu modifizieren und vielleicht sogar aufzugeben“.21
Nicht der Dualismus von Rationalismus und Empirismus, der die Wissenschaftsgeschichte seit Descartes durchzieht,22 ist das Signum der Moderne; sondern die Konzeption eines prinzipiell unendlichen Erkenntnisfortschritts, der jeden gegenwärtigen Erkenntnisstand zu einer Zeit relativiert und vorläufig macht. Philosophische Systeme können den Anspruch auf absolute Wahrheit nicht mehr erheben. Sie sind Modelle, die das Ganze oder den Sinn ausdrücken und durch Ausweis ihres Konstruktionsverfahrens die Konstitutionsbedingungen ihres Entwurfs klarlegen und seine Überzeugungskraft beurteilbar und seinen Aussagegehalt interpretierbar machen. Philosophie wird zur Hypothese – und anders hat Leibniz sein System auch nicht vorgetragen. Im § 15 des Neuen Systems macht er das deutlich. Zunächst sagt er von seinem System der prästabilierten Harmonie („Es ist diese in jeder Substanz der Welt von vornherein geregelte gegenseitige Beziehung, die das hervorbringt, was wir ihren Verkehr nennen, und die einzig und allein die Verbindung von Seele und Körper ausmacht“): „Die Hypothese ist sehr wohl möglich“; dann beweist er die Möglichkeit, um fortzufahren:
„Sobald man also die Möglichkeit dieser Hypothese der Übereinstimmung einsieht, erkennt man auch, daß sie am vernünftigsten ist und eine wunderbare Idee von der Harmonie des Universums und der Vollkommenheit der Werke Gottes gibt“ (KS, S. 221f.).
Metaphysik bekommt hier die wissenschaftliche Theorieform in der Besonderheit einer nicht empirisch verifizierbaren Theorie des Gesamtzusammenhangs der Welt. Philosophische Systeme sind nicht länger mehr Vorstellungen vom Ganzen, sondern transempirische Konstruktionen der plausibelsten (und am meisten explikativen) Form der Verknüpfung der mannigfachen Erfahrungsgegenstände zu einem Ganzen. Als vernünftige Konstruktion eines hypothetischen Konstrukts mit dem Erkenntnisstatus eines Strukturmodells ist Leibniz’ Theorie der universellen Harmonie zu verstehen.
Neu ist die Methode der Feststellung wissenschaftlicher Wahrheit, und sie ist es, die den Begriff der Wissenschaftlichkeit verändert. Die Sicherheit der Beweisführung wird durch den zwingenden Charakter mathematischer Konstruktionen gewährleistet – die mathematische Form der Reduktion auf identische Sätze ist seither das Muster der „notwendigen“ oder „Vernunft-Wahrheiten“ (vérités de raison) im Gegensatz zu den bloß aus der Erfahrung stammenden „kontingenten“ oder „Tatsachen-Wahrheiten“ (vérités de fait).23 Während aber in der mittelalterlichen Scholastik die Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Vernunft und des Glaubens als Wahrheitsbeweis ausreichte, trat nun das Kriterium hinzu, daß eine Behauptung über die Wirklichkeit auch vor der durch den Verstand geprüften Erfahrung bestehen müsse.
Verständige Erfahrung, das ist aufgrund methodischer Fragestellung experimentell überprüfte Erfahrung; um von ihr zu „sicherer Beweisführung“ zu gelangen, müssen die Fragen so gestellt sein, daß die Antworten quantifizierbar, d.h. mathematisch ausdrückbar sind und so in die strenge Deduktivität mathematischer Konstruktionen überführt werden können. Das nicht zu übertreffende Exempel für diese Verfahrensweise war zu Beginn der Neuzeit die Mechanik. Der Wissenschaftstypus der Mechanik wurde zum „metaphysischen Modell“.24 Das besagt, daß die Abstraktionen, die in der Mechanik die Konstruktion eines Gesetzeszusammenhangs und eines Systems von Welt erlauben, und die Verfahrensweisen, die die analytische Isolation dieser Abstraktionen ermöglichen, als konsumtiv für das Bild genommen wurden, das man sich von der Welt im ganzen machte. Am Ende dieser Periode wird Newton im Vorwort zur ersten Auflage der Principia (1687) diese Modellvorstellung noch in die Worte fassen: „Die ganze Aufgabe der Philosophie scheint darin zu bestehen, von den Bewegungserscheinungen aus die Kräfte der Natur zu erforschen und dann aus diesen Kräften die anderen Erscheinungen abzuleiten.“
Natürlich hängt der Übergang zur Mechanik als „Leitwissenschaft“ aufs engste damit zusammen, daß die entscheidenden technischen Fortschritte, die zur Herausforderung der Wissenschaften wurden, auf den Gebieten der Mechanik und Hydraulik gemacht wurden. Technik war in jener Zeit fast ausschließlich Maschinentechnik; gemäß dem Funktionieren von Maschinen glaubte man die Verfassung der Welt begreifen zu können.
Von nicht minderer Bedeutung als Galilei für die Physik war der englische Arzt William Harvey (1578–1657) für die Medizin. Er bewies den Blutkreislauf im menschlichen Körper, nachdem der sogenannte „kleine Kreislauf“ des Herzens schon in Genf von Michele Serveto (1509–1553), in Pisa von Andrea Cesalpino (1519–1603) und in Padua von Realdo Colombo (1520–1559) entdeckt worden war.25 Die weitere Entwicklung der Medizin als empirischer Wissenschaft beruhte auf der Anwendung des mechanischen Modells. Ältere organizistische Vorstellungen, aufgrund deren damals nur ein intuitiver Zugang zur Krankheit möglich war, weil es kein angemessenes Strukturmodell für den Organismus gab, wurden in den Zwischenbereich der Volksmedizin und Scharlatanerie abgedrängt, wo sie sich mit allerlei animistischem und astrologisch-alchimistischem Aberglauben vermischten.
Mit dem Paradigmenwechsel von der Glaubensgewißheit, die die Grundlage der christlichen Philosophie bildete, zur Vergewisserungsbedürftigkeit der Erkenntnis, die das Problembewußtsein der neuzeitlichen Philosophie charakterisiert, war der Philosophie eine ganz neue Funktion zugewiesen worden. Sie hatte in ihrer Wissensform verschiedenartige Bereiche der Erkenntnis in methodische Übereinstimmung zu bringen, um die Einheit der Welt im Wissen von der Welt zu sichern. Da ist einmal der Bereich der Natur, der sich durch Beobachtung, induktive Verallgemeinerung und Formulierung mathematisch ausdrückbarer Gesetzmäßigkeiten erschließt. Da ist zum zweiten der damals gerade neu ins Bewußtsein tretende Bereich der Prozessualität und Kontinuität der Geschichte, insbesondere der menschlichen Gattungsgeschichte,26 die im Unterschied zu naturgesetzlich erfaßbaren Phänomenen durch die Unwiederholbarkeit und Singularität der Ereignisse und Individuen bestimmt wird. Und schließlich steht im Denken und Erkennen den beiden Objektbereichen die durch das Subjekt konstituierte, aber sich intersubjektiv bewährende Seinsweise der res cogitans gegenüber, also die reflexive Existenz des Menschen, der die reale Welt ideell reproduziert, woraus sich die Aufgabe ergibt, das Verhältnis dieser ideellen Reproduktion zur Realität zu bestimmen.
Der dritte Aspekt war seit Descartes, der die Seinsgewißheit auf die Selbstgewißheit des Denkens gründete („cogito, ergo sum“), zum beunruhigendsten geworden; aber er hat die beiden anderen und zumal den ersten im Zeitalter der aufsteigenden Naturwissenschaften nie verdrängt. Vielmehr blieb für die gesamte Metaphysik von Descartes bis Hegel die Frage nach der Verankerung des Denkens, als der Reflexion des Seienden, im Sein der Welt selbst das Leitmotiv ihrer Konstruktionen.
Leibniz hat unter den metaphysischen Denkern der Neuzeit als erster erkannt, daß ein Weltmodell, das die Integration der drei Bereiche leisten soll, nicht als eine Theorie von qualitativen Aussagen über Substanzen, sondern als ein Relationensystem entworfen werden muß, in dem das Sein der Seienden aus der Struktur des Zusammenhangs der Seienden, die Einheit aus der Vielheit bestimmt werden müsse, wenn nicht die Mannigfaltigkeit dessen, was der Fall ist (die „Tatsachen“), in einem unterschiedslosen hen kai pan (eins-und-alles) verschwinden soll. Der starke Nachdruck, den Leibniz in ontologischer Hinsicht auf die Einheit legt, wenn er sagt, „daß nicht wahrhaft ein Seiendes ist, was nicht wahrhaft ein Seiendes ist“ (G II, 97), hat vielfach den Blick davon abgelenkt, daß es die ontische Vielheit ist, von der als Erfahrungsinhalt ausgehend, er zur Einheit als notwendig zu denkender Voraussetzung kommt: „Man hat immer geglaubt, das Eine und das Sein seien reziprok. Etwas anderes ist das Sein, etwas anderes die Seienden; aber der Plural setzt den Singular voraus, und wo es nicht ein Sein gibt, wird es noch weniger mehrere Seiende geben.“ (G II, 97) Und die Monadologie sagt noch deutlicher, daß die Vielfalt, also das Zusammengesetzte (compose), den Erfahrungsgrund für die logische Notwendigkeit darstellt: „Es muß einfache Substanzen geben, weil es zusammengesetzte gibt.“ (KS, S. 439) Das Einheitliche, Einfache und Einzelne (die drei unterschiedenen Aspekte der Einheit27) ist aber an sich selbst nicht zu denken, denn Denken heißt Bestimmen, also Abgrenzen gegen Anderes, Definieren. Das Eine ist ontologisch immer das Eine im Unterschied von Vielen, das Denken vollzieht sich in der Setzung eines Verhältnisses, also gemäß der Kategorie des Anderen (heteron), die das Eine als Eins denkbar macht.
Das ist die dialektische Urproblematik, die Platon im Parmenides expliziert. Das Eine (hen) als Eines impliziert das Andere (heteron) und ist also Eins in bezug auf Viele (polla).28 Diese platonische Tradition setzt sich über den Neuplatonismus fort in die Renaissancephilosophie, wo sie bei Nikolaus Cusanus einen neuen Höhepunkt erreicht.29 An Cusanus wie auch an den Platonismus der italienischen Renaissance knüpft Leibniz an; Marsilius Ficinus’ Kommentare zu Platons Parmenides und Sophistes deuten die Transformation der ontologischen Kategorie in eine logische an: „Die Kraft der Andersheit selbst bewirkt, wenn sie den idealen Formen eingefügt wird, die Negation.“ „Die Andersheit selbst scheint die Teilbarkeit selbst oder die Zweiwertigkeit jedes Unterschieds und den Ursprung der Negation zu bedeuten“ – nämlich „abgelöst (absoluta) von allen besonderen Unterscheidenden und Unterschieden.“30 Wenn von allen ontischen Verschiedenheiten abgesehen wird, ist die absolute Andersheit die logische Zweiwertigkeit (duitas), der ontologisch die Vermischung des Nicht-Seins mit dem Sein entspricht (non ens cum ente confusum).
Der logische Aspekt der Andersheit als Negation, verbunden mit ihrem ontologischen Aspekt als Grund des individuellen Einzelseins (principium individuationis) führt auf die Betrachtung der Welt als eine Summe diskreter Einzelteile, deren Einheit kein Kontinuum der Verknüpfung bedeutet; so gesehen, wäre die gegenseitige Beziehung der Einzelnen aufeinander zufällig und „Welt“ nur ein Name für den von uns gedachten Zusammenhang. Diese nominalistische Deutung vertrat der Renaissance-Philosoph Marius Nizolius,31 der die Universalität eines Ganzen bestritt und universelle Ganze – im Extrem: die Welt – nur als „Mengen von Einzelwesen, die gleichzeitig und mit einem Mal erfaßt werden“, auffaßte. „Das Universale im Sinne der Dialektiker, das unabhängig von unserem Intellekt in den Dingen angesetzt wird, ist lediglich ein barbarischer und inhaltsloser Name, dem in den Dingen selbst nur etwas Vorgestelltes und sozusagen Chimärisches entspricht“.32 Während der junge Leibniz, der zu einer von ihm besorgten Neuausgabe des Nizolius die Vorrede schreibt (G IV, S. 138ff.), unter dem Eindruck der neuen Naturwissenschaften dem Nominalismus beipflichtet und Hobbes lobt (welche Einstellung er später modifizieren wird), widerspricht er doch in diesem Punkte dem Nizolius heftig:
„Er versucht uns davon zu überzeugen, daß das Allgemeine nichts anderes ist als das Einzelne zusammenfassend und zugleich genommen, und daß, wenn ich sage: jeder Mensch ist ein Lebewesen, der Sinn sei: alle Menschen sind Lebewesen. Dies ist zwar wahr, doch folgt hieraus nicht: Die Allgemeinbegriffe (universalia sind ein zusammengesammeltes Ganzes (totum collectivum). … Es gibt nämlich noch eine andere Art des unterschiedenen Ganzen (totum discretum) ausser dem zusammengesammelten (collectivum), nämlich das eingeteilte (distributivum). … Wenn du jenen – Titus – nimmst oder diesen – Caius – usw., so wirst du finden, daß er ein Lebewesen ist und daß er empfindet. Und wenn nach der Auffassung des Nizolius ‚jeder Mensch‘ oder ‚alle Menschen‘ ein zusammengesammeltes Ganzes (totum collectivum) sind und dasselbe sind wie ‚das ganze Menschengeschlecht‘, so wird eine sinnwidrige Aussage folgen. Denn wenn sie dasselbe sind, so können wir in dem Satz ‚Jeder Mensch ist ein Lebewesen‘ oder ‚alle Menschen sind Lebewesen‘ ‚das ganze Menschengeschlecht‘ einsetzen; es würde dann der mehr als ungereimte Satz entstehen: ‚Das ganze Menschengeschlecht ist ein Lebewesen‘“ (E, S. 24f.).
Eine Gattung, in die ein Individuum „eingeteilt“ werden kann, hat aber einen nicht nur nominalen Status: Es muß etwas real Gemeinsames geben, das allen dieser Gattung zugeteilten Individuen zukommt, und zwar abgelöst von der Besonderheit, in der es als Einzelnes wirklich ist. Der Jurist Leibniz denkt dabei natürlich auch an die Subsumption eines Rechtsfalls unter eine Rechtsnorm, an das ius distributivum. Daher kommentiert Engelhardt die zitierte Stelle richtig: „Es ist wichtig, an dieser Stelle zu erkennen, daß Leibniz mit der Aufstellung des Begriffs des totum distributivum trotz des Lobes, das er im Vorhergehenden den Nominalisten zollt, sich ganz wesentlich von der nominalistisch-empiristischen Auffassung des Allgemeinen entfernt, wie er sie bei Nizolius vorfindet. Seine Auffassung entspricht durchaus der herrschenden realistischen Ansicht der Schulphilosophie des 17. Jahrhunderts. … Es ist nach Ansicht der Schulphilosophie in jedem Einzelding wirklich eine natura universalis, ein allgemeines Wesen enthalten, das die Grundlage bietet für die Bildung allgemeiner Begriffe durch den Verstand. Dies ist auch Leibnizens Ansicht“.33
Der wissenschaftstheoretische Sinn der Leibnizschen Polemik gegen Nizolius wird im folgenden sogleich klargestellt: „Es ist fürwahr dieser Irrtum des Nizolius nicht geringfügig, es liegt nämlich etwas Wichtiges im Hintergrund. Denn wenn die Allgemeinbegriffe nichts anderes sind als die Sammlung von Einzeldingen, so würde daraus folgen, daß es keine Wissenschaft durch Beweise gibt (was Nizolius auch im Fortgang seines Buches ableitet), sondern nur eine Wissenschaft durch Sammlung von Einzelnem oder durch Induktion. Es werden aber durch dieses Prinzip die Wissenschaften völlig vernichtet, und die Skeptiker haben dann gesiegt“ (E, S. 26). Gerade im Interesse der Sicherung jener Wissenschaft, die sich von der Bindung an Glaubenssätze und Autoritäten gelöst hatte, mußte Leibniz darauf bestehen, über die Zufälligkeit und Ungewißheit bloß induktiver Verallgemeinerungen hinauszukommen. Der bloße Nominalismus und Empirismus reichten so wenig aus wie die platonisierende Wesens- und Formenmetaphysik der mittelalterlichen Scholastik. Aus diesem, schon in den Jugendschriften von Leibniz angelegten Widerspruch der Problemlösungsalternativen zur Erkenntnispraxis erwuchs das Bemühen um die Konstruktion eines darüber hinausführenden Weltmodells, in dem Einheit ein Relationenterminus ist und Einheit und Vielheit als ein reales Verhältnis begriffen werden können.