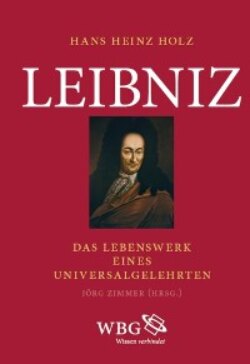Читать книгу Leibniz - Hans Heinz Holz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Die Grundidee der Leibnizschen Philosophie
ОглавлениеAus Leibniz’ späteren Lebensjahren gibt es ein aufschlußreiches Zeugnis über seinen philosophischen Werdegang. In das Jahrhundert der beginnenden Aufklärung, des Rationalismus hineingeboren, sah er sich einer allgemeinen Ablehnung der schulmäßig überlieferten aristotelisch-scholastischen Philosophie gegenüber. Dennoch schien ihm die rein mathematische Physik, die die Natur, das heißt die Materie, auf die ausgedehnte Masse reduzieren wollte, nicht ausreichend, um die Welt zu erklären. Schon in jungen Jahren bedrängte ihn das Problem; im Alter, wenige Jahre vor seinem Tode, schildert er in einem Briefe an seinen Korrespondenzpartner Rémond die Entwicklung seines Systems. Er berichtet:
„Der Schule entwachsen, lernte ich die Moderne kennen, und ich erinnere mich, wie ich als Fünfzehnjähriger in einem Gehölz bei Leipzig mit dem Namen Rosendal spazierenging und darüber nachsann, ob ich an den substantiellen Formen festhalten sollte“ (G III, S. 606). (Leibniz schreibt, mit dem sächsischen Idiom seiner Geburtsstadt, den Namen des noch heute bestehenden idyllischen Rosentals mit einem „weichen“ d – der erste Laut sächsischer Mundart in der Philosophie!).
Da haben wir im durchaus noch unreifen, jugendlichen Denken des angehenden Studenten schon das Grundproblem, das die spätere Philosophie von Leibniz erfüllen und in ihr, von Werk zu Werk auf immer höherem gedanklichem Niveau, ausgearbeitet werden wird. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade in der natürlichen Umgebung jenes reizvollen Haines sich ihm die entscheidende Frage stellt. Von einem plätschernden Bächlein durchzogen, sich in üppig grünenden, blumendurchwirkten Wiesen erstreckend, die von alten, dicht belaubten Bäumen beschattet werden, in denen die Vögel nisten – so ist dieses Rosental wirklich geeignet, dem Menschen vor Augen zu führen, daß die Natur, der Stoff, die Materie nicht tote, unbewegliche, ausgedehnte Masse ist, sondern von einem formgebenden Prinzip durchwaltet wird, dem sie den Reichtum ihrer Formen verdankt. Ein solches formgebendes Prinzip nannte die Scholastik „substantielle Form“. Leibniz’ Fragestellung, intuitiv mit dem Schauen der Natur als Lebensganzheit verbunden, geht also gleich auf den Kern der Sache.
In jenem Brief an Rémond fährt Leibniz dann, die Entwicklung abkürzend, fort: „Schließlich gewann die mechanische Theorie Oberhand und veranlaßte mich, mich mit der Mathematik zu befassen. Mit deren tiefsten Geheimnissen wurde ich aber erst im Umgang mit Herrn Huygens in Paris vertraut. Doch als ich die letzten Gründe der mechanischen Anschauungen und gar die Gesetze der Bewegung suchte, entdeckte ich zu meiner Überraschung, daß es unmöglich sei, sie in der Mathematik zu finden, und daß man zur Metaphysik zurückkehren müsse. Das führte mich zu den Entelechien und vom Stofflichen zum Gestalthaften zurück“ (G III, S. 606).
Man sieht also, wie der Grundzug des Leibnizschen Philosophierens auf den ersten Gedanken der Jugendzeit zurückgreift und ihn nun ins Systematische ausweitet.
Leibniz war wahrlich ein Analytiker von Format. Seine mathematischen Entdeckungen, sein Entwurf einer künstlichen Zeichensprache (der ars combinatoria eingeordnet) beweisen das. Aber über das rein zerlegende Denken setzte er die Einsicht in den Zusammenhang einer Lebensganzheit, die allein mit den Mitteln der Analyse nicht zu erfassen ist. Dialektisch denken (wie wir heute sagen) heißt für ihn: die lebendige Ganzheit der Natur als Wirkungszusammenhang einsehen. So wird ihm zum obersten Grundsatz, daß alles mit allem zusammenhängt, jedes vom anderen mitbedingt ist und nichts in der Welt isoliert betrachtet werden kann. Jedes Ding spiegelt die ganze Welt (repraesentatio mundi). Alles ist eine zusammenwirkende Ganzheit (universelle Harmonie).
Innerstes Prinzip dieser in sich bewegten Einheit ist die Kraft. Darin nimmt Leibniz die weitere Entwicklung der Naturwissenschaften intuitiv vorweg. Die Materie kann für ihn nicht länger mehr als eine rein mechanische, nur dem Trägheitsgesetz unterworfene, ausgedehnte Masse angesehen werden, wie Descartes es mit seiner Lehre von der res extensa (der ausgedehnten Substanz) im Gegensatz zur res cogitans (der ausdehnungslosen Substanz des Denkens) gemeint hatte. Die Einführung der Kraft als metaphysisches Prinzip bedeutet die Überwindung der mechanistischen Naturauffassung und die Entdeckung der dialektischen Selbstbewegtheit der Natur. Leibniz hat das selbst deutlich gesehen:
„Ich war schon sehr tief in das Land der Scholastik eingedrungen, als mich die Mathematik und die modernen Schriftsteller noch als sehr jungen Menschen wieder herausholten. Ihre schöne Art, die Natur mechanisch zu erklären, entzückte mich, und ich verachtete mit Recht die Methode derer, die nur mit Formen oder Vermögen operieren, durch die man nichts lernt. Als ich aber danach versucht hatte, die Prinzipien der Mechanik selbst zu vertiefen, um die Naturgesetze, die die Erfahrung zu erkennen gab, zu begründen, bemerkte ich, daß die bloße Betrachtung einer ausgedehnten Masse nicht genügte und daß man den Begriff der Kraft hinzunehmen mußte, der sehr wohl verständlich zu machen ist, obwohl er ins Gebiet der Metaphysik gehört“ (KS, S. 202).
Die natürliche Materie, die aus energiegeladenen, in ständiger Wirksamkeit begriffenen Teilchen besteht, wird nach dem Vorbild des lebendigen Organismus gedacht. Das Urerlebnis der Ganzheit der lebendigen Natur, jene intuitive Erfahrung, die wir beispielhaft mit dem meditierenden Spaziergang im Rosental in Verbindung bringen können, ist zugleich das Schema-Bild für die Auslegung des Seins überhaupt. Die Welt wird wie ein großer Organismus begriffen, in dem die individuellen selbständigen Zellen zugleich unselbständige Glieder des großen Ganzen sind.
„So gibt es nichts Ödes, nichts Unfruchtbares, nichts Totes im Universum, kein Chaos, keine Verwirrung außer dem Anschein nach; etwa in demselben Sinne, wie es bei einem Teiche scheinen kann, den man in einer gewissen Entfernung betrachtet, in der man sozusagen nur eine verworrene Bewegung und ein Gewimmel von Fischen sieht, ohne die Fische selbst zu unterscheiden“ (KS, S. 470).
Wer denkt dabei nicht an den Eindruck, den der Spaziergänger im Rosental empfangen haben mag?
Nur sehr selten hat Leibniz Nachrichten aus seinem Leben gegeben, die uns Rückschlüsse auf die Antriebe und Verfahrensweisen seines Denkens geben. Auch seine zahlreichen Briefe sind fast immer rein auf die Besprechung von sachlichen Gegenständen gerichtet und meiden peinlich persönliche Bekenntnisse. So gewinnen die wenigen Zeugnisse, die von seiner Denkentwicklung berichten, für den heutigen Leser um so größeren Wert, weil dieser von da aus die individuelle Erfahrung erspüren kann, die dem System zugrundelag. Sagt diese gleichsam psychologische Annäherung auch nichts über die sachliche Bedeutung des Werks, so erleichtert sie doch dem heute an der verstehenden Methode geschulten Leser den Zugang.
Wir haben drei Selbstzeugnisse von Leibniz wiedergegeben, die sich auf seine philosophische Grundidee beziehen. Diese Stellen, eine aus einem Brief und zwei aus systematischen Abhandlungen, vermitteln nicht zufällige biographische Daten, sondern bezeichnen den Einsatzpunkt, von dem her Leibniz seine Metaphysik entwickelte. Sie sind, in dem Zusammenhang des Textes, Hinweise auf das Selbstverständnis des Philosophen, der darin andeutet, auf welches „Konzept“ er seine Weltauslegung zurückbezieht, an welchem „Paradigma“ er sich orientiert. Es ist also gerechtfertigt, wenn wir eine zusammenfassende Darstellung des Leibnizschen Weltbildes der „universellen Harmonie“ mit einer Paraphrase über diese drei autobiographischen Zeugnisse einleiten. Diese ergeben nämlich ein Bild, einen Anschauungsinhalt, der die schwierige, abstrakte Struktur des Leibnizschen Systems einsehbar macht. Leibniz selbst schien es wichtig, das Gesagte immer wieder an Vorstellungen zu verdeutlichen, die einen formalen Sachverhalt imaginativ faßbar machen sollten. In diesem Sinne sind die zitierten Erinnerungen als Reproduktionen der Einbildungskraft zu verstehen, die ein sinnliches Schema wachrufen, welches ein verifizierbares Medium zwischen dem Philosophen und seinem Leser herstellen soll.
Es ist also nicht nur für das „Verstehen“ des Leibnizschen Denkens, sondern auch für den Fortgang der Explikation von Belang, das Schema-Bild richtig zu erfassen, unter dem er seine Grundidee vorstellt. Leibniz liebte an zentralen Punkten seines Denkens den Gebrauch von Vergleichen, Bildern und Gleichnissen, deren Bedeutung oft auf den gleichen Kerngedanken verweist. Man könnte einige metaphorische Grundstrukturen für die Gleichnisse ermitteln, die den Grundzügen seines Systems entsprechen. So etwa, wenn das Uhrengleichnis den Parallelismus von innerer Verfassung der Monade und äußerer Verfassung der Welt veranschaulicht oder wenn das Gleichnis von dem Wanderer, der eine Stadt umschreitet und von verschiedenen Standpunkten aus ihre verschiedenen Ansichten aufnimmt, die Perspektivität der Erkenntnis und die Relativität der Wahrheit deutlich macht. Während solche Gleichnisse aber den abstrakten Gedanken voraussetzen, scheint es bei dem geschilderten Eindruck der organischen Ganzheit eines Vielfältigen in der natürlichen Umgebung des Rosentals umgekehrt: Hier „weckt“ der Eindruck erst den Gedanken. Der Ausbau des Systems am Leitfaden der Strukturidee, die der Idee der Substanz gleichrangig zur Seite gestellt wird, und die daraus resultierende Dialektik von Substanz und Struktur als die Bewegungsform, in der sich die universelle Harmonie oder die Einheit einer Welt von vielen Einzelsubstanzen verwirklicht, hängen eng mit diesem Grundgedanken zusammen.
1 Später entwickelte sich ein häßlicher Prioritätsstreit zwischen Leibniz und Newton um die Erfindung des Infinitesimalkalküls. Beide hatten – unabhängig voneinander und mit verschiedenen Methoden – den Kalkül entwickelt, Newton deutlich vor Leibniz. Jeder warf dem anderen Plagiat vor, die Royal Society entschied, unter dem Einfluß Newtons und seiner Anhänger, gegen Leibniz. Erst spätere Mathematiker und Mathematikhistoriker stellten den Sachverhalt klar. Ein Vergleich der beiden Methoden (Fluxions- und Differenzenrechnung) zeigt, daß ihnen ganz entgegengesetzte metaphysische Voraussetzungen zugrundeliegen.
2 Die eingehende Arbeit von Waltraut Fricke, Leibniz und die englische Sukzession des Hauses Hannover, Hildesheim 1957, kommt zu dem Ergebnis, den Leibnizschen Denkschriften und Einflußnahmen sei kein entscheidender Anteil an der Thronfolge zuzuschreiben. Dieses Urteil scheint sich mir zu sehr auf bloße Aktenbefunde zu gründen, die naturgemäß wenig Hintergrundmaterial liefern. Die Bedeutung, die der Stellung und juristischen Begründung aus der Feder eines so hoch angesehenen Mannes wie Leibniz für die Meinungsbildung in politischen Kreisen zukam, ist m. E. wesentlich höher zu veranschlagen.
3 Ludwig Feuerbach, Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie, in: Ludwig Feuerbach, Gesammelte Werke, hg. v. W. Schuffenhauer, Bd. 3, Berlin 1984, S. 17f. Ludwig Feuerbach war der erste – und mehr als ein Jahrhundert lang der einzige – deutsche Philosoph, der die innere Struktur des Leibnizschen Systems erkannte und rekonstruierte. Vgl. Hans Heinz Holz, Feuerbachs Leibniz-Bild, in: Annalen der internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie – Societas Hegeliana, Bd. II, Köln 1986, S. 120ff.
4 Gerhard Stammler, Leibniz, München 1930, S. 149f.
5 Karl Schlechta, Leibniz als Lehrer und Erzieher, Mainz 1946, S. 6.
6 Dietrich Mahnke, Leibnizens Synthese von Universalmathematik und Individualphysik, Halle 1925, S. 305ff.
7 Für Hegel ist die Geschichte der Philosophie die systematische Entfaltung des Begriffs von der Einheit und Ganzheit der Welt, sodaß das philosophische System, das diese Geschichte in sich umfaßt und expliziert, alle anderen Systeme als Vorstufen und Momente seiner selbst begreifen und sich unterordnen kann. So wird die Einheit des weltanschaulichen Denkens oder der geistigen Gattungsgeschichte der Menschheit von einer Position aus konstruierbar, allerdings um den Preis der Unselbstständigkeit aller anderen Positionen.
8 Dietrich Mahnke, Leibnizens Synthese von Universalmathematik und Individualphysik, S. 316f.
9 Das einzige große philosophische Werk, das Leibniz zu Lebzeiten veröffentlichte, war die Theodizee (1710). Sie hat einen anderen Charakter als die metaphysischen Begründungsschriften. Sie ist keine zusammenhängende Darstellung seines Systems (wenn auch oft als solche mißverstanden), sondern dessen Anwendung auf ein weltanschauliches Problem: Wie nämlich eine universell harmonische Welt das Böse, die Negativität, also den Widerspruch zu sich selbst enthalten könne.
10 Karl Schlechta, Leibniz als Lehrer und Erzieher, S. 10.
11 Zu seinen Projekten bemerkt Leibniz allerdings illusionslos: „Aber leider es gehet mit uns in Manufakturen, Kommerzien, Mitteln, Miliz, Justiz, Regierungsform mehr und mehr zum schlechten, da dann kein Wunder, daß auch Wissenschaften und Künste zu Boden gehen“ (Pol. Schr. II, S. 51).
12 Golo Mann, Das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, in: Golo Mann/Alfred Heuss (Hg.), Propyläenweltgeschichte, Bd. VII, S. 146, Frankfurt a.M./Berlin 1964; TB-Ausgabe 1976.
13 Analog hat Hermann Klenner die Erfahrungen des englischen Bürgerkriegs als emotionalen Hintergrund der englischen Staatsphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts kenntlich gemacht. Vgl. H. Klenner, Mr. Locke beginnt zu publizieren oder das Ende der Revolution, in: John Locke, Bürgerliche Staatsgewalt und Gesellschaft, hg. von H. Klenner, Leipzig 1980, S. 295ff,
14 Elementa iuris naturalis, AA IV/1.
15 Die zahlreichen durch den Leibniz-Gedenktag 1946 inspirierten Veröffentlichungen lassen diese zeitgeschichtliche Affinität spüren.
16 Zum Begriff des Paradigmenwechsels vgl. Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, Chicago 1962; deutsch Frankfurt a.M. 1967. Dazu: Kurt Bayertz (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und wissenschaftliche Revolution, Köln 1981. Ferner: Werner Diederich (Hg.), Theorien der Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt a.M. 1974.
17 Einwendungen gegen Kuhn aus der Sicht eines realistischen Wissenschaftsbegriffs trägt z.B. vor: Ludovico Geymonat, Grundlagen einer realistischen Theorie der Wissenschaft, Köln 1980. Vgl. auch die Diskussionen des 4. Bremer Symposiums für Wissenschaftsgeschichte, in: Manfred Hahn/Hans Jörg Sandkühler, Geschichte als gesetzmäßiger Prozeß, Köln 1982.
18 Zum Einfluß der über Erhard Weigel wirkenden Aristoteles-Überlieferung und des Gassendischen Materialismus auf den jungen Leibniz vgl. Konrad Moll, Der junge Leibniz, Stuttgart-Bad Cannstatt 1978.
19 John Desmond Bernal, Sozialgeschichte der Wissenschaften, Reinbek 1970, S. 465, 464.
20 Die Strömungen von „Rationalismus“ und „Empirismus“ im 17. und 18. Jahrhundert sind Ausdruck dieses methodologischen Widerstreits in der Form ontologischer Systematisierungen.
21 Ludovico Geymonat, Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico, Bd. II, Mailand 1977, S. 138.
22 Diese Entgegensetzung findet sich schon in den frühen Darstellungen der Geschichte der Philosophie, besonders, wo sie kurzgefaßte Übersichten geben: z.B. Wilhelm Gottlieb Tennemann, Grundriß der Geschichte der Philosophie, Leipzig 1812. Der „Grundriß“ ist deutlicher dualistisch als der „große“ Tennemann, Geschichte der Philosophie, Bd. X und XI, Leipzig 1817 und 1819. Hegel wie Schelling entwickeln dagegen in ihren Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie den inneren Zusammenhang von Rationalismus und Empirismus im Denken der Neuzeit.
23 Siehe Ingetrud Pape, Leibniz. Zugang und Deutung aus dem Wahrheitsproblem, Stuttgart 1949.
24 Vgl. Hans Heinz Holz, Was sind und was leisten metaphysische Modelle?, in: Shlomo Avineri u.a., Fortschritt der Aufklärung, Köln 1987, S. 165ff.
25 Ludovico Geymonat, Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico, Bd. II, S. 91ff.
26 Vgl. Kap. 12.
27 Vgl. Heinrich Ropohl, Das Eine und die Welt, Leipzig 1936.
28 Vgl. Bruno Liebrucks, Platons Weg zur Dialektik, Frankfurt a.M. 1949.
29 Vgl. Detlev Pätzold, Einheit und Andersheit, Köln 1981.
30 Marsilius Ficinus, Commentaria in Platonis Sophistam, in: M. B. J. Allan, Ikastes, Berkeley/Oxford 1989, S. 261, 263.
31 Marius Nizolius, Vier Bücher über die wahren Prinzipien und die wahre philosophische Methode, München 1979.
32 Ebd., S. 132
33 Wolf v. Engelhardt, Schöpferische Vernunft, Köln/Münster 21955, S. 419.
34 Vgl. Hans Heinz Holz, Leibniz – die Konstruktion des Kontingenten, in: Klaus Peters/Wolfgang Schmidt/Hans Heinz Holz, Erkenntnisgewißheit und Deduktion, Darmstadt/Neuwied 1975, S. 129ff.
35 Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, daß der metaphysische Gebrauch des Terminus „Gott“ und der religiöse Gebrauch der Glaubensvorstellung „Gott“ bei Leibniz zwar in seiner persönlichen Weltanschauung oft unscharf ineinander übergehen, aber in der strengen philosophischen Systemkonstruktion klar auseinandergehalten werden können.
36 Alle enthalten in KS.
37 Dietrich Mahnke, Leibnizens Synthese von Universalmathematik und Individualphysik, S. 316; vgl. insgesamt S. 313–318.
38 Johann Christoph Gottsched in: Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibnitz, Theodicee, Hannover/Leipzig 1744, S. 140f.
39 Von John Locke sagt er: „Er ist allgemeinverständlicher, während ich gezwungen bin, mitunter etwas mehr akroamatisch und abstrakt zu sein, was für mich, zumal ich in einer lebenden Sprache schreibe, kein Vorteil ist“ (NA, S. IX).