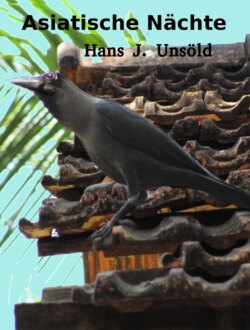Читать книгу Asiatische Nächte - Hans J. Unsoeld - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nicht Barenboim
ОглавлениеAls der Zug über den Brennerpass rollte, überlegte Igor schließlich, wo er denn eigentlich hinfahren wollte. Er hatte eine Fahrkarte nach München gelöst. Das war die Endstation dieses Kurswagens. Doch mehr und mehr machte sich in ihm das Gefühl breit, dass diese Stadt nicht mehr zu seinen Traumzielen gehörte. Zu viel Konsum, besonders von Bier. Für ihn hatte die Welt zur Zeit drei Himmelsrichtungen,- Süden, Osten und Westen. Der Norden, im dem er geboren und aufgewachsen war, fehlte auffällig. Er neigte dazu, diese Himmelsrichtung zu scheuen, hatte aber nur fragwürdige Argumente dafür. Zu kalt, zu windig und zu feucht. Als er auf die Bahngleise blickte, kam ihm noch in den Sinn: ein kulturelles Abstellgleis. Nein,- das durfte er nicht sagen! Er genierte sich bei diesem Gedanken.
Dann lachte er in sich hinein. Ja, in jeder “seiner” Himmelsrichtungen hatte er zwei Traumziele,- insgesamt sechs Städte. Und schon wieder musste er loslachen. Hatten diese etwas mit Sex zu tun? Im Süden waren das Aventurina und Spelunca. Aber dort schienen die Träume schon zu Ende zu sein. Im Osten, so wie er die Welt jetzt sah, waren es Berlin und Odessa. Den Westen vergaß er im Moment.
Warum nicht nach Berlin fahren? In die neu installierte Hauptstadt war etwa die Hälfte seiner Künstlerfreunde umgezogen. Politik und Kunst sind alte Feinde, aber sie brauchen sich auch gegenseitig, schrieben sie. Auch die neu erwachende Kunstszene in Odessa schien etwas mit der veränderten Politik zu tun haben. Warum also nicht seine jüdische Freundin Annabelle aus Odessa, die in Berlin lebte, besuchen?
Seine frühere Unterkunft in einem Hinterhof eines zunehmend von Türken bewohnten Stadtteiles erwies sich als leerstehend, so dass er dort für ein paar Wochen wohnen konnte,- kein Problem. Doch das erneute Zusammensein mit Annabelle erschien ihm problematischer denn je. Er mochte jüdische Frauen sehr gern. Schon vor vielen Jahren hatte er eine bildschöne und erzschlaue junge kleine jüdische Freundin gehabt und abgöttisch geliebt. Diese hatte mit ihm offensichtlich zwar nicht religiöse, aber dennoch erhebliche innere Schwierigkeiten. Ihre Mutter hatte das Konzentrationslager überlebt, was einen prägenden Einfluss auf ihre Kindheit gehabt haben muss. Nur wenige Jahre nach dem glanzvoll bestandenen Abitur siedelte sie eines Tages mehr oder weniger überraschend nach Israel über. Daran zurück zu denken machte ihn auch jetzt noch traurig, auch wenn er verstand, dass das ihrerseits eine wichtige Identitätssuche war.
Annabelle liebte ebenso wie jene frühere Freundin gutes Essen und ganz besonders Sahnekuchen und war ebenso wenig saftiger Liebe im Bett abgeneigt. So trafen sie sich gern nachmittags in einem kleinen Schlemmercafé. Wie Giulia hatte sie eine etwas fülligere Figur, sah jedoch auch blendend aus. Sie kannte Israel trotz ihres höheren Alters nicht. Aber in Gesprächen verteidigte sie dieses Land bei jeder sich ihr bietenden Gelegenheit derart vehement, dass es für ihn wie eine Belastung wurde. Ganz gewiss wollte er einer Auseinandersetzung über dieses Thema nicht ausweichen. Doch jedes Mal verfuhren sich die wechselseitigen Argumente in festen Positionen und nichts bewegte sich. Sie kannte die Geschichte des Staates Israel bis ins letzte Detail, hatte viel darüber gelesen und wünschte sich, dass er dies auch tue. Nur so könne er die aktuelle Situation der Kämpfe zwischen den Israelis und Palästinensern wirklich verstehen. Die historischen Verhältnisse seien viel wichtiger als der Status Quo.
Igor hatte eine Abneigung gegen zu dicke Bücher und ging diesem Studium aus dem Weg, was sie als mangelnde Achtung interpretierte. Heftiger Protest seinerseits! Aber vor allem gab er eben dem Status Quo einen höheren Stellenwert. Anfangs fühlte sich Igor mit seinen Vorstellungen als Deutscher, von dem in der Nachkriegszeit eine demutvolle unterstützende Rolle für Israel wegen des schrecklichen Holocausts als selbstverständlich erwartet wurde, völlig allein mit seinen von der damaligen öffentlichen Meinung abweichenden Gedanken. Dann fand er im Internet zumindest zwei jüdische Freunde, die er zwar persönlich nie kennen lernte. Doch bei ihnen fand er Unterstützung. Das waren die kanadische Schriftstellerin Naomi Klein und der in Argentinien aufgewachsene Dirigent Daniel Barenboim. Beide wurden von vielen Juden wegen ihrer Positionen heftig beschimpft.
Naomi Klein hatte das Scheitern der Friedensverhandlungen in Oslo zwischen Israel und Palästina ziemlich ungewöhnlich kommentiert mit einigen provokanten Bemerkungen. Wegen der für Russland wie eine fast tödliche Schocktherapie wirkenden Einführung des Neoliberalismus seien viele Juden aus der früheren Sowjetunion nach Israel gekommen. Nicht zuletzt deswegen, weil diese nie wirklich erlebt hatten, was legale Verhältnisse sind, zogen sie ohne große Bedenken in die neuen Siedlungen im Jordanland. Unter diesen Leuten gab es viele brillante Fachleute. Auf die Palästinenser als billige Arbeitskräfte konnte Israel nun häufig verzichten, was den wirtschaftlichen Ruin dieser Gegend beschleunigte.
Umgekehrt war Naomi Klein durchaus klar, dass Arafat kein Engel war und heftig dazu neigte, Geld in die eigene Tasche zu stecken. Doch die Kompensationen, die ihm damals in Oslo auf dem politischen Parkett für das verlorene Land angeboten wurden, waren so gering, dass er damit nicht nach Hause zurückkommen konnte. Israel hatte so, wie es die USA in Afghanistan und bereits 200 Jahre zuvor im eigenen Land getan hatten, eine fragile Nomadenkultur ausgelöscht und brüstete sich nun damit, dort habe es ja überhaupt keinen Staat gegeben. Ihre eigene Schuld überspielten die beiden Länder im Duett mit der scheinbar neuen Idee, man müsse gegen den Terror kämpfen.
Igor hatte die Terror-Bombardierugen der deutschen Zivilbevölkerung im letzten Weltkrieg als Kind knapp überlebt. Inzwischen hatte er auch erfahren, dass Nomadenleben zwar nicht mehr sehr zeitgemäß, aber in manchen Aspekten dennoch durchaus vorzuziehen ist. Mit dem letzten Wort „ist“ am Ende des letzten Satzes nahm er trotz seiner humanistischen Schulbildung hin, dass dieses einen Verstoß bedeutete gegen die „consecutio temporum“, gegen die in seiner Jugend gelernten logischen zeitlichen und zunächst einmal in der Sprache grammatisch niedergelegten Zusammenhänge.
Auch folgende weitere Äußerungen von Naomi Klein akzeptierte Igor. In Israel leben die Reichen wie in einer mittelalterlichen Feudalgesellschaft in einer Festung. Doch jetzt ist das ganze Land die Festung. Noch schlimmer als damals werden die Armen, die Palästinenser, sogar an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert. Die Folge ist, dass denen nichts anderes übrig bleibt, als entweder die üble Situation zu schlucken oder aber wirklich zu Terroristen zu werden. Ein kleiner Teil der Bevölkerung tut letzteres tatsächlich, was de facto einen Krieg bedeutet, bei dem die Genfer Konventionen genauso wenig wie bei jedem anderen Angriff auf eine Zivilbevölkerung eingehalten werden.
Der fehlenden Trennung zwischen ziviler und militärischer Bevölkerung versuchen die USA und Israel nun mit zielgenauen hochtechnischen Waffeneinsätzen zu begegnen. Dokumentationen, wie wenig das in der Praxis möglich ist, gefallen ihnen gar nicht. Wie schrecklich selbst überlebende und nicht verstümmelte Kinder nach solchen Angriffen lebenslänglich traumatisiert sind, wird aus dem Bewusstsein verbannt.
Solche Argumente gefielen auch Annabelle überhaupt nicht. Schon früher hatten solche Gespräche dazu geführt, dass sie und Igor sich tage- und wochenlang trotz aller Liebe aus dem Wege gingen. Wenn Igor in Gesprächen Daniel Barenboim nannte, wurde es vollends schwierig. Er liebte dessen beschwingte und hintergründige Aufnahmen von argentinischen Tangos. Voll und ganz teilte er dessen Ansicht, dass dieser Nahost-Konflikt von Israel nicht militärisch gelöst werden kann. Auf der anderen Seite ist die fortgesetzte Gewaltanwendung durch die Hamas genauso sinnlos und zu verdammen. Der Kern des Problems besteht darin, dass beide Völker zutiefst von ihrem Recht überzeugt sind, auf demselben Stück Land leben zu dürfen. Also müssen sie lernen, dass gemeinsam zu tun.
Die Israelis und die Palästinenser sind beide gleichermaßen gespalten in zwei untereinander völlig verschiedene Bevölkerungsteile,- in Israel als Falken und Tauben bezeichnet, auf der anderen Seite durch Hamas und Al-Fatah angeführt. Die Israelis haben einen ähnlichen großen Fehler wie die Amerikaner in Afghanistan gemacht. Während letztere dort zunächst die Taliban unterstützten, um die Position der Russen zu schwächen, haben die Israelis zunächst die Hamas unterstützt, um Arafat zu schwächen. Versucht man aber jetzt, diese beiden Organisationen gewaltsam zu zerschlagen, so werden sicher andere noch gewaltbereitere und grausamere Vereinigungen an ihre Stelle treten.
Daniel Barenboim ist mit Nachdruck dafür eingetreten, dass beide Völker gleiche Rechte haben und dass beide Seiten behutsam lernen müssen, miteinander zu leben. Dafür hat er sich persönlich mit Aufführungen des von ihm geleiteten Jugendorchesters unter ständiger Kontaktsuche eingesetzt. Viele seiner Schritte sind diffamiert worden, ganz besonders, als er das Preisgeld eines von ihm erhaltenen Friedenspreises zur Erforschung der arabischen Musik gespendet hat.
Annabelle sah aufgrund der schrecklichen Erfahrungen ihrer Familie bei der Judenverfolgung,- es kamen zwölf Angehörige ums Leben,- im wesentlichen nur die grausamen und gewiss sehr zu verdammenden Attacken der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung. Doch selbst, nachdem sie mit Igor den israelischen Film „Waltz with Bashir“ angesehen hatte, in welchem das schreckliche wahllose Töten zur angeblichen Selbstverteidigung gezeigt wird, wollte sie nicht anerkennen, dass jetzt auch Israel schweres Unrecht beging. Die furchtbaren Vergeltungsschläge auf Gaza am Jahreswechsel 2008/2009 verstärkten dieses Gefühl bei Igor.
In dieser Zeit dachte er sowohl über ihre Vergangenheit als auch über seine eigene Zukunft nach. Er wollte ihre Heimat Odessa näher kennen lernen. Doch sie zögerte, mit ihm dorthin zu fahren. Sein Gefühl war, dass sie sich dort bei ihren früheren Freunden und Bekannten nicht mit einem Deutschen sehen lassen wollte. So flog Igor zu Frühlingsbeginn ein zweites Mal allein in die ihm schon vertraute Stadt. Doch es wurde keine Spurensuche.
Im Stillen spielte er auch mit dem Gedanken, ob er dort längerfristig leben könnte. Seit seiner Pensionierung stand ihm nur noch eine sehr kleine Rente zu. Er hatte früher nie ausreichend für die Versicherung eingezahlt, weil er damals genügend Geld für seinen Sohn haben und mit ihm reisen wollte. Schon zu jener Zeit und genauso jetzt wäre es für ihn ein erniedrigender Graus gewesen, beim Sozialamt Unterstützung zu beantragen. Allein bereits die Idee, dass die Bürokraten in seinem Privatleben herum schnüffeln, erregte seinen tiefen Widerwillen. Was diese die-Berechtigung-prüfen nannten, hielt er für etwas Abscheuliches.
In Odessa war der Schnee gerade getaut. Er fand Unterkunft bei einer jungen Familie mit einem aufgeweckten zwölfjährigen Kind, wo der Vater gerade das Weite gesucht hatte. Weder hier noch in dem Kulturzentrum, wo er bei seiner vorigen Reise für Gespräche sehr offene junge Leute kennen gelernt hatte, ergaben sich diesmal Momente, die von Interesse gewesen wären. Anders als im Sommer, wenn die Gegend in Wärme und bunte Farben getaucht ist, lastete jetzt ein kaltes Grau auf der Stadt, das alles zu ersticken schien. Er fragte sich, ob das vielleicht an seiner eigenen Stimmung lag, die gewiss nicht die beste war.
Für die dortigen Menschen schien das eine zu dieser Jahreszeit bekannte Situation zu sein. Zu ihrer Bekämpfung hat sich der 1. April als Fest des Lachens und inzwischen als großes Stadtfest etabliert. Schon am frühen Morgen und bis spät in die Nacht hinein zogen singende und tanzende Gruppen von jungen und auch nicht mehr ganz so jungen Leuten durch die Stadt und versprühten mit umwerfendem Temperament ihre auf Spaß gesonnene Energie. Sowohl die Musikgruppen als auch die Tanzensembles hatten an zahlreichen Stellen höchstes Niveau,- Weltklasse, dachte Igor, unglaublich gut. Lange nicht mehr hatte er so exzellente Musiker gehört, sowohl mit klassischer als mit Popmusik, und an einigen Stellen gab es auch echte jüdische Klezmer-Musik. Ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung hatte unter politischem und psychologischem Druck in den vergangenen, von steigendem Nationalismus geprägten Jahrzehnten die Stadt verlassen. Doch langsam kamen wenigstens einige von ihnen wieder zurück.
Dennoch fühlte sich Igor hier, obwohl er Russisch sprach, ziemlich verlassen und wurde von den Menschen offensichtlich auch wie ein Fremder behandelt. Generationen lang war den Menschen hier beigebracht worden, Fremde mit Misstrauen zu betrachten und ihnen aus dem Wege zu gehen, weil jeder ja ein Spion sein könnte. Diese Mentalität ließ sich nun nicht wieder so schnell ausrotten.
Sein junger Schwarm von den Sommerferien, die er hier zuvor verbracht hatte, war inzwischen von einem festen Partner mit Beschlag belegt und trug sich wohl mit Heiratsabsichten. Eine andere, an sich nette und liebe etwas ältere Bekannte hätte ihn gewiss gern in zweiter Ehe geheiratet, wonach ihm der Sinn jedoch sehr wenig stand.
Viel mehr als all dieses frustrierte ihn die Stagnation in der Entwicklung dieser Stadt. Man stritt sich, ob Russisch oder Ukrainisch die offizielle Sprache sein solle. Wie gut, dass in Deutschland die Auseinandersetzungen um Bayerisch oder Plattdeutsch entschärft waren! Die Stadt erstickte im Verkehrschaos. Odessa breitet sich in einem schmalen Küstenstreifen über eine weite Strecke aus. Igor sprang in die Augen, dass hier eine Schnellbahn von Nöten war, die die weit auseinander liegenden Stadtteile ohne schreckliche Staus im Zentrum gut miteinander verband. Doch Rückfragen zeigten ihm, dass weder die verantwortlichen Lokalpolitiker noch die deutsche Siemens-AG, für welche ein solcher Bau ein gefundenes Fressen hätte sein können, zu diesem Zeitpunkt ein großes Interesse daran hatten. Hinter vorgehaltener Hand hörte er immer nur eine Bemerkung: Oh diese Korruption hier!
Auf dem Heimflug in einer ungarischen Maschine schienen Erfahrungen mit der Korruption das Hauptthema der Unterhaltung zwischen den Passagieren zu sein. So gern Igor das Leben in Odessa gemocht hatte, so deutlich war ihm jetzt, dass für ihn dort kein Platz war. Obendrein hörte er, wie gefährlich es sein konnte, in das Gehege solch korrupter Kreise zu kommen. Er wollte nicht, dass ihm auch die Gurgel durchgeschnitten würde.
Sollte er sich jetzt in Berlin eine langfristige Unterkunft in der Nähe von Annabelle suchen? Er wollte zu ihr stehen und versuchte das tatsächlich. Doch das stellte sich schwieriger als gedacht heraus. Dort hatte gerade das neue Semester an den Hochschulen begonnen. Tausende von Studenten suchten in Konkurrenz zu ihm eine preiswerte Wohnmöglichkeit. Wo er sich auch bewarb oder zu Besichtigungsterminen kam, fand er sich von bisweilen bis zu fünfzig meist jungen Mitbewerbern umringt.
Seine Probleme besprach er am Telefon mit guten Freunden. „Warum gehst du nicht mal eine Weile nach Indien? Du kennst Asien überhaupt nicht. Schon manch einer oder eine hat dort beim meditieren eine völlig unerwartete Lösungsmöglichkeit gefunden“, bekam er zu hören. Das fiel bei ihm schnell auf fruchtbaren Boden. Seine Sachen verstaute er mit einem überaus hilfreichen lieben Freund in einer Garage und saß nach wenigen Wochen in einem Flugzeug nach Goa. Er fühlte, dass es richtig war, weiteren Diskussionen mit Annabelle und auch mit seinem verständlicherweise davon nicht sehr begeisterten Nachwuchs aus dem Wege zu gehen. Erschöpft durch die Vorbereitungen zur Abreise nahm er das Geschrei von Kindern auf dem Flug kaum wahr.
Als er aus dem mit über 300 Passagieren voll gepackten Flugzeug über eine angestellte Aluminiumtreppe noch bei Dunkelheit morgens den indischen Boden betrat, schlug ihm eine dampfende, voll geheimnisvoller Ingredienzien erfüllte Luft entgegen. Im ersten Moment dachte er, dass er in ihr kaum längere Zeit atmen könne. Kaum betritt er die Abfertigungshalle mit mehreren Schlangen grau wirkender Deutscher vor ihm, ist dieser Eindruck auch schon wieder wie weggewischt und fast vergessen. Lauter grün gekleidetes indisches Personal mit gespenstisch wirkendem Gaze-Mundschutz huscht herum, verteilt mit strenger Miene lange englische Fragebögen, die frühere Kontaktmöglichkeiten der Passagiere zur Schweinegrippe betreffen, und geleitet diese übermüdete Schlange an einem technisch hochmodernen Thermoscanner vorbei, den die meisten gar nicht bewusst wahrzunehmen scheinen. Wer eine um ein paar Zehntelgrad erhöhte Körpertemperatur hat, wird ausgesondert. Es sind nur wenige, die gesondert überprüft werden. Der einzige, schon in die Jahre gekommene und ebenso grau wie die meisten übrigen Reisenden wirkende bärtige Hippie an Bord befindet sich unter ihnen. Der Bart verhindert wohl eine normale Wärmeabstrahlung. Er macht keinen sehr erleuchteten Eindruck.
Nachdem der Reisepass mit allen erforderlichen Stempeln geschmückt ist, wird er in die sich auf ihn stürzende Menge der indischen Taxifahrer entlassen. Doch was auf den ersten Blick sehr chaotisch erscheint, entpuppt sich schnell als ein durchaus geordnetes, gut funktionierendes und dabei sehr menschliches System. Für 700 Rupies, den aktuellen Gegenwert von genau 10 Euro, für die er aber am Flughafen nur 600 Rupies erhält, bekommt er einen Auftragsschein, der die 45-km-Fahrt nach Candolim gewährleistet. Ein relativ neues, aber eher an eine Blechschachtel erinnerndes Taxi mit einem sympathischen Fahrer ordnet sich in den indischen Linksverkehr ein und verschwindet mit ihm in der Dunkelheit. Langsam wird es hell. Welche Mengen von heiligen, ziemlich mageren Kühen morgens auf den Landstraßen stehen und nicht das geringste bisschen weichen, wenn sich ihnen ein Auto nähert! Sicher ist er nicht der erste, dem erzählt wird, wie schon Passagiere wegen der Kühe ihren Flug versäumt haben.
Langsam taucht das asiatische Land aus der Dunkelheit auf und zeigt eine ihm aus Filmen bekannte Kulisse von nur selten zweigeschossigen Gebäuden. Manch eines schaut wie ein kleiner Tempel aus, manch ein anderes aber auch wie eine Mülldeponie. Wieder und wieder zwingen heilige Kühe die Autos zum Anhalten oder sich mehr oder weniger langsam an ihnen vorbei zu bewegen. Auch wenn es schnell fährt und sie fast streift, lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Über zwei lange Brücken führt die Straße, wo ganze Rudel von blauen Hausbooten zu sehen sind, auf denen gerade das morgendliche Leben erwacht.
In weitgehend ausgebuchten Candolim wird ihm als einziges ein Zimmer angeboten, das zwar statt auf den verheißenen Strand auf einen Innenhof mit all seinen Geräuschen schaut. Aber als vier Meter messender Kubus mit einer kolonialen dunklen Holzdecke, die an ein kleines Tempeldach erinnert, hat es auch seinen Reiz. Von dem scheinbar faul in einen Sessel gefläzten Verwalter in mittleren Jahren wird er fast wirsch vor das Problem gestellt, sofort genau angeben zu sollen, wie lange er dort bleiben wolle. Es gäbe keine Verlängerung. Leicht verwirrt sagt er: „Eine Woche.“ Und schon ist die Sache abgemacht.
Er hatte in Deutschland gehört, dass es hier im wesentlichen drei Gruppen von Fremden gäbe: erstens Sannyasins, zweitens Freaks, und drittens Leute, die Drogen nicht abgeneigt sind. Keinen einzigen von all diesen traf er jetzt. Neben der recht dominanten Gruppe der Russen gab es mehrere welterfahrene Engländer, zu denen sich gern vereinzelte gebildete Goaner gesellten,- unter ihnen auch ein Wissenschaftler, der aufgrund seines Studiums fließend Deutsch sprach,- und eben deutsche Touristen. Das war der kleine, bunt gekleidete, eher schweigsame und sehr an Kultur interessierte Teil unter letzteren, nicht die graue, pausenlos plappernde Masse, die auf seinem Flug vorgeherrscht hatte.
Dann umgekleidet und hinunter zum Meer. Der Sand war bereits so heiß, dass man nur dort auf ihm gehen konnte, wo er feucht war. Gibt es hier Haie? Nur weit draußen, sagte man, also in Küstennähe bleiben; dann ist es absolut ungefährlich. Am Horizont sind lange Reihen von großen Schiffen zu sehen, die sich kaum zu bewegen scheinen.
Die Wellenhöhe steigert sich bisweilen und nimmt dann nach wenigen Minuten wieder ab. Als sie kleiner sind, läuft er ins Wasser,- quasi die ideale Temperatur, aber enorm salzig. Doch kaum steigert sich die Wellenhöhe wieder, reißen sie ihn fast um. Im tieferen Wasser spürt man nicht mehr viel davon. Wo sich die Wellen brechen, ist der Grund wie eine Berg- und Talbahn und das Gehen nicht einfach. All dies braucht am Anfang viel Kraft. Zunächst nur einmal täglich schwimmen, langsam lernen zu relaxen!
Spätere Gänge führen zur Rückseite aus dem Haus. Ein völlig anderes Lokal mit bunten Lampen und leiser westlicher Hintergrundmusik, aber ebenfalls mit Bastmatten gedeckt, scheint eher der Treffpunkt der jüngeren Generation zu sein. Hier kommen die Gäste auf Motorrollern bis ins Lokal hinein. Zwei junge Russinnen, auch mit Motorroller, scharen viele junge Goaner um sich mit ihren Versuchen, etwas Kónkani, die hiesige Sprache lernen zu wollen. Die Goaner haben sich schlauerweise zur Wahrung ihrer Identität eine eigene Sprache zugelegt, in welche sowohl andere Inder als auch die Fremden aus dem sogenannten Westen nur schwer, meist gar nicht eindringen. Die einzigen, denen das gelungen ist, sind die Katholiken. Diese haben sich hier deshalb auch mit besonderer Hartnäckigkeit festgesetzt.
Die indische Welt ist nicht einfach,- eher verwirrend. Schichten von Kolonialismus, Nationalismus und Tourismus überlagern und vermischen sich. In Goa prallen Ost und West aufeinander. Die Portugiesen haben das Land erobert und zu ihrer Kolonie gemacht. Die Katholiken haben sodann das Innenleben der hiesigen Menschen mit Beschlag belegt und geschickt den aufkeimenden Nationalismus für ihre Ziele genutzt. In einer dritten Tsunami-Welle sind die Touristen über das Land gespült worden und „verwöhnen“ es mit Geld.
Igor spürte bald, vor welche Wahl er hier gestellt war. Entweder die Suche nach sich selbst,- auf den inneren Weg gehen, sich eine schöne Umgebung aufbauen, Wurzeln schlagen, meditieren und bereit sein zu empfangen, wer kommen mag. Im allgemeinen werden das Menschen sein, die einem ähnlich sind,- in Alter, Geschlecht, geistiger Gesinnung, Sprache und Präferenzen.
Oder aber die Suche nach der äußeren Welt, hinausgehen in andere Länder, andere Lebensbereiche, Sprachen lernen, leben wie ein genügsamer Nomade, und selber die Menschen aufsuchen. Das werden vorzugsweise Menschen sein, die sehr gegensätzlich zu ihm selbst sind,- junge Menschen, Frauen, Ausländer. Naturwissenschaftler und Künstler werden sich gegenseitig suchen, fremdes Verhalten wird anziehen und nicht abstoßen.
So sitzt er also in den frühen Morgenstunden in Goa vor seinem Laptop und schreibt wie eine Meditation, geht dann aber zum Strand und stürzt sich als einer der ersten dort in das salzige Wasser. Indische Frauen in wehenden bunten Gewändern flanieren am Ufer entlang. Mit ihnen scheint es nicht die geringsten Berührungspunkte zu geben. Der einzige Weg zu ihnen führt über eine Familie und einen Heiratsantrag.
Es wimmelte hier von Russen. Wie auch in Deutschland gab es wenigstens zwei verschiedene Gruppen unter ihnen,- einmal die völlig offenen, kulturell interessierten Leute mit relativ wenig Geld, und andererseits die reichen blasierten, eigentlich immer paarweise mit einer sehr jungen, bisweilen sogar minderjährigen Partnerin erscheinenden Geschäftsmänner, die keinerlei Kontakt mit anderen Gästen suchten. Am Strand trifft er auf eine hübsche ebenfalls russische Jüdin mit einer viel kleineren Freundin. Letztere erinnerte ihn faszinierend an eine Bekanntschaft in Spanien.
Um die Jüdin kennen zu lernen, müsste er eine Mission haben. Wie Barenboim? - kommt ihm in den Sinn. Wie wenig Gutes Missionare schaffen, kann man in Goa sehen. Missionare haben hier Frieden bringen wollen, doch all die Hindu-Tempel zerstört. So gern er Barenboims Musik und auch jüdische Frauen mochte, hier fühlte er jetzt, dass das nicht sein Weg war. Was dann? War es überhaupt nicht der Osten? Sicher nicht diese indische Mixtur von Kolonialismus, Nationalismus und Tourismus. Vielleicht doch der Westen, den er so sehr in sich verdrängt hatte? Er schaute sich wieder die kleine Frau an, die ihn so sehr an seine spanische Liebschaft erinnerte. Diese Frau schien keinerlei Zusammenhang mit dem Land hier zu haben. War es jenes Land oder die dortige Kultur, die ihn interessierte? Etwa die maurische Kultur,- das krasse Gegenteil der jüdischen Kultur?