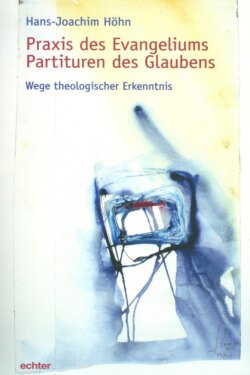Читать книгу Praxis des Evangeliums. Partituren des Glaubens - Hans-Joachim Höhn - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Religiöse Vertikalorientierungen:
Nach Höherem streben – Gott finden?
ОглавлениеGibt man etwas auf die Selbstdeutungen des Menschen, so sieht er sich auf einem Aufstiegsweg – und als Emporkömmling. „Griechischer Etymologie zufolge ist der Mensch der Aufrechte. Sein Name anthropos stammt vom Verb anatrepein: etwas in die Höhe bringen, emporheben“14, etwas aus der Waagrechten in die Senkrechte versetzen. Das Selbstverständnis des Menschen scheint sich ebenfalls an der Vertikalachse auszurichten: Menschen sind Aufsteiger – Wesen, die hoch hinauswollen und obenauf sein wollen. Erst wenn sie eine Höchst- oder Bestform erreichen, sind sie zufrieden. Um nach oben zu kommen, muss man sich auf die Hinterbeine stellen. Erst wer auf eigenen Füßen steht, hat sich selbständig gemacht (und ist ein Autostatiker). Um diese Stellung zu behalten, muss man sich behaupten. Dazu muss man den eigenen Kopf durchsetzen. Der Kopf ist jene Region, die den Menschen im Ganzen repräsentiert. Worauf es ankommt, muss man daher im Kopf haben. Von hier aus gewinnt man Übersicht und Eigenstand. Darum ergeht der kategorische Imperativ „Kopf hoch!“. Wer ihn hängen lässt, setzt aufs Spiel, worin die Griechen die Besonderheit des Menschen sehen: die Autokephalie (Selbstbehauptung). Und der aufrechte Gang, der für den Menschen nicht nur ein anatomisches Faktum, sondern ein Zeichen seiner privilegierten Stellung im Kosmos ist, verlangt ebenfalls, dass er erhobenen Hauptes auftritt.15
Der Mensch muss die Vertikalbewegung seiner Existenz nicht bei sich enden lassen. Menschen können den Kopf in den Nacken werfen und den Blick zu dem weitergehen lassen, was sich über sie erhebt. Was oben ist, muss aber noch nicht das Höchste sein. Das Endziel einer Aufwärtsbewegung ist erst erreicht, wenn man ankommt beim höchsten Gut, über das hinaus Höheres nicht gedacht werden kann, d. h. beim schlechthin Erhabenen, beim Allerhöchsten, beim Göttlichen. Das Projekt der Religion besteht somit darin, die Welt als das zu Transzendierende und den Menschen als Transzendierenden zu verstehen. Die religiöse Semantik und Logik folgt dann ebenfalls der Struktur der Vertikalen: Man muss sich nach dem Höchsten ausstrecken, aber wird es nicht in Griff kriegen, wenn man nicht von ihm ergriffen wird. Wenn es etwas Höchstes gibt, kann es nicht in dem gefunden werden, was mit uns ist oder unter uns ergreifbar und begreifbar ist. All dies bleibt überbietbar. Das unüberbietbar Höchste muss über allem sein. Als Unbedingtes muß es jenseits des Bedingten gesucht werden. Wenn es einen Gott gibt, kann er nur jenseits des Endlichen gefunden werden. Der religiöse Lebensweg muss sich daher als Überstieg des Endlichen und Bedingten und als Aufstieg zum Unendlichen und Unbedingten realisieren.
Für diesen Auf- oder Überstieg stehen in modernen Gesellschaften unterschiedliche Routen zur Verfügung. Aber es ist keineswegs ausgemacht, dass alle auf denselben Gipfel führen. Moderne Gesellschaften sind davon geprägt, dass es in ihnen Religion nur noch im Plural gibt. Vielleicht bilden sie gemeinsam ein Gebirge. Aber nicht jeder Gipfel bietet den gleichen Ausblick. Dies gilt auch für das religiöse Grundwort, das sich eigentlich gegen eine Vervielfältigung wehrt: Gott. Seit geraumer Zeit werden in religionssoziologischen Erhebungen zur Gottesfrage höchst unterschiedliche Füllungen dieses Begriffs erhoben.16 Konsens scheint allenfalls darüber zu bestehen, dass damit eine vom Menschen unverfügbare und unüberbietbare Wirklichkeit benannt werden soll, die ihn unbedingt angeht und der gegenüber der Mensch sich nichts auszubedingen vermag. Dabei gilt etwa als „Gott / göttlich“ ein ewig gültiges Gesetz (nach Art des Karma oder Yin / Yang), nach dem sich alles kosmische Geschehen richtet und dem gegenüber der Mensch auch nur ein „Fall“ ist, in dem eine Verfügung oder Regel dieses Gesetzes zur Anwendung kommt. „Gott / göttlich“ ist für andere Menschen eine (Ur)Energie (nach Art des Chi), die alles durchströmt und für die man sich öffnen kann, wenn man alle inneren Blockaden löst. Bisweilen wird die Bezeichnung „Gott / göttlich“ auch an die Natur, an die Evolution oder an die Selbstorganisationsdynamik des Kosmos als das unüberbietbar Größte und alles Bestimmende vergeben.
Sämtliche Beziehungen des Menschen zu diesen Größen sind durch Asymmetrien gekennzeichnet. Die Momente der Unbedingtheit und Unüberbietbarkeit kommen jeweils nur dem Gegenüber des Menschen zu – nicht dem Menschen selbst und auch nicht seiner Beziehung zu diesem Gegenüber. Wenn nun der Vollzug des Glaubens das Aus-sein auf eine Wirklichkeit ist, die dem Menschen einen existenziell verlässlichen Halt gibt, um es mit dem Leben und dem Sterben aufnehmen zu können, kommt er dann bei den genannten Größen ans Ziel? Entdeckt der Mensch hier wirklich eine Beziehung, die es ihm ermöglicht, zu sich selbst stehen und anderen beistehen zu können? Oder wird ihm hierbei das Wissen um seine Hinfälligkeit und Minderwertigkeit nur noch einmal gespiegelt oder verdoppelt?
Die skizzierten Spielarten menschlichen Gegenüberseins zu einer absoluten Wirklichkeit (qua numinosem Gesetz, kosmischer Energie oder „natura semper maior“) relativieren das Dasein des Menschen bzw. machen ihm und seinem Dasein erneut seine bleibende Relativität bewusst. Alle Erfahrungen, die man im Gegenübersein zu diesen unbedingten und unüberbietbaren Größen macht, sind stets auch Erfahrungen der bleibenden eigenen Vergänglichkeit, Geringfügigkeit und Unterlegenheit. Gegenüber einer höheren Macht kann dem Menschen letztlich nur seine eigene Ohnmacht oder Machtlosigkeit aufgehen. Gegenüber der Natur ist er bestenfalls Teil eines größeren Ganzen; gegenüber einem höchsten Wert kann ihm nur seine eigene Minderwertigkeit bewusst werden.
Anders verhielte es sich, wenn der Mensch von sich aus bereits in der Sphäre der Unbedingtheit existieren würde – und wenn ihm diese Sphäre im Bedingten erschlossen werden könnte. Dabei müsste dem Menschen aufgehen, dass es eine unbedingte und unüberbietbare Wirklichkeit gibt, als deren Gegenüber er sich selbst unbedingt bejahen, frei selbst bestimmen und unverzweckt wertschätzen kann. Damit dies denkbar und erfahrbar sein kann, müsste auch für die Beziehung zu diesem Gegenüber gelten, dass sie die Merkmale der Freiheit und Unbedingtheit, der Wertschätzung und Unverzweckbarkeit aufweist.
Wenn dieser Gedanke sich nicht im Wunschdenken erschöpfen soll, müsste es Unbedingtheitserfahrungen geben, die dem Menschen eine Beziehung (zu Gott) offenbaren, die ihn in seiner Freiheit und Würde unbedingt anerkennt. Nur diese Beziehung wäre ihrerseits unüberbietbar. Und nur in ihr könnte sich der Mensch unbedingt geborgen wissen. Aber wie kann man sich auf einen Weg machen, der solche Erfahrungen ermöglicht? Wie muss ein Mensch vorgehen, damit ihm eine solche Gewissheit aufgeht?
Von den zahlreichen Beschreibungen eines solchen religiösen Erkenntnisweges erzielt seit etlichen Jahren die „via mystica“ besondere Aufmerksamkeit.17 Dieser Weg kann in zwei Richtungen beschritten werden und entweder in die „Mystik der Versenkung“ oder in die „Mystik des Überstiegs“ führen.18 Gemeinsam ist ihnen die Überzeugung, dass nur die Abwendung von allem Endlichen, Bedingten und Zeitlichen den Blick öffnen kann auf das Unendliche, Unbedingte und Ewige. Wer die Richtung der Entsicherung, der Preisgabe und des Loslassens einschlägt, wer alles aus der Hand gibt und selbst haltlos wird, dem wird in Aussicht gestellt, die Erfahrung des Gehaltenseins vom Unfassbaren machen zu können: Nur wo man nichts mehr ergreift und erfasst, kann man sich ergreifen lassen vom Unbegreifbaren. Auf dem Weg der Abgeschiedenheit von allem Äußerlichen, in der Selbstversenkung, im Abstieg in sein leer geräumtes Inneres soll der Suchende zu jenem „Nullpunkt“ gelangen, in dem die Fluchtlinien seines Daseins zusammenlaufen und wo Ende und Neubeginn ineinanderliegen. Wer dagegen die Richtung des Auf- und Überstiegs wählt, muss alles Endliche und Bedingte hinter sich lassen und überwinden, um dahin zu gelangen, was höher ist als alles, was im Bedingten erklommen werden kann. Das Unbedingte ist nur im Modus des Überbietens alles Bedingten erreichbar; zum Erhabenen gelangt nur, wer sich über das Unerhebliche hinwegsetzt und sich der Anziehungskraft einer höheren Macht überlässt.
In zahlreichen Misch- und Zwischenformen werden solche Exerzitien auch im christlichen Kontext angeboten. Die Elemente der Askese, der Meditation und Kontemplation haben zweifellos im Christentum ihre Berechtigung,19 wenngleich das Evangelium Jesu ihnen nur für gewisse Abschnitte des religiösen Weges Bedeutung zumisst. Auch von Jesus wird berichtet, dass er in diese Wüste gegangen ist, dass er immer wieder die Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit suchte. Auch von ihm werden Bergbesteigungen und Gipfelerfahrungen erzählt. Aber sie blieben Durchgangsstationen, bildeten provokative Unterbrechungen und markierten instruktive Auszeiten. Jesus von Nazareth taugt nicht als spiritueller Meister, der die Mystik der Selbstversenkung oder des Überstiegs in weltferne Sphären lehrt.20 Er setzt andere Prioritäten, die auf die Hinwendung zum Entgegenkommen Gottes zielen.21 Ohnehin sind die mystischen Auf- und Abstiegswege für sich genommen sehr riskant: Man kann sich auf den Wegen in die Tiefe der eigenen Psyche auch in der eigenen inneren Leere verloren gehen. Und der Selbstüberstieg ins Erhabene kann im metaphysischen Niemandsland enden.
Den Mystik-Boom der letzten Jahre kennzeichnet eine zweifellos berechtigte institutionenkritische und subjektzentrierte Wendung religiöser Praxis, die zahlreiche institutionelle Verknöcherungen und dogmatische Verkrustungen des Christentums aufgebrochen hat. Gleichwohl entspricht er auch einem durchaus zeitgeistigen Trend, eine individualistische Lebenskunst der „Selbstsorge“ in den Bereich der individuellen Heilssorge zu verlängern. Solche „Mystiker“ sind in der Lage, sich die Not der Welt und die Hilflosigkeit ihrer Mitmenschen mit spirituellen Mitteln vom Halse zu halten. Sie haben dabei kein schlechtes Gewissen.
Gegen diesen Trend zum Heilsindividualismus stehen die Bemühungen, Kraft aus dem Inneren zu schöpfen, um sich im Sinn des Evangeliums in den äußeren Angelegenheiten sozialen und politischen Engagements bewähren zu können.22 Sie geben der Versuchung zur Reduktion des Evangeliums auf einen mystischen oder einen politischen Kern nicht nach. Derartige Verkürzungen aber tauchen immer wieder auf. Und nicht selten suchen sie sich Flankenschutz bei prominenten Theologen. Am häufigsten bedient man sich dabei eines Diktums von Karl Rahner: „Der Fromme, der Christ der Zukunft wird ein ‚Mystiker‘ sein, einer, der etwas ‚erfahren‘ hat, oder er wird nicht mehr sein.“23 Dass Rahner diesen Satz mit einer spezifischen Begründung versah, wird oft übergangen.24 Dies macht es leichter, die Betonung darauf zu legen, dass es für christliche Mystiker darauf ankomme, „etwas“ erfahren zu haben. Dieses „etwas“ bleibt (absichtlich?) unbestimmt. Es sollte ausreichen, dass es irgend„etwas“ mit höheren Mächten zu tun habe!? Für K. Rahner war der Gegenstand einer „mystischen“ Erfahrung jedoch weder beliebig noch austauschbar. Für ihn war es entscheidend, dass es dabei um eine personale Erfahrung Gottes gehen müsse bzw. um eine Erfahrung der Wirklichkeit Gottes in der Sphäre des Interpersonalen.25 Wer am entscheidend Christlichen interessiert ist, muss diese Sphäre aufsuchen.