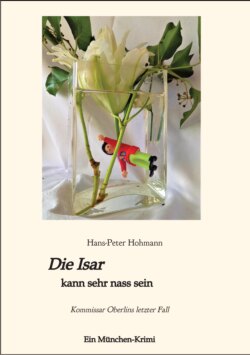Читать книгу Die Isar kann sehr nass sein - Hans-Peter Hohmann - Страница 6
Оглавление1
Ein möbliertes Zimmer – Bett, Tisch, zwei Stühle. Ein Schrank, der fast bis zur Decke reicht und der das Nötigste enthält, was man zum Leben braucht.
Am Fenster ein Ohrensessel aus dunklem Leder, davor ein Beistelltischchen, das hübsche, gedrechselte Beine hat. Das Fenster geht zum Hinterhof, wo es ruhig ist und schattig. Von der Decke baumelt eine Lampe, deren grelles Licht den ganzen Raum ausleuchtet. In einer Nische Bad und Toilette, vom Zimmer durch einen verschlissenen Vorhang abgetrennt.
Auf der nussbraunen, zerkratzten Holzplatte des Tischchens liegen alte Zeitungen, ein Krimi von Patricia Highsmith, Der talentierte Mister Ripley, und Erzählungen von Ingeborg Bachmann. Dazu ein amtliches Schreiben, geöffnet, und eine Brieftasche. Das Rotweinglas vom Vorabend steht nicht mehr da.
Er hatte es vorhin gespült und abgetrocknet, in der winzigen Küche, draußen, im Flur, die sich alle Bewohner der Pension teilen. Dann hatte er das Glas zurück in den Schrank zu den zwei anderen gestellt. Die Brieftasche steckte er ein. Jetzt konnte er gehen.
Frühstücken würde er im kleinen Café Zöttl in der Müllerstraße. Die Frau hinter der Theke, sie hieß Anni, den Nachnamen kannte er nicht, Frau Anni, wie sie angesprochen werden wollte, bediente ihn äußerst zuvorkommend. Sie nannte ihn beim Namen, sobald er die Tür öffnete und eintrat: „Schönen guten Morgen, Herr Oberlin.“
Sie fügte hinzu: „Wie immer?“, und als er nickte, erhellte ein Lächeln ihr Gesicht und strahlte in den schummrigen Raum hinein.
Vor knapp zehn Jahren war er ins Glockenbachviertel gezogen. Das hatte sich inzwischen vom Schmuddeleck der Münchner Innenstadt zur angesagten location gemausert. Nur die Müllerstraße, die streng genommen zur Isar-Vorstadt gehörte, hatte ihren leicht verranzten Charme in die neue Zeit hinübergerettet. Auf seinem täglichen Fußweg ins Zentrum erlebte Oberlin die Häutungen der Stadt so unmittelbar, als vollzögen sie sich an seinem eigenen Leib.
Nach dem schlichten Frühstück – ein Cappuccino, eine Semmel mit Butter und etwas Erdbeermarmelade, ein Croissant – ließ er sich noch ein wenig durch die Gässchen nördlich der Sendlinger Straße treiben. Mit dem trotz seiner Leibesfülle tänzelnden Schritt, dem hellgrauen Staubmantel, den er auch heute, an einem sonnig-kühlen Märztag, aufgeknöpft trug, mit den graumelierten Haaren, die ihm inzwischen fast wieder auf die Schultern fielen, hätte man ihn eher für einen Flaneur halten können als für einen Beamten, der auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte war.
Unter dem Mantel war er leger gekleidet: ein alter, unverwüstlicher Lodenjanker, ein kariertes Hemd ohne Krawatte, eine ausgeleierte Jeans. Seine schwarzen Haferlschuhe waren sorgfältig gepflegt. Auf den Gehstock, den er gelegentlich benutzte, wenn der Rücken sein Körpergewicht nicht mehr alleine tragen wollte, hatte er heute verzichtet; er fühlte sich beschwingt, das ruhige Wochenende hatte ihm gutgetan.
Man erkannte ihn hier und da auf den morgendlich frischen Straßen, ein herzliches „Grüß Gott“, ein Winken. Einer älteren Dame half er, ganz Kavalier der alten Schule, über die kaum befahrene Straße – die gute Tat des Tages, dachte er, das konnte er also abhaken.
Kurz nach acht Uhr dreißig war er fast am Ziel. Er bog in die Ettstraße ein, durchquerte den Hof, wich zwei eiligen Einsatzfahrzeugen aus und betrat das schmutzig-grüne Polizeipräsidium.
„Tach, Herr Hauptkommissar“, begrüßte ihn der Pförtner Ludwig, deutete eine salutierende Geste an und schlug im Geist vielleicht sogar die Hacken zusammen. Oberlin quittierte den Empfang mit einem freundlichen Nicken.
Gelegentlich, wenn der Gruß besonders zackig ausfiel, ließ er sich zu einem ironischen „Rühren!“ hinreißen, worauf Ludwig zuverlässig „Danke, Herr Hauptkommissar! Keine besonderen Vorkommnisse!“ antwortete.
Oberlin wusste, dass an dieser Stelle, nach dem Passieren der Eingangsloge, der erfreulichste Teil seines Arbeitstages bereits hinter ihm lag. Auf ihn warteten in den endlosen Fluren des Präsidiums nur noch knappe, allenfalls höfliche Begrüßungen, meistens jedoch verlegenes Schweigen oder hastig sich schließende Türen.
Außer dem Portier wartete nur eine einzige Person auf ihn: seine Assistentin Bernadette Rösler, die ihm erst vor wenigen Wochen zugeteilt worden war. Er hatte nicht darum gebeten, doch eines Tages saß sie da, als er kam, mit durchgestrecktem Rücken und einem wässrigen Blick aus blauen, durch eine groteske Brille unnatürlich vergrößerten Augen.
Er hatte sie unhöflich begrüßt, daraufhin war sie rot geworden und hätte fast angefangen zu weinen. Sie hatte dann den Kopf gesenkt, so dass er auf ihr struppiges, glanzloses braunes Haar starren musste. Er hatte sich eine Entschuldigung abgerungen, hatte etwas von Überarbeitung gemurmelt, was eine glatte Lüge war.
Sie hatte währenddessen ein Papiertaschentuch zwischen den Fingern zerkrümelt und anschließend die Teile in ihre Manteltasche gestopft. Dabei war sie erneut feuerrot geworden, nicht zum letzten Mal an jenem belanglosen Tag.
In der Zwischenzeit hatte er sich an sie gewöhnt, notgedrungen, denn sie erschien jeden Morgen auf die Minute pünktlich und wartete darauf, dass etwas geschah.
Auch heute saß sie an ihrem penibel aufgeräumten Schreibtisch und schaute ihn erwartungsvoll an, als er den kleinen Raum betrat, in den man ihn abgeschoben hatte. Oberlin seufzte, allerdings nur innerlich, schließlich wollte er die junge Frau nicht schon zu dieser frühen Stunde entmutigen. Sie hatte mehrere Stationen im Präsidium schneller als vorgesehen durchlaufen, denn jedes Mal war sie eiligst weitergereicht worden, „mit wärmsten Empfehlungen“, bis sie bei ihm, auf dem Abstellgleis, gelandet war.
Zwei Entsorgungsfälle, dachte Oberlin und setzte sich auf seinen Stuhl. Der knarzte, sobald der massige Körper des Kommissars mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. Drei Entsorgungsfälle, präzisierte Oberlin und musste grinsen. Dieses jämmerliche Kabuff, fensterlos und nur auf verschlungenen Wegen erreichbar – im Vergleich dazu wohnte er in seiner Pension geradezu luxuriös, wenn nicht sogar herrschaftlich.
„Eine neue Woche liegt vor uns, Bernadette. Was steht an?“, fragte er, eine Spur zu forsch, er wusste ja, dass nichts anstand, was sie ihm auch bestätigte: „Nichts, Herr Hauptkommissar.“ Und nach einer kurzen Pause: „Tut mir leid, Herr Hauptkommissar.“ Den letzten Satz hatte sie dahingehaucht und war dabei wieder rot geworden, als trüge sie persönlich die Schuld daran, dass erneut kein Kriminalfall den Weg zu ihm gefunden hatte. Sie übergab ihm die Kladde mit den Ein- und Ausgängen. Seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit, falls man ihr untätiges Herumsitzen so nennen konnte, hatte sie Buch geführt. Hatte mit ihrer sorgfältigen Jungmädchenschrift das Datum eingetragen, die Posten „eingehende Fälle“ und „abgeschlossene Fälle“ jeweils mit einem zarten Strich markiert, „Keine besonderen Vorkommnisse“ als Fazit des Tages notiert und eine kringelige Unterschrift daruntergesetzt: Bernadette Rösler, dreiunddreißig Mal, Zeile für Zeile akkurat mit identischem Schriftbild.
„Danke, Bernadette“, antwortete Oberlin und schaute sie prüfend an. Dass es ihr leid tat, ihn jeden Tag wieder enttäuschen zu müssen, war neu. Wollte sie, dass er sich gegen die Missachtung, die ihm widerfuhr, zur Wehr setzte? Wollte sie ihn vielleicht zu einer heroischen Tat anstacheln – das Zimmer des Leitenden Kriminalrats stürmen, eine der herumliegenden Akten mit den unerledigten Fällen an sich reißen, rascheste Aufklärung versprechen – etwas in dieser Richtung?
„Danke, Bernadette“, wiederholte Oberlin, „Sie können jetzt…“
Er wusste für den Bruchteil einer Sekunde nicht weiter, „…äh, jetzt Mittagspause machen.“
Bernadette schaute auf ihre Armbanduhr. Es war acht Uhr fünfundfünfzig. So früh war sie noch nie in die Mittagspause geschickt worden. Bisher hatten sie wenigstens immer ein paar Worte gewechselt. Der Kommissar hatte sie ausgefragt, woher sie komme, was sie zur Polizei geführt habe, ob sie anständig untergebracht sei, ob sie ihre Familie vermisse.
Smalltalk, nicht mehr, aber sie hatte gewissenhaft Auskunft gegeben. Und sie hatte mit sichtbarer Erleichterung registriert, dass ihr neuer Vorgesetzter, der sechste oder siebte, ein Mindestmaß an Interesse für sie aufbrachte. Offenbar waren ihm inzwischen die Fragen ausgegangen, oder er hatte heute keine Lust auf ein Gespräch.
Bernadette erhob sich zögernd, ging zur Tür, drehte sich um und schaute noch einmal demonstrativ auf die Uhr. Dann nestelte sie verlegen an ihrem Armband. Sie hoffte vielleicht, dass ihr Chef doch eine Bitte äußerte, einen Wunsch, den sie erfüllen könnte.
Vielleicht glaubte sie auch, dass er noch ein freundliches Wort für sie übrig haben würde, eine kleine Geste der Zuwendung. Oder wenigstens einen Abschiedsgruß, „Bis später“, zum Beispiel, oder „Erholen Sie sich gut!“.
Aber der Kommissar schaute mit leerem Blick auf die vergilbte Tapete an der Wand, die zum Innenhof ging. Da seine Assistentin den Ausgang versperrte, wäre ein Fenster an dieser Wand die einzige Fluchtmöglichkeit gewesen. Doch dieses Fenster gab es nicht. Hier, wo es hätte sein können, lehnte sich eine magere Birke von draußen an das Gebäude. Oberlin wusste das, denn sie war der letzte Baum, der sich dem energischen Entgrünungsprogramm der Direktion widersetzte.
Wo er, Oberlin, bis vor einem Jahr sein Büro hatte, in der Hansastraße, wurde man vom Grün des angrenzenden Parks fast zugewuchert. Sein Lieblingsbaum, eine libanesische Zeder, ließ ihre Äste in Richtung seines Fensters besonders kräftig austreiben, so dass sie, wenn der Wind ging, zärtlich über die Scheiben zu streifen schienen. Eichhörnchen waren auf den filigranen Zweigen bis zum Fenster balanciert und hatten neugierig die Schreibarbeiten des Kommissars beobachtet. Als Belohnung für diese lobenswerte Aufmerksamkeit hatte Oberlin immer ein paar Nüsse oder getrocknetes Obst auf den Sims gelegt.
Petrik, sein schreckhafter Assistent, war jedes Mal in Panik geraten, sobald er das Kratzen der Krallen auf dem Holzimitat des Fensterbretts hörte. Um seine empfindsamen Nerven zu schonen, war er irgendwann ins Präsidium gewechselt, wo er seinen wie mit der Axt gezogenen Seitenscheitel nun im Dunstkreis der Eliten spazieren tragen durfte.
Wenn er jetzt zufällig seinem früheren Vorgesetzten über den Weg lief, bemerkte Oberlin, dass Petriks Gesicht stets von feinen Schweißperlen überzogen war. Die ganze Welt hätte bezeugen können, welch schier unmenschliche Verantwortung der junge Mann auf seinen schmalen Schultern trug.
Oberlin hatte keine Veranlassung zu schwitzen. Im Gegenteil. Ihn hatte man ja kaltgestellt, er musste keine Verantwortung mehr tragen. Dabei hatte er jahrelang zu den erfolgreichen Ermittlern der Stadt gezählt – gründlich, methodisch sauber, dazu persönlich korrekt, was keine Selbstverständlichkeit war. Ab und zu hatte er geradezu genialisches Gespür bewiesen, bei vertrackten Fällen, die dank seiner unorthodoxen Ansätze gelöst werden konnten.
Natürlich hatte er keine hundertprozentige Aufklärungsquote vorzuweisen, anders als seine ehemaligen Kollegen Batič und Leitmayr, deren Ruf fast schon legendär war. Die ließen das gemeine Fußvolk allerdings auch spüren, dass sie etwas Besonderes waren, mit geradezu überirdischen Fähigkeiten gesegnet.
Oberlin hatte das kalt gelassen. „Die einen stehen halt im Licht, und die im Dunkeln sieht man nicht“, war sein üblicher Kommentar gewesen, und mehr gab es dazu seiner Meinung nach nicht zu sagen.
Noch unbeliebter als die zwei „Unzertrennlichen“ war nur Meuffels gewesen. Hanns Meuffels bzw. Hanns von Meuffels, aber das „von“ hatte man ihm schon früh ausgetrieben im Kommissariat. Oberlin hatte sich mit dem „Baron“ immer gut verstanden. Sie hatten den gleichen trockenen Humor und einen ähnlichen, ironischen Blick auf die Gesellschaft. Und auf Hanns‘ Freundin Constanze hatte auch Oberlin ein Auge geworfen. Aber er hatte keine Chance gesehen, bei ihr landen zu können, also ließ er es sein.
Seit Hanns mit Constanze nach Hamburg gezogen war, hatte Oberlin ihn nur noch zwei, drei Mal getroffen. Bei diesen seltenen Gelegenheiten hatten sie gewohnheitsmäßig eine Partie Schach im Café Münchner Freiheit gespielt, hatten über dies und das gesprochen, nichts Weltbewegendes.
Irgendwann war der Kontakt eingeschlafen. Hanns jedoch hätte ihm bestimmt beigestanden, vor einem Jahr, bei jenem verwünschten Fall, dessen desaströsen Ausgang man Oberlin in die Schuhe schob und der letztlich zu seiner Strafversetzung ins Präsidium geführt hatte.
Der Kommissar blickte um sich. Bernadette hatte den Raum verlassen. Wo ist sie?, dachte er mit leichter Besorgnis. Und warum war sie nicht mehr da? Dann fiel es ihm wieder ein, er selbst hatte sie ja weggeschickt. In die „Mittagspause“. Das Wort war ihm spontan eingefallen, aber dass er es ausgesprochen hatte, war mehr als peinlich. Was würde sie jetzt von ihm denken? Sein schlechtes Gewissen rührte sich. Vielleicht könnte er sie ja einladen, überlegte er. Als eine Art Wiedergutmachung.
Er hatte für heute Abend zwei Opernkarten zurücklegen lassen, Lucia di Lammermoor, im Nationaltheater. Petrenko würde dirigieren, die fabelhafte Diana Damrau gab die Lucia. Er würde Bernadette fragen, ob sie ihn begleiten wollte. Sein Opernfreund Achim hatte gestern, kurz vor Mitternacht, „mit größtem Bedauern“ abgesagt. Gleich, wenn sie aus ihrer „Mittagspause“ zurückkam, würde er sie fragen. Falls sie zurückkam. Und falls sie sich überhaupt etwas aus Opern machte.