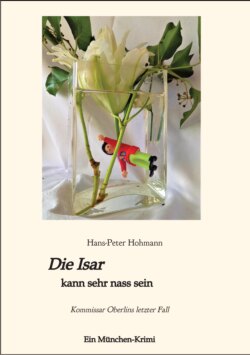Читать книгу Die Isar kann sehr nass sein - Hans-Peter Hohmann - Страница 8
Оглавление3
Es wurde fünf nach zwölf. Der Kommissar hatte verschlafen. Mit dem Rad fuhr er durch den Eisregen, in den sich der gestrige Schneefall verwandelt hatte, zur Ettstraße und kam gerade rechtzeitig, um Bernadette abzufangen. Sie wollte gerade die Mittagspause antreten, die echte, und eine Runde um den Block gehen, wie sie das meistens tat. Oberlin lud sie in ein Café am Lenbachplatz ein, „zum Frühstück“, wie er zugeben musste, denn zu Frau Anni hatte er es nicht mehr geschafft.
„Außerdem muss ich mich aufwärmen, Radeln im März ist nicht unbedingt das reinste Vergnügen.“
Er lachte, obwohl seine Hose fast bis zu den Knien aufgeweicht war. Und da er ohne Kopfbedeckung losgefahren war, tropfte das Wasser von seinen nassen Haaren in den Hemdkragen hinein.
Oberlin bemerkte, dass Bernadette ihn interessiert ansah. Vermutlich denkt sie sich ihr Teil, was meine Alltagstauglichkeit betrifft, glaubte er ihrem Blick zu entnehmen. Sie jedenfalls trug eine rote Wetterjacke und in der dick gepolsterten Kapuze verschwand ihr Kopf fast vollständig. Die Brille, die sie am Vorabend ebenfalls nicht getragen hatte, schien sie vergessen zu haben.
Sie hatte „zur Sicherheit“ einen kleinen Schirm mitgenommen, der bei diesem Wetter auf jeden Fall praktischer war als ein Fahrrad, wie Oberlin, als er ihn entgegennahm, dankbar feststellte, denn es regnete inzwischen buchstäblich in Strömen.
„Das könnte eine schöne Gewohnheit werden“, begann der Kommissar, nachdem er seinen nassen Mantel aufgehängt hatte. Er ließ sich neben Bernadette auf der Eckbank nieder, wobei er peinlich darauf bedacht war, dass sie nicht mit der triefenden Hose in Berührung kam.
„Die schöne Gewohnheit, sich ohne Frühstück vollregnen zu lassen?“, fragte sie und lächelte ihn unschuldig an.
Schon wieder ein neuer Zug an ihr, dachte Oberlin, witzig, schlagfertig, und er freute sich darauf, was es noch alles an ihr zu entdecken geben würde.
„Das könnte Ihnen so passen“, antwortete er, „ich als armes Opfer der widrigen Umstände, und Sie spielen hier die fürsorgliche Mutter, die dem Kleinen die Nase putzt und ihn trockenlegt…äh, Pardon,…abtrocknet, natürlich.“
Sein Versprecher war ihm peinlich, doch Bernadette ging lachend darüber hinweg und sagte:
„Für mütterliche Gefühle bin ich nicht zuständig, und das nächste Mal entlasse ich Sie einfach früher ins Bett, damit Sie nicht unausgeschlafen Ihren schweren Dienst antreten müssen.“
Erschrocken hielt sie inne. „Tut mir leid“, sagte sie und legte ihm leicht die Hand auf den Arm. „Das war gedankenlos, und außerdem geschmacklos. Bitte entschuldigen Sie, Herr Hauptkommissar.“
„Wenn Sie wüssten, wie recht Sie haben, Bernadette“, entgegnete Oberlin, „diese Art von Dienst ist wirklich schwer und belastend. Und apropos „Hauptkommissar“, könnten wir bitte auf derartige Förmlichkeiten verzichten? Oberlin, das muss reichen.“
Und nach einem Räuspern sagte er noch: „Auch ich muss mich entschuldigen.“
„Aber…“
„Doch, doch“, unterbrach er sie, „ich entschuldige mich, dass ich Sie immer mit Ihrem Vornamen angeredet habe, als wären Sie eine Schülerin oder eine irgendwie untergeordnete Person. Ich habe Sie respektlos behandelt, und das tut mir leid.“
„Entschuldigung angenommen“, sagte sie lächelnd. „Aber, bitte, bleiben Sie bei „Bernadette“. Denn für meine bisherigen Kollegen war ich immer nur „die Rösler“, oder „die dumme Rösler“, wenn sie glaubten, dass ich es nicht mitkriege. Wenn Sie mich dagegen mit „Bernadette“ anreden, fühle ich mich wie jemand, der gemocht wird. Wie jemand, um den man sich kümmern will. Und das wollen Sie doch, Herr Haupt…, äh, Herr Oberlin?“
Der Kommissar schluckte. Er konnte sich genau vorstellen, wie die jungen Schnösel vom Typ Petrik mit dieser reizlosen jungen Frau, als die sie sich bisher ausgegeben hatte, umgesprungen waren. Wie sie sie gnadenlos auflaufen ließen und mit anzüglichen Bemerkungen blöd anmachten.
Er selbst hatte sie zwar nicht bewusst herabgesetzt oder gar gedemütigt, zumindest erinnerte er sich nicht. Aber seine nur halb interessierte, gönnerhafte Fragerei, oder dass er sie einfach wegschickte, wie gestern, wenn er keine Lust zum Reden hatte und sich lieber in dem Unrecht, das man ihm antat, suhlen wollte – das war schon „unterste Schublade“ gewesen. So etwas hätte ihm nicht passieren dürfen.
„Ja, Bernadette. Ich werde mich um Sie kümmern“, sagte er und schaute sie an. Besser jedenfalls als bisher, ergänzte er in Gedanken, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen.
Sie nahm sein Versprechen mit leicht skeptischem Blick zur Kenntnis und bestellte sich einen Tee. Abwarten und Tee trinken, fiel ihm dazu automatisch ein. Und er dachte: Kluges Mädchen.
Sie aber lächelte, als hätte sie in seinen Gedanken gelesen.
Sie blieben, bis sämtliche Kleidungsstücke des Kommissars trocken waren. In diesen knapp zwei Stunden breitete Bernadette ihr Leben vor ihm aus: die vierköpfige Familie mit Hund; der kleine Ort in der Nähe von Landsberg; ihre mehr oder weniger ereignislose Schulzeit, der sich ein Jahr als Au-Pair-Mädchen in Kanada anschloss; das tragische Schicksal einer Freundin, das zu ihrem Entschluss, zur Polizei zu gehen, führte; die drei Jahre Ausbildung in Nürnberg, wo sie Triathlon als große Leidenschaft entdeckte; Abschluss als Jahrgangsbeste (damit rückte sie aber erst heraus, als Oberlin nachfragte). Außerdem betrieb sie diverse asiatische Kampfsportarten, gar nicht mal so schlecht, wie sie zugab. Aktuell kein Freund, das verriet sie auch noch, dafür zwei gute Freundinnen hier in München; eine war Kindergärtnerin, mit der wohnte sie zusammen. Die andere war IT-Entwicklerin, eine coole junge Frau, die ihr bei Recherchen helfen konnte.
Sie hatte eine kleine Wohnung in der Au gefunden, in der Lilienstraße. „Ein süßes Viertel“, so ihre Worte. Sie aß gern Chinesisch, Vietnamesisch, mit Vorliebe scharf. Dazu Jasmintee. Alkohol selten, wenn, dann Rotwein, „aber noch nie so guten wie gestern“, fügte sie hinzu.
„Und auch hier, im Café, mit Ihnen zu sitzen, finde ich schön. So, mehr fällt mir zu meiner Person nicht ein, und es reicht Ihnen vermutlich auch“, sagte sie, lachte und lehnte sich zurück.
Sie hatte, während sie die Stationen ihres vierundzwanzigjährigen Lebens durchgegangen war, die Tischdecke von sämtlichen Krümeln gereinigt, mehrmals, und das Tuch wieder und wieder glattgestrichen, so dass es nun wie neu aussah.
„Aber, Herr Oberlin“, setzte sie erneut an, „eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass Sie auch mir eine Frage gestatten, wenigstens eine, und zwar zu Ihrem sicher abwechslungsreichen und vielleicht sogar hochdramatischen Berufsleben.“
„Gestatten allemal, ob auch beantworten, hängt von der Frage ab“, entgegnete Oberlin und schob den Apfelstrudel, den er sich eben bestellt hatte, zur Seite. Der Appetit war ihm vergangen, denn er ahnte natürlich, was nun kommen würde. Die Frage aller Fragen. Sie war ihm von den wenigen Freunden und Bekannten, von Fremden wie Vertrauten gestellt worden.
Seine Standardantworten waren: „Ich bin noch nicht so weit, darüber zu reden.“ Dann: „Du bist der Erste, der es erfährt.“ Schließlich: „Ich kann die Frage nicht mehr hören!“
Seit einem Jahr ging das jetzt so, und er hätte alle Antworten, die er sich zurechtgelegt hatte, wie von einem Tonband abspulen können. Doch keinem hatte er bisher die Wahrheit anvertraut. Er war noch nicht bereit gewesen, sich jemandem zu öffnen.
Mit nachdenklichem Blick betrachtete er Bernadette. Ob sie vielleicht die Richtige wäre?, fragte er sich. Doch mal angenommen, sie stellte jetzt gleich diese ominöse Frage: „Was ist passiert, dass man Sie so mies behandelt, und warum lassen Sie sich diese miese Behandlung überhaupt gefallen?“ Würde dann nicht alles wie ein Sturzbach sich nach draußen ergießen? Würde nicht diese seit einem Jahr aufgestaute Enttäuschung, Empörung und Wut ungehemmt aus ihm herausplatzen? Und Bernadette würde das alles ungefiltert abkriegen!
Bevor er mit seinen Überlegungen zu Ende war, stellte Bernadette ihre Frage. Und sie überraschte ihn schon wieder. Sie hatte sich zu ihm herüber gebeugt und fragte dann mit gesenkter Stimme: „Gibt es einen Fall, den Sie nicht aufklären konnten? Oder mit dessen Aufklärung Sie nicht zufrieden waren? Und der Sie bis heute nicht loslässt?“
Um seine zunächst durchaus freudige Überraschung zu verbergen, setzte er eine nachdenkliche Miene auf und strich sich mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger über das Kinn; wie man das so tat, wenn man sich mit der Antwort Zeit lassen wollte.
In Wahrheit hatte er natürlich die Antwort parat. Es gab so einen Fall, was aber nichts Besonderes war. Denn jeder Ermittler hatte solch eine „Leiche im Keller“. Mindestens eine. Und jeder hütete sich, daran zu rühren. Manche Fälle konnten einfach nicht gelöst werden. Es gab keine verwertbaren Spuren. Motive oder Beweise fehlten. Mögliche Täter schieden aus, einer nach dem anderen, bis keiner mehr übrig blieb. Dann geht man die möglichen Täter ein weiteres Mal durch, nimmt ein paar unmögliche dazu. Die Hälfte stirbt in der Zwischenzeit, weil sich der Fall ewig hinzieht, bis er kein Fall mehr ist. Er wird zum cold case, wie es im TV-Krimisprech heißt, „kalter Käse“ im Kollegenjargon.
Sein Fall war anders gewesen. Es gab Spuren, Beweise, Aussagen. Was es nicht gegeben hatte, war ein plausibles Motiv. Doch als sogar ein Geständnis aufgetaucht war, hatte es für den Staatsanwalt kein Halten mehr gegeben: Hurra! Der Täter war gefunden!
Als „Zugabe“ hatte der sich dann noch selbst getötet. Das perfekte Szenario. Alles war „sonnenklar“ gewesen, so wörtlich Dr. Edgar Mangold, der zuständige Staatsanwalt, und das konnte selbst Oberlin nicht abstreiten. Logisch, dass die Akte geschlossen wurde und man weitere Ermittlungen für „nicht notwendig“ erachtete.
Die Ehefrau des Täters war von der Schuld ihres Mannes keineswegs überzeugt gewesen. Allerdings hatte sie das Alibi, das sie ihrem Mann zunächst gegeben hatte, wieder zurückgezogen. Merkwürdig, dass ihm das gerade einfiel. Eine hübsche Frau, sie hatte ihn buchstäblich auf Knien angefleht, ihr zu glauben. Und einige Zeit nach dem Selbstmord war sie plötzlich verschwunden gewesen. Geradezu unauffindbar. Oberlin hatte ein ungutes Gefühl gehabt, aber was sollte er machen? Sie musste allein mit diesem Schicksalsschlag zurechtkommen, zum Seelsorger fühlte er sich nicht berufen. Und schließlich war die Sachlage eindeutig gewesen, das musste man irgendwann einsehen, auch als trauernde Ehefrau.
Ein gewisses Unbehagen jedoch war geblieben. Ihm, Oberlin, war das alles irgendwie zu glatt gegangen, irgendwie zu stereotyp, und das hatte er auch versucht, seinen Leuten klarzumachen.
„Irgendwie, irgendwie“, hatte man ihn nachgeäfft, so dass er seine Zweifel schließlich exklusiv gehabt hatte. Und man schnitt ihm jedes Mal mit einem halb belustigten, halb angesäuerten „Oberlin, du nervst!“ das Wort ab, wenn er wieder damit anfangen wollte.
Ein, zwei Wochen später war dann ohnehin keine Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen, denn das mysteriöse Attentat auf den bayerischen Ministerpräsidenten hatte natürlich absolute Priorität. Und nach der raschen Aufklärung wartete wieder das Tagesgeschäft. Ein Mord jagte gewissermaßen den nächsten, es schien, als hätte sich die ganze Welt zu einem einzigen Mordkomplott verschworen.
So vergaß er den „sonnenklaren Fall“ allmählich und begrub „seine Leiche“ im Keller. Bis heute. Bis zu der Frage, die seine Assistentin ihm gerade in aller Unschuld gestellt hatte.
Das Ganze hatte sich vor zwölf Jahren zugetragen. Die damals in diese Angelegenheit verwickelten Personen dachten vermutlich nicht mehr daran. Wie er hatten sie es vielleicht verdrängt. Oder sogar vergessen.
Trotzdem meldete sich in diesem Augenblick ein beunruhigendes Gefühl. Eine Art schlechtes Gewissen. Als hätte er damals zu rasch aufgegeben. Als hätte er sich nur zu gern dem „Basta!“ des Staatsanwalts gefügt. Aus Bequemlichkeit? Oder aus Feigheit? Nicht auszudenken, wenn auch nur eines von beiden zutraf!
Er schwitzte. Der Hemdkragen, der plötzlich enger zu werden schien, schnürte ihm die Luft ab. Er griff zu einem Glas, dem nächstbesten, und schüttete den Inhalt in sich hinein. Besser fühlte er sich danach nicht.
Er könnte ja noch einmal einen Blick auf diese alte Geschichte werfen, dachte er. Er hatte nichts zu tun. Und er würde auch nichts mehr zu tun bekommen.
Er ballte die Faust, so dass sich die Fingernägel in das Fleisch bohrten. Ja, er wusste, dass man ihn zur Aufgabe zwingen wollte. Ihn zum Abgang in den vorzeitigen Ruhestand drängen wollte. Er könnte es allen, die ihn abgeschrieben hatten, noch einmal zeigen, ein letztes Mal. Allerdings nur, das musste er einräumen, wenn er die damalige glasklare Lösung widerlegen konnte.
Und noch ein Gedanke kam ihm. Endlich könnte er Bernadette etwas bieten. Sie müsste keine zarten Striche mehr ziehen, nicht mehr tapfer „Keine Vorkommnisse“ notieren, denn es würde ja „Vorkommnisse“ geben, auch wenn die zwölf Jahre zurücklagen und heute niemanden mehr interessierten.
Ihr frischer, unvoreingenommener Blick auf diese vergangenen Ereignisse, der würde sicher auch ihm gut tun. Sie würden bei Null anfangen. Vielleicht würden sich neue Wege eröffnen, überraschende Perspektiven auftun…
Er räusperte sich. Bernadette, die nicht mehr mit einer Antwort zu rechnen schien und in der Zwischenzeit ihr Smartphone bearbeitet hatte, wandte sich wieder dem Kommissar zu.
„Ja“, begann er zögernd und hörte eine fremd klingende Stimme sagen: „Ja, es gibt diesen Fall.“
Er atmete tief durch, dann sprach er weiter:
„Er gilt als geklärt, ich war mehr oder weniger einverstanden mit den Ergebnissen und vergaß die Geschichte. Dann kam Ihre Frage und ich spürte, dass ich mich irgendwie, äh, vielleicht jahrelang selbst belogen hatte.“
Er schluckte, dann schob er rasch hinterher: „Vermutlich ohne Grund, weil…, nun ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist und wir den richtigen Täter gefunden haben. Aber…“
Er musste wieder trinken, sein Hals fühlte sich wie ausgedörrt an. Er verschluckte sich, Bernadette klopfte ihm fürsorglich den Rücken, seine Stimme klang heiser, als er fortfuhr:
„Vielleicht habe ich mich geirrt, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dann müsste man, im Fall eines Irrtums, und um der Wahrheit willen, den Fall noch einmal, äh …, aufrollen, nicht wahr.“
Bernadette hörte nun sehr aufmerksam zu. Eine Tür öffnet sich, dachte sie, mal sehen, ob ich eintreten darf.
Oberlin trank noch ein Glas Wasser, das die Kellnerin inzwischen gebracht hatte.
„Eigentlich“, fuhr er fort, und es klang, als wollte er sich gegen das, was er gleich sagen würde, sträuben, „eigentlich ist es ja nicht gut, in alten Akten zu wühlen. Und es ist erst recht nicht gut, Staub aufzuwirbeln, der sich über das Vergangene gelegt hat. Man macht sich die Finger schmutzig, wenn man die vergilbten Unterlagen herauszieht und darin, äh, darin herumblättert. Oft, nein, eigentlich fast immer, findet man nichts Neues heraus. Die Quellen sind versiegt, die Personen in alle Winde zerstreut. Und dann ist die Enttäuschung groß, wenn man nicht weiterkommt. Größer jedoch sind die Schuldgefühle, wenn man erkennt, dass man einen Fehler gemacht hat, oder sogar mehrere. Am schlimmsten ist es, wenn man den falschen…“ Seine Stimme versagte endgültig.
Bernadette spürte, dass die Tür sich wieder schloss. Der Kommissar entfernte sich davon, den entscheidenden Satz zu sagen. Bernadette musste ihm beistehen. Sie legte erneut ihre Hand auf seinen Arm, nahe am Handgelenk, das sie mit dem Daumen leicht berührte. Oberlin schien es nicht zu bemerken.
„Vielleicht hilft ein Blick von außen?“, setzte sie vorsichtig an. Sie wollte dem Kommissar nicht das Gefühl geben, dass er zu etwas gedrängt wurde.
„Ein neutraler Blick, der nicht beurteilt. Und der niemanden verurteilt“, fuhr sie fort, als sie merkte, dass sich Oberlins verkrampfte Miene zu entspannen begann.
„Der Blick von jemandem, der auf Ihre Hilfe und Ihre Erfahrung angewiesen ist, Herr Oberlin. Der von Ihnen lernen will.“
Sie schwieg. Auch der Kommissar schwieg. Er hielt den Kopf leicht geneigt, als horchte er in sich hinein. Eine Minute verging, zwei.
Als Oberlin Bernadette wieder ansah, war sein Gesichtsausdruck klar und entschlossen.
„Sie haben recht, Bernadette“, sagte er, „wir werden uns diese alte Sache noch einmal gemeinsam vornehmen. Wir treffen uns morgen, acht Uhr dreißig, vor dem Archiv. Erstes Untergeschoss, aber Sie kennen sich wahrscheinlich aus.“
Bernadette nickte. Ihre Hand hob sie vorsichtig von Oberlins Arm ab. Die rote Druckstelle an seinem Handgelenk war noch mehrere Minuten zu sehen, bevor sie allmählich verblasste.